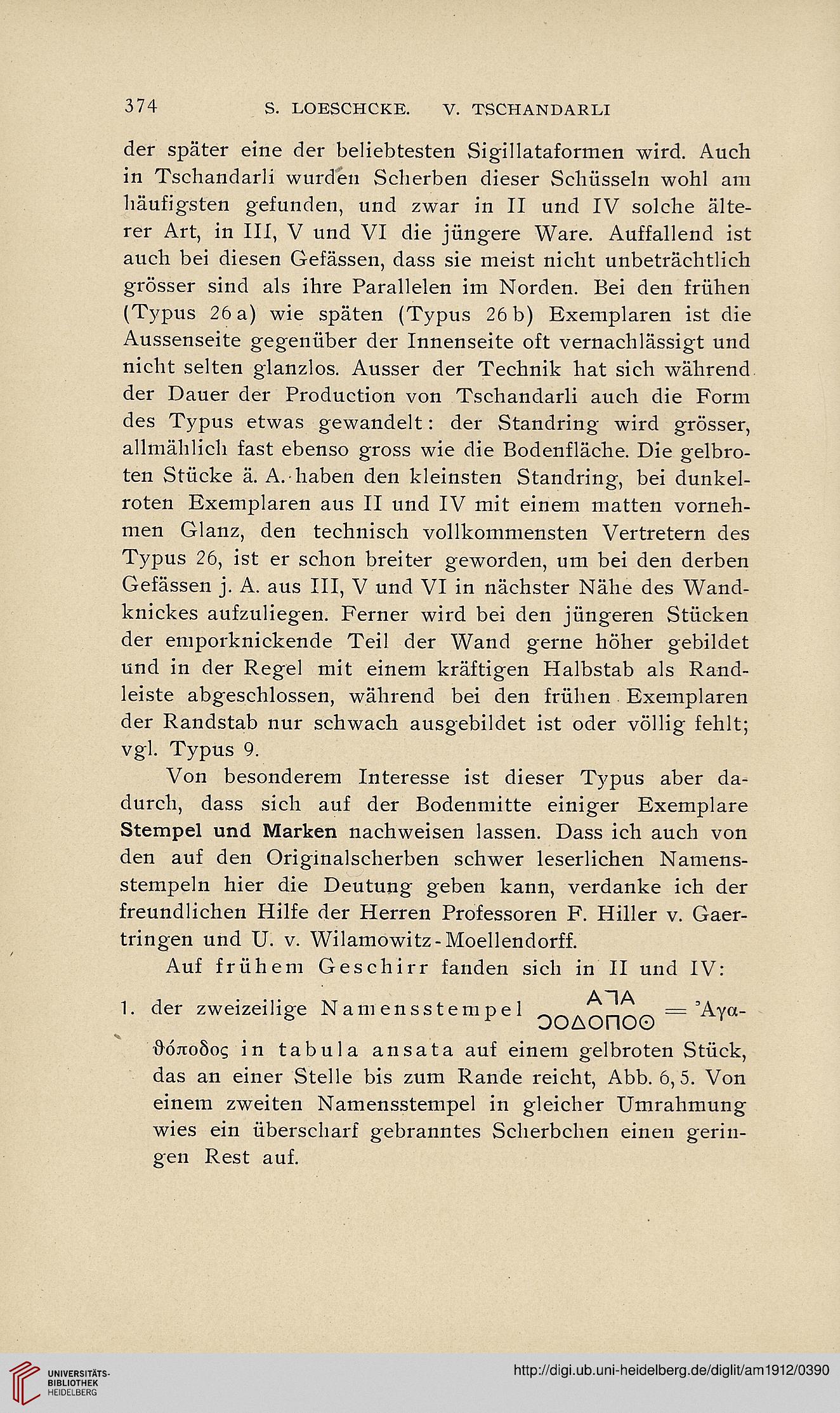374
S. LOESCHCKE. V. TSCHANDARL·!
der später eine der beliebtesten Sigillataformen wird. Auch
in Tschandarli wurden Scherben dieser Schüsseln wohl am
häufigsten gefunden, und zwar in II und IV solche älte-
rer Art, in III, V und VI die jüngere Ware. Auffallend ist
auch bei diesen Gefässen, dass sie meist nicht unbeträchtlich
grösser sind als ihre Parallelen im Norden. Bei den frühen
(Typus 26 a) wie späten (Typus 26 b) Exemplaren ist die
Aussenseite gegenüber der Innenseite oft vernachlässigt und
nicht selten glanzlos. Ausser der Technik hat sich während
der Dauer der Production von Tschandarli auch die Form
des Typus etwas gewandelt: der Standring wird grösser,
allmählich fast ebenso gross wie die Bodenfläche. Die gelbro-
ten Stücke ä. A. haben den kleinsten Standring, bei dunkel-
roten Exemplaren aus II und IV mit einem matten vorneh-
men Glanz, den technisch vollkommensten Vertretern des
Typus 26, ist er schon breiter geworden, um bei den derben
Gefässen j. A. aus III, V und VI in nächster Nähe des Wand-
knickes aufzuliegen. Ferner wird bei den jüngeren Stücken
der emporknickende Teil der Wand gerne höher gebildet
und in der Regel mit einem kräftigen Halbstab als Rand-
leiste abgeschlossen, während bei den frühen Exemplaren
der Randstab nur schwach ausgebildet ist oder völlig fehlt;
vgl. Typus 9.
Von besonderem Interesse ist dieser Typus aber da-
durch, dass sich auf der Bodenmitte einiger Exemplare
Stempel und Marken nachweisen lassen. Dass ich auch von
den auf den Originalscherben schwer leserlichen Namens-
stempeln hier die Deutung geben kann, verdanke ich der
freundlichen Hilfe der Herren Professoren F. Hiller v. Gaer-
tringen und U. v. Wilamowitz-Moellendorff.
Auf frühem Geschirr fanden sich in II und IV:
A~1A
1. der zweizeilige Namensstempel ^ΟΔΟΠΟΘ = ^a~
θόποδος in tabula ansata auf einem gelbroten Stück,
das an einer Stelle bis zum Rande reicht, Abb. 6, 5. Von
einem zweiten Namensstempel in gleicher Umrahmung
wies ein überscliarf gebranntes Scherbchen einen gerin-
gen Rest auf.
S. LOESCHCKE. V. TSCHANDARL·!
der später eine der beliebtesten Sigillataformen wird. Auch
in Tschandarli wurden Scherben dieser Schüsseln wohl am
häufigsten gefunden, und zwar in II und IV solche älte-
rer Art, in III, V und VI die jüngere Ware. Auffallend ist
auch bei diesen Gefässen, dass sie meist nicht unbeträchtlich
grösser sind als ihre Parallelen im Norden. Bei den frühen
(Typus 26 a) wie späten (Typus 26 b) Exemplaren ist die
Aussenseite gegenüber der Innenseite oft vernachlässigt und
nicht selten glanzlos. Ausser der Technik hat sich während
der Dauer der Production von Tschandarli auch die Form
des Typus etwas gewandelt: der Standring wird grösser,
allmählich fast ebenso gross wie die Bodenfläche. Die gelbro-
ten Stücke ä. A. haben den kleinsten Standring, bei dunkel-
roten Exemplaren aus II und IV mit einem matten vorneh-
men Glanz, den technisch vollkommensten Vertretern des
Typus 26, ist er schon breiter geworden, um bei den derben
Gefässen j. A. aus III, V und VI in nächster Nähe des Wand-
knickes aufzuliegen. Ferner wird bei den jüngeren Stücken
der emporknickende Teil der Wand gerne höher gebildet
und in der Regel mit einem kräftigen Halbstab als Rand-
leiste abgeschlossen, während bei den frühen Exemplaren
der Randstab nur schwach ausgebildet ist oder völlig fehlt;
vgl. Typus 9.
Von besonderem Interesse ist dieser Typus aber da-
durch, dass sich auf der Bodenmitte einiger Exemplare
Stempel und Marken nachweisen lassen. Dass ich auch von
den auf den Originalscherben schwer leserlichen Namens-
stempeln hier die Deutung geben kann, verdanke ich der
freundlichen Hilfe der Herren Professoren F. Hiller v. Gaer-
tringen und U. v. Wilamowitz-Moellendorff.
Auf frühem Geschirr fanden sich in II und IV:
A~1A
1. der zweizeilige Namensstempel ^ΟΔΟΠΟΘ = ^a~
θόποδος in tabula ansata auf einem gelbroten Stück,
das an einer Stelle bis zum Rande reicht, Abb. 6, 5. Von
einem zweiten Namensstempel in gleicher Umrahmung
wies ein überscliarf gebranntes Scherbchen einen gerin-
gen Rest auf.