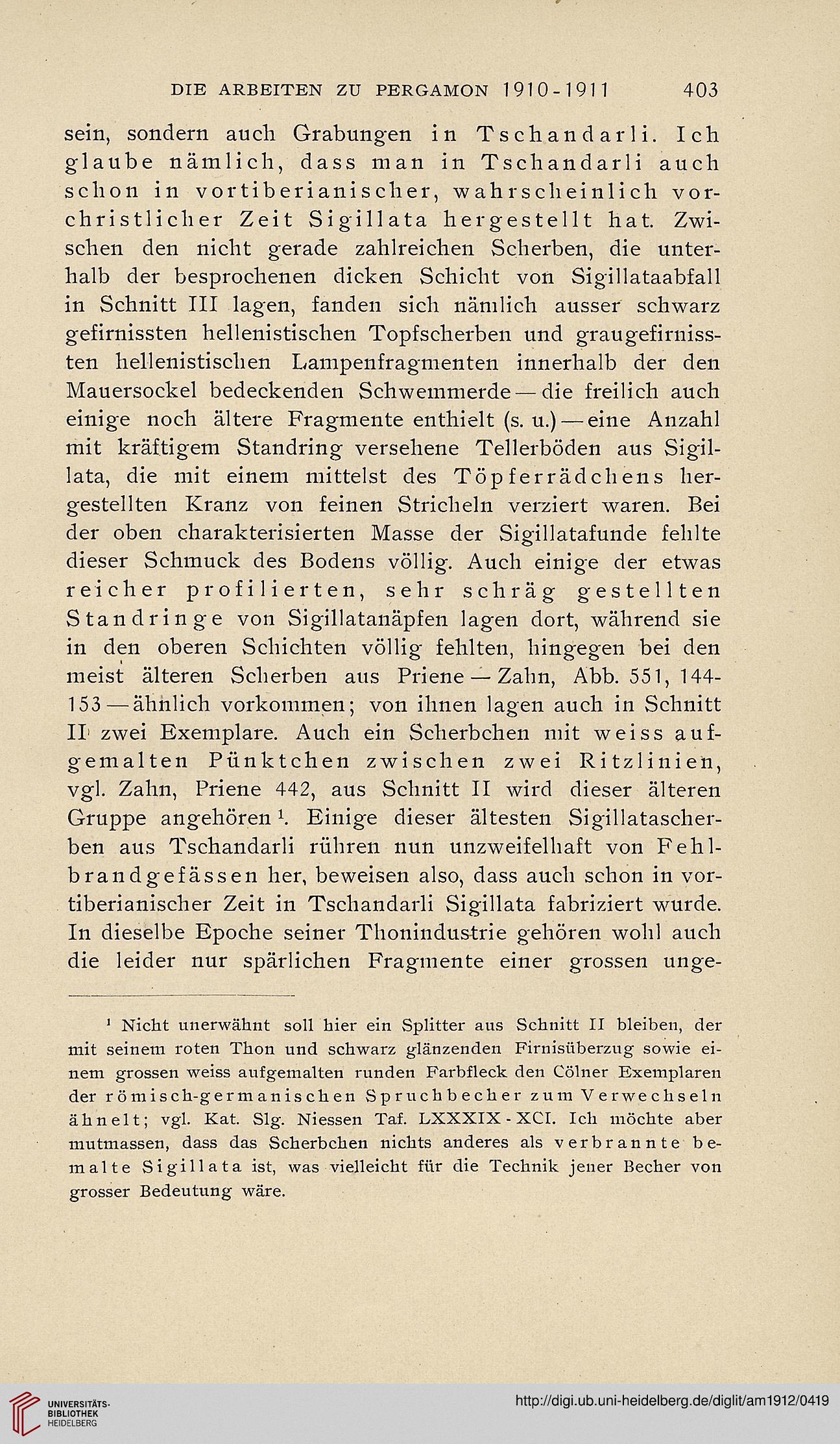DIE ARBEITEN ZU PERGAMON 1910-1911
403
sein, sondern auch Grabungen in Tschandarli. Ich
glaube nämlich, dass man in Tschandarli auch
schon in vortiberianischer, wahrscheinlich vor-
christlicher Zeit Sigillata her gestellt hat. Zwi-
schen den nicht gerade zahlreichen Scherben, die unter-
halb der besprochenen dicken Schicht von Sigillataabfall
in Schnitt III lagen, fanden sich nämlich ausser schwarz
gefirnissten hellenistischen Topfscherben und graugefirniss-
ten hellenistischen Lampenfragmenten innerhalb der den
Mauersockel bedeckenden Schwemmerde — die freilich auch
einige noch ältere Fragmente enthielt (s. u.) — eine Anzahl
mit kräftigem Standring versehene Tellerböden aus Sigil-
lata, die mit einem mittelst des Töpferrädchens her-
gestellten Kranz von feinen Stricheln verziert waren. Bei
der oben charakterisierten Masse der Sigillatafunde fehlte
dieser Schmuck des Bodens völlig. Auch einige der etwas
reicher profilierten, sehr schräg gestellten
Standringe von Sigillatanäpfen lagen dort, während sie
in den oberen Schichten völlig fehlten, hingegen bei den
meist älteren Scherben aus Priene — Zahn, Abb. 551, 144-
153—ähnlich Vorkommen; von ihnen lagen auch in Schnitt
II zwei Exemplare. Auch ein Sclierbehen mit weiss auf-
gemalten Pünktchen zwischen zwei R i t z 1 i u i e n,
vgl. Zahn, Priene 442, aus Schnitt II wird dieser älteren
Gruppe angehören1. Einige dieser ältesten Sigillatascher-
ben aus Tschandarli rühren nun unzweifelhaft von Fehl-
brandgefässen her, beweisen also, dass auch schon in vor-
tiberianischer Zeit in Tschandarli Sigillata fabriziert wurde.
In dieselbe Epoche seiner Thouindustrie gehören wohl auch
die leider nur spärlichen Fragmente einer grossen unge-
1 Nicht unerwähnt soll hier ein Splitter aus Schnitt II bleiben, der
mit seinem roten Thon und schwarz glänzenden Firnisüberzug sowie ei-
nem grossen weiss aufgemalten runden Farbfleck den Cölner Exemplaren
der römisch-germanischen Spruchbecher zum Verwechseln
ähnelt; vgl. Kat. Slg. Niessen Taf. LXXXIX - XCI. Ich möchte aber
mutmassen, dass das Scherbchen nichts anderes als verbrannte be-
malte Sigillata ist, was vielleicht für die Technik jener Becher von
grosser Bedeutung wäre.
403
sein, sondern auch Grabungen in Tschandarli. Ich
glaube nämlich, dass man in Tschandarli auch
schon in vortiberianischer, wahrscheinlich vor-
christlicher Zeit Sigillata her gestellt hat. Zwi-
schen den nicht gerade zahlreichen Scherben, die unter-
halb der besprochenen dicken Schicht von Sigillataabfall
in Schnitt III lagen, fanden sich nämlich ausser schwarz
gefirnissten hellenistischen Topfscherben und graugefirniss-
ten hellenistischen Lampenfragmenten innerhalb der den
Mauersockel bedeckenden Schwemmerde — die freilich auch
einige noch ältere Fragmente enthielt (s. u.) — eine Anzahl
mit kräftigem Standring versehene Tellerböden aus Sigil-
lata, die mit einem mittelst des Töpferrädchens her-
gestellten Kranz von feinen Stricheln verziert waren. Bei
der oben charakterisierten Masse der Sigillatafunde fehlte
dieser Schmuck des Bodens völlig. Auch einige der etwas
reicher profilierten, sehr schräg gestellten
Standringe von Sigillatanäpfen lagen dort, während sie
in den oberen Schichten völlig fehlten, hingegen bei den
meist älteren Scherben aus Priene — Zahn, Abb. 551, 144-
153—ähnlich Vorkommen; von ihnen lagen auch in Schnitt
II zwei Exemplare. Auch ein Sclierbehen mit weiss auf-
gemalten Pünktchen zwischen zwei R i t z 1 i u i e n,
vgl. Zahn, Priene 442, aus Schnitt II wird dieser älteren
Gruppe angehören1. Einige dieser ältesten Sigillatascher-
ben aus Tschandarli rühren nun unzweifelhaft von Fehl-
brandgefässen her, beweisen also, dass auch schon in vor-
tiberianischer Zeit in Tschandarli Sigillata fabriziert wurde.
In dieselbe Epoche seiner Thouindustrie gehören wohl auch
die leider nur spärlichen Fragmente einer grossen unge-
1 Nicht unerwähnt soll hier ein Splitter aus Schnitt II bleiben, der
mit seinem roten Thon und schwarz glänzenden Firnisüberzug sowie ei-
nem grossen weiss aufgemalten runden Farbfleck den Cölner Exemplaren
der römisch-germanischen Spruchbecher zum Verwechseln
ähnelt; vgl. Kat. Slg. Niessen Taf. LXXXIX - XCI. Ich möchte aber
mutmassen, dass das Scherbchen nichts anderes als verbrannte be-
malte Sigillata ist, was vielleicht für die Technik jener Becher von
grosser Bedeutung wäre.