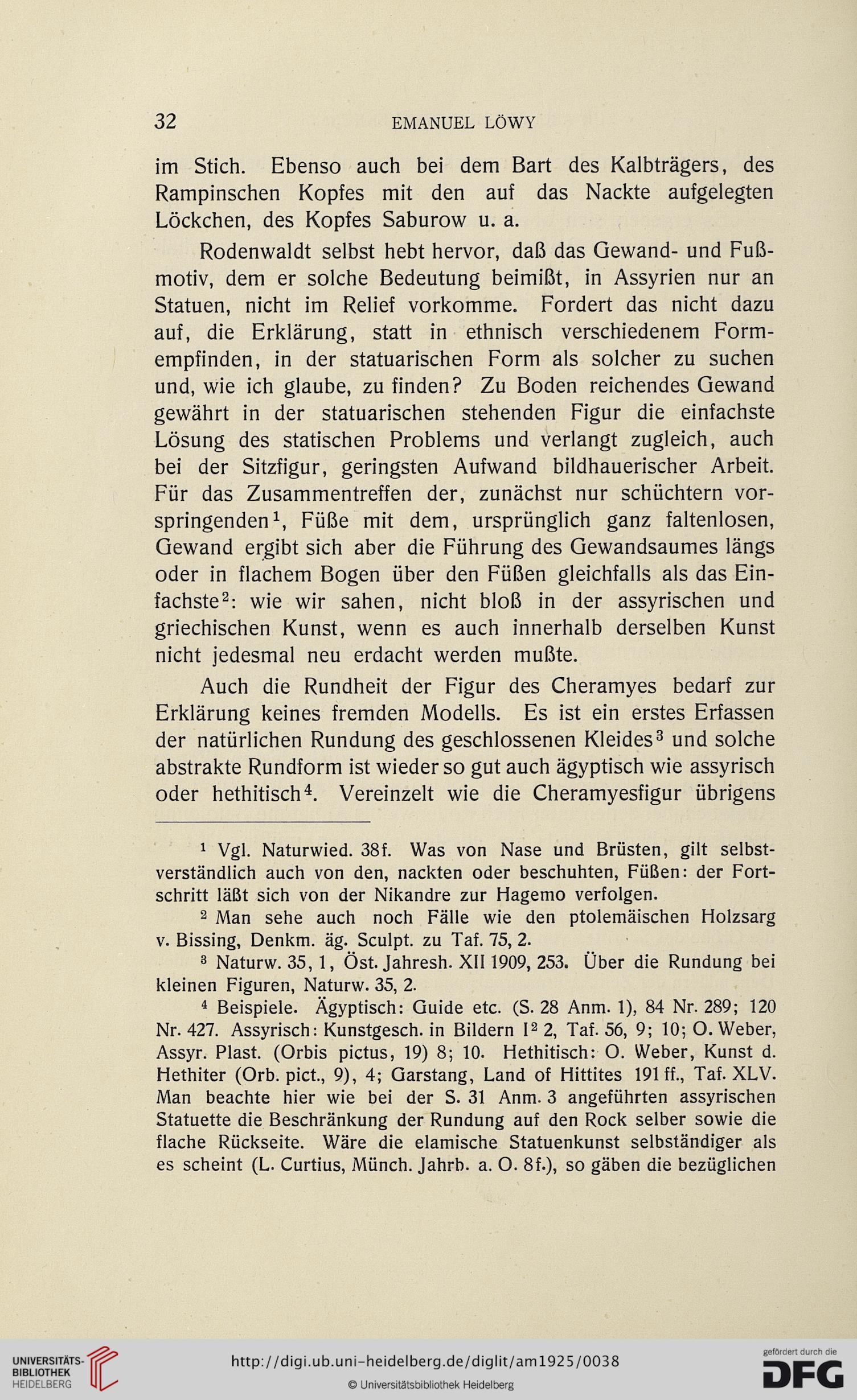32
EMANUEL LÖWY
im Stich. Ebenso auch bei dem Bart des Kalbträgers, des
Rampinschen Kopfes mit den auf das Nackte aufgelegten
Löckchen, des Kopfes Saburow u. a.
Rodenwaldt selbst hebt hervor, daß das Qewand- und Fuß-
motiv, dem er solche Bedeutung beimißt, in Assyrien nur an
Statuen, nicht im Relief vorkomme. Fordert das nicht dazu
auf, die Erklärung, statt in ethnisch verschiedenem Form-
empfinden, in der statuarischen Form als solcher zu suchen
und, wie ich glaube, zu finden? Zu Boden reichendes Gewand
gewährt in der statuarischen stehenden Figur die einfachste
Lösung des statischen Problems und verlangt zugleich, auch
bei der Sitzfigur, geringsten Aufwand bildhauerischer Arbeit.
Für das Zusammentreffen der, zunächst nur schüchtern vor-
springenden\ Fiiße mit dem, ursprünglich ganz faltenlosen,
Gewand ergibt sich aber die Fiihrung des Gewandsaumes längs
oder in flachem Bogen iiber den Fiißen gleichfalls als das Ein-
fachste 1 2: wie wir sahen, nicht bloß in der assyrischen und
griechischen Kunst, wenn es auch innerhalb derselben Kunst
nicht jedesmal neu erdacht werden mußte.
Auch die Rundheit der Figur des Cheramyes bedarf zur
Erklärung keines fremden Modells. Es ist ein erstes Erfassen
der natiirlichen Rundung des geschlossenen Kleides 3 und solche
abstrakte Rundform ist wiederso gut auch ägyptisch wie assyrisch
oder hethitisch 4. Vereinzelt wie die Cheramyesfigur iibrigens
1 Vgl. Naturwied. 38f. Was von Nase und Brüsten, gilt selbst-
verständlich auch von den, nackten oder beschuhten, Füßen: der Fort-
schritt läßt sich von der Nikandre zur Hagemo verfolgen.
2 Man sehe auch noch Fälle wie den ptolemäischen Holzsarg
v. Bissing, Denkm. äg. Sculpt. zu Taf. 75, 2.
3 Naturw. 35, 1, Öst. Jahresh. XII1909, 253. Über die Rundung bei
kleinen Figuren, Naturw. 35, 2.
4 Beispiele. Ägyptisch: Guide etc. (S. 28 Anm. 1), 84 Nr. 289; 120
Nr. 427. Assyrisch: Kunstgesch. in Bildern I 2 2, Taf. 56, 9; 10; O. Weber,
Assyr. Plast. (Orbis pictus, 19) 8; 10. Hethitisch: O. Weber, Kunst d.
Hethiter (Orb. pict., 9), 4; Garstang, Land of Hittites 191 ff., Taf. XLV.
Man beachte hier wie bei der S. 31 Anm. 3 angeführten assyrischen
Statuette die Beschränkung der Rundung auf den Rock selber sowie die
flache Rückseite. Wäre die elamische Statuenkunst selbständiger als
es scheint (L. Curtius, Miinch. Jahrb. a. O. 8f.), so gäben die beziiglichen
EMANUEL LÖWY
im Stich. Ebenso auch bei dem Bart des Kalbträgers, des
Rampinschen Kopfes mit den auf das Nackte aufgelegten
Löckchen, des Kopfes Saburow u. a.
Rodenwaldt selbst hebt hervor, daß das Qewand- und Fuß-
motiv, dem er solche Bedeutung beimißt, in Assyrien nur an
Statuen, nicht im Relief vorkomme. Fordert das nicht dazu
auf, die Erklärung, statt in ethnisch verschiedenem Form-
empfinden, in der statuarischen Form als solcher zu suchen
und, wie ich glaube, zu finden? Zu Boden reichendes Gewand
gewährt in der statuarischen stehenden Figur die einfachste
Lösung des statischen Problems und verlangt zugleich, auch
bei der Sitzfigur, geringsten Aufwand bildhauerischer Arbeit.
Für das Zusammentreffen der, zunächst nur schüchtern vor-
springenden\ Fiiße mit dem, ursprünglich ganz faltenlosen,
Gewand ergibt sich aber die Fiihrung des Gewandsaumes längs
oder in flachem Bogen iiber den Fiißen gleichfalls als das Ein-
fachste 1 2: wie wir sahen, nicht bloß in der assyrischen und
griechischen Kunst, wenn es auch innerhalb derselben Kunst
nicht jedesmal neu erdacht werden mußte.
Auch die Rundheit der Figur des Cheramyes bedarf zur
Erklärung keines fremden Modells. Es ist ein erstes Erfassen
der natiirlichen Rundung des geschlossenen Kleides 3 und solche
abstrakte Rundform ist wiederso gut auch ägyptisch wie assyrisch
oder hethitisch 4. Vereinzelt wie die Cheramyesfigur iibrigens
1 Vgl. Naturwied. 38f. Was von Nase und Brüsten, gilt selbst-
verständlich auch von den, nackten oder beschuhten, Füßen: der Fort-
schritt läßt sich von der Nikandre zur Hagemo verfolgen.
2 Man sehe auch noch Fälle wie den ptolemäischen Holzsarg
v. Bissing, Denkm. äg. Sculpt. zu Taf. 75, 2.
3 Naturw. 35, 1, Öst. Jahresh. XII1909, 253. Über die Rundung bei
kleinen Figuren, Naturw. 35, 2.
4 Beispiele. Ägyptisch: Guide etc. (S. 28 Anm. 1), 84 Nr. 289; 120
Nr. 427. Assyrisch: Kunstgesch. in Bildern I 2 2, Taf. 56, 9; 10; O. Weber,
Assyr. Plast. (Orbis pictus, 19) 8; 10. Hethitisch: O. Weber, Kunst d.
Hethiter (Orb. pict., 9), 4; Garstang, Land of Hittites 191 ff., Taf. XLV.
Man beachte hier wie bei der S. 31 Anm. 3 angeführten assyrischen
Statuette die Beschränkung der Rundung auf den Rock selber sowie die
flache Rückseite. Wäre die elamische Statuenkunst selbständiger als
es scheint (L. Curtius, Miinch. Jahrb. a. O. 8f.), so gäben die beziiglichen