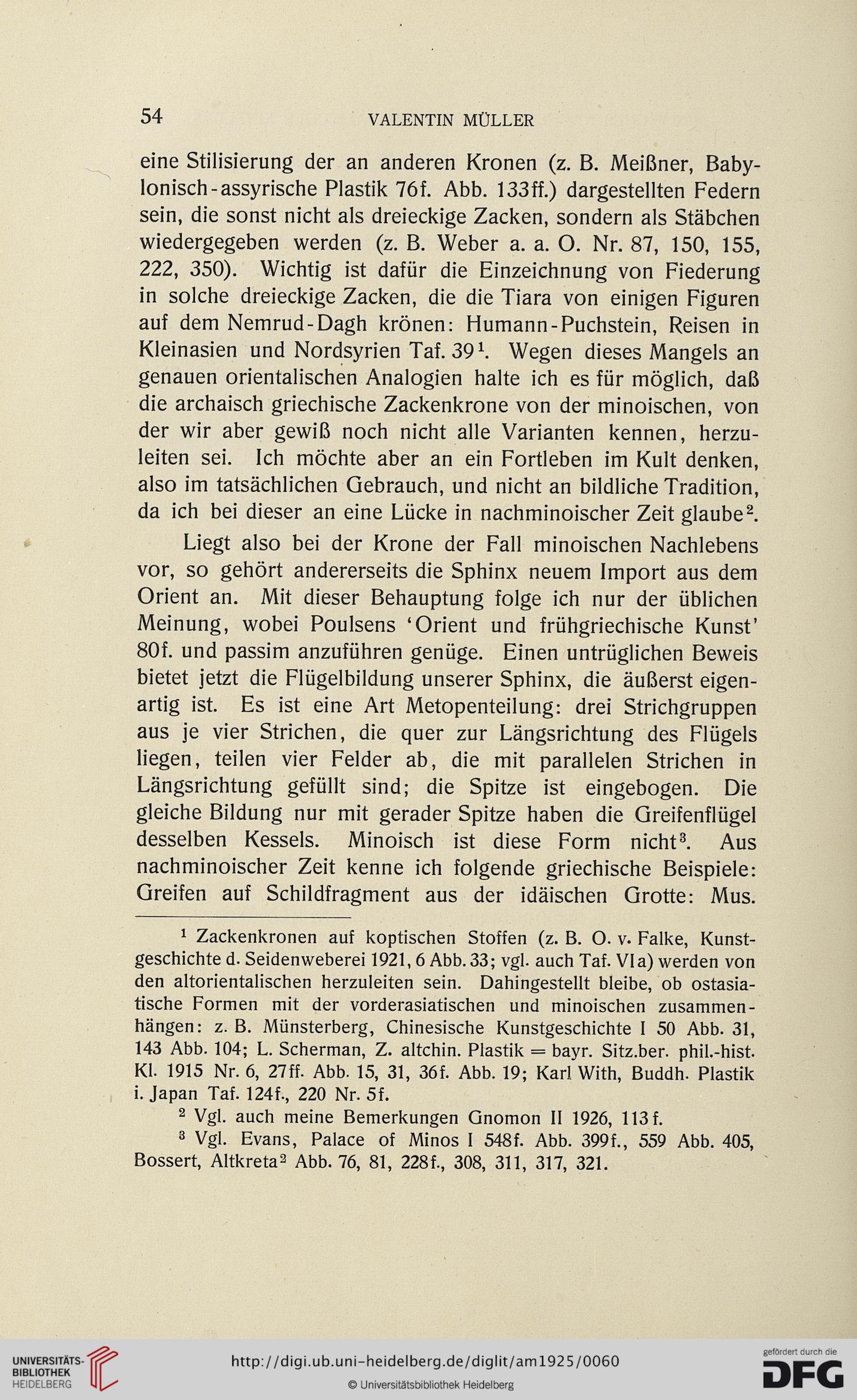54
VALENTIN MÜLLER
eine Stilisierung der an anderen Kronen (z. B. Meißner, Baby-
lonisch-assyrische Plastik 76f. Abb. 133ff.) dargestellten Federn
sein, die sonst nicht als dreieckige Zacken, sondern als Stäbchen
wiedergegeben werden (z. B. Weber a. a. O. Nr. 87, 150, 155,
222, 350). Wichtig ist dafür die Einzeichnung von Fiederung
in solche dreieckige Zacken, die die Tiara von einigen Figuren
auf dem Nemrud-Dagh krönen: Humann-Puchstein, Reisen in
Kleinasien und Nordsyrien Taf. 39 1. Wegen dieses Mangels an
genauen orientalischen Analogien halte ich es für möglich, daß
die archaisch griechische Zackenkrone von der minoischen, von
der wir aber gewiß noch nicht alle Varianten kennen, herzu-
leiten sei. Ich möchte aber an ein Fortleben im Kult denken,
also im tatsächlichen Gebrauch, und nicht an bildliche Tradition,
da ich bei dieser an eine Lücke in nachminoischer Zeit glaube 2.
Liegt also bei der Krone der Fall minoischen Nachlebens
vor, so gehört andererseits die Sphinx neuem Import aus dem
Orient an. Mit dieser Behauptung folge ich nur der üblichen
Meinung, wobei Poulsens ‘Orient und friihgriechische Kunst’
80f. und passim anzufiihren geniige. Einen untriiglichen Beweis
bietet jetzt die Fliigelbildung unserer Sphinx, die äußerst eigen-
artig ist. Es ist eine Art Metopenteilung: drei Strichgruppen
aus je vier Strichen, die quer zur Längsrichtung des Fliigels
liegen, teilen vier Felder ab, die mit parallelen Strichen in
Längsrichtung gefiillt sind; die Spitze ist eingebogen. Die
gleiche Bildung nur mit gerader Spitze haben die Greifenfliigel
desselben Kessels. Minoisch ist diese Form nicht 3. Aus
nachminoischer Zeit kenne ich folgende griechische Beispiele:
Greifen auf Schildfragment aus der idäischen Grotte: Mus.
1 Zackenkronen auf koptischen Stoffen (z. B. O. v. Falke, Kunst-
geschichte d. Seidenweberei 1921,6 Abb. 33; vgl. auch Taf. VI a) werden von
den altorientalischen herzuleiten sein. Dahingestellt bleibe, ob ostasia-
tische Formen mit der vorderasiatischen und minoischen zusammen-
hängen: z. B. Münsterberg, Chinesische Kunstgeschichte I 50 Abb. 31,
143 Abb. 104; L. Scherman, Z. altchin. Plastik = bayr. Sitz.ber. phil.-hist.
Kl. 1915 Nr. 6, 27ff. Abb. 15, 31, 36f. Abb. 19; Karl With, Buddh. Plastik
i. Japan Taf. 124f., 220 Nr. 5f.
2 Vgl. auch meine Bemerkungen Gnomon II 1926, 113 f.
3 Vgl. Evans, Palace of Minos I 548f. Abb. 399f., 559 Abb. 405,
Bossert, Altkreta 2 Abb. 76, 81, 228f., 308, 311, 317, 321.
VALENTIN MÜLLER
eine Stilisierung der an anderen Kronen (z. B. Meißner, Baby-
lonisch-assyrische Plastik 76f. Abb. 133ff.) dargestellten Federn
sein, die sonst nicht als dreieckige Zacken, sondern als Stäbchen
wiedergegeben werden (z. B. Weber a. a. O. Nr. 87, 150, 155,
222, 350). Wichtig ist dafür die Einzeichnung von Fiederung
in solche dreieckige Zacken, die die Tiara von einigen Figuren
auf dem Nemrud-Dagh krönen: Humann-Puchstein, Reisen in
Kleinasien und Nordsyrien Taf. 39 1. Wegen dieses Mangels an
genauen orientalischen Analogien halte ich es für möglich, daß
die archaisch griechische Zackenkrone von der minoischen, von
der wir aber gewiß noch nicht alle Varianten kennen, herzu-
leiten sei. Ich möchte aber an ein Fortleben im Kult denken,
also im tatsächlichen Gebrauch, und nicht an bildliche Tradition,
da ich bei dieser an eine Lücke in nachminoischer Zeit glaube 2.
Liegt also bei der Krone der Fall minoischen Nachlebens
vor, so gehört andererseits die Sphinx neuem Import aus dem
Orient an. Mit dieser Behauptung folge ich nur der üblichen
Meinung, wobei Poulsens ‘Orient und friihgriechische Kunst’
80f. und passim anzufiihren geniige. Einen untriiglichen Beweis
bietet jetzt die Fliigelbildung unserer Sphinx, die äußerst eigen-
artig ist. Es ist eine Art Metopenteilung: drei Strichgruppen
aus je vier Strichen, die quer zur Längsrichtung des Fliigels
liegen, teilen vier Felder ab, die mit parallelen Strichen in
Längsrichtung gefiillt sind; die Spitze ist eingebogen. Die
gleiche Bildung nur mit gerader Spitze haben die Greifenfliigel
desselben Kessels. Minoisch ist diese Form nicht 3. Aus
nachminoischer Zeit kenne ich folgende griechische Beispiele:
Greifen auf Schildfragment aus der idäischen Grotte: Mus.
1 Zackenkronen auf koptischen Stoffen (z. B. O. v. Falke, Kunst-
geschichte d. Seidenweberei 1921,6 Abb. 33; vgl. auch Taf. VI a) werden von
den altorientalischen herzuleiten sein. Dahingestellt bleibe, ob ostasia-
tische Formen mit der vorderasiatischen und minoischen zusammen-
hängen: z. B. Münsterberg, Chinesische Kunstgeschichte I 50 Abb. 31,
143 Abb. 104; L. Scherman, Z. altchin. Plastik = bayr. Sitz.ber. phil.-hist.
Kl. 1915 Nr. 6, 27ff. Abb. 15, 31, 36f. Abb. 19; Karl With, Buddh. Plastik
i. Japan Taf. 124f., 220 Nr. 5f.
2 Vgl. auch meine Bemerkungen Gnomon II 1926, 113 f.
3 Vgl. Evans, Palace of Minos I 548f. Abb. 399f., 559 Abb. 405,
Bossert, Altkreta 2 Abb. 76, 81, 228f., 308, 311, 317, 321.