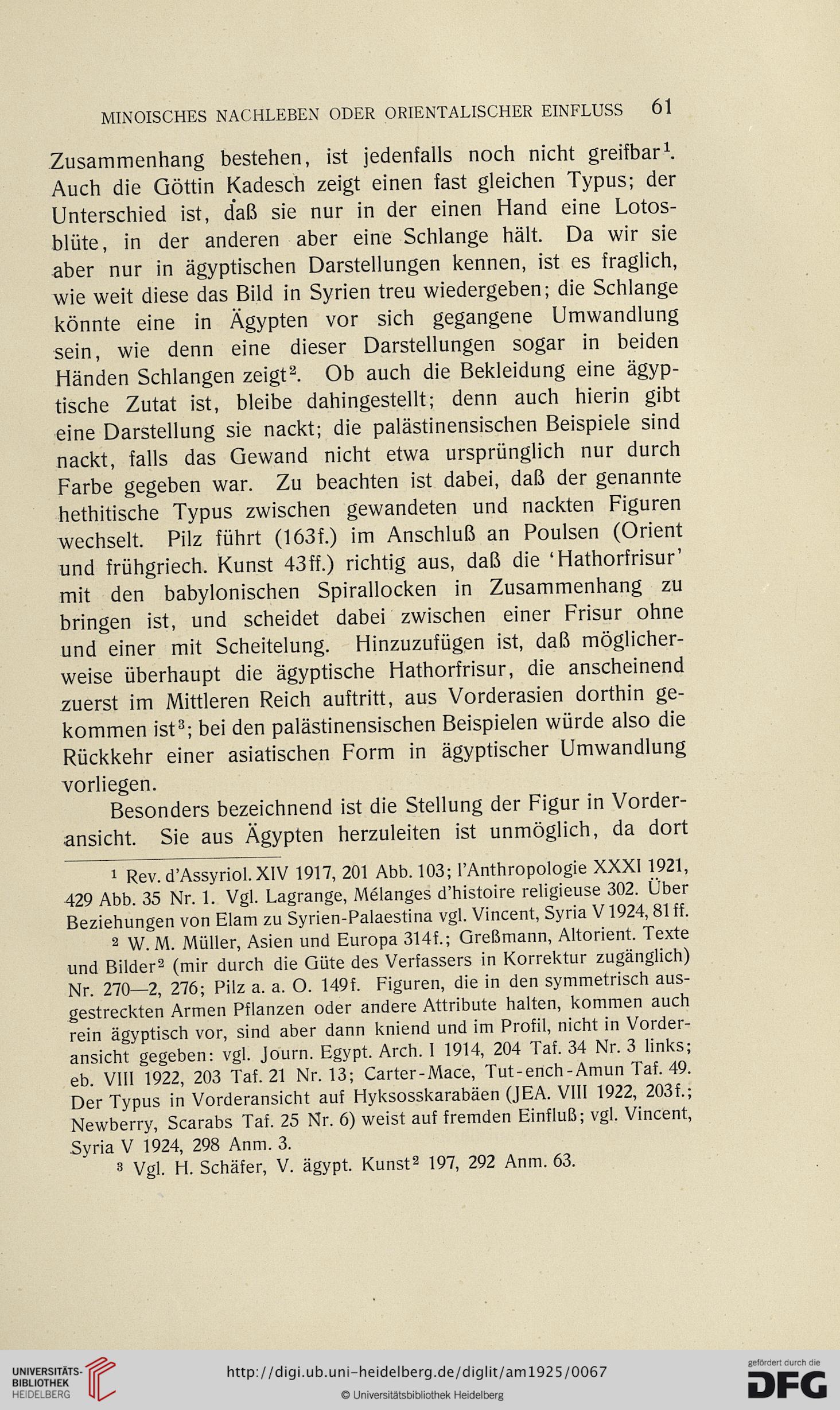MINOISCHES NACHLEBEN ODER ORIENTALISCHER EINFLUSS 61
Zusammenhang bestehen, ist jedenfalls noch nicht greifbar 1.
Auch die Göttin Kadesch zeigt einen fast gleichen Typus; der
Unterschied ist, daß sie nur in der einen Hand eine Lotos-
blüte, in der anderen aber eine Schlange hält. Da wir sie
aber nur in ägyptischen Darstellungen kennen, ist es fraglich,
wie weit diese das Bild in Syrien treu wiedergeben; die Schlange
könnte eine in Ägypten vor sich gegangene Umwandlung
sein, wie denn eine dieser Darstellungen sogar in beiden
Händen Schlangen zeigt 2. Ob auch die Bekleidung eine ägyp-
tische Zutat ist, bleibe dahingestellt; denn auch hierin gibt
eine Darstellung sie nackt; die palästinensischen Beispiele sind
nackt, falls das Gewand nicht etwa ursprünglich nur durch
Farbe gegeben war. Zu beachten ist dabei, daß der genannte
hethitische Typus zwischen gewandeten und nackten Figuren
wechselt. Pilz führt (163f.) im Anschluß an Poulsen (Orient
und frühgriech. Kunst 43ff.) richtig aus, daß die ‘Hathorfrisur’
mit den babylonischen Spirallocken in Zusammenhang zu
bringen ist, und scheidet dabei zwischen einer Frisur ohne
und einer mit Scheitelung. Hinzuzufügen ist, daß möglicher-
weise überhaupt die ägyptische Hathorfrisur, die anscheinend
zuerst im Mittleren Reich auftritt, aus Vorderasien dorthin ge-
kommen ist 3; bei den palästinensischen Beispielen würde also die
Rückkehr einer asiatischen Form in ägyptischer Umwandlung
vorliegen.
Besonders bezeichnend ist die Stellung der Figur in Vorder-
ansicht. Sie aus Ägypten herzuleiten ist unmöglich, da dort
1 Rev. d’Assyriol. XIV 1917, 201 Abb. 103; l’Anthropologie XXXI 1921,
429 Abb. 35 Nr. 1. Vgl. Lagrange, Melanges d’histoire religieuse 302. Über
Beziehungen von Elam zu Syrien-Palaestina vgl. Vincent, Syria V1924,81 ff.
2 W. M. Müller, Asien und Europa 314f.; Greßmann, Altorient. Texte
und Bilder 2 (mir durch die Güte des Verfassers in Korrektur zugänglich)
Nr. 270—2, 276; Pilz a. a. O. 149f. Figuren, die in den symmetrisch aus-
gestreckten Armen Pflanzen oder andere Attribute halten, kommen auch
rein ägyptisch vor, sind aber dann kniend und im Profil, nicht in Vorder-
ansicht gegeben: vgl. Journ. Egypt. Arch. I 1914, 204 Taf. 34 Nr. 3 links;
eb. VIII 1922, 203 Taf. 21 Nr. 13; Carter-Mace, Tut-ench-Amun Taf. 49.
Der Typus in Vorderansicht auf Hyksosskarabäen (JEA. VIII 1922, 203f.;
Newberry, Scarabs Taf. 25 Nr. 6) weist auf fremden Einfluß; vgl. Vincent,
Syria V 1924, 298 Anm. 3.
3 Vgl. H. Schäfer, V. ägypt. Kunst 2 197, 292 Anm. 63.
Zusammenhang bestehen, ist jedenfalls noch nicht greifbar 1.
Auch die Göttin Kadesch zeigt einen fast gleichen Typus; der
Unterschied ist, daß sie nur in der einen Hand eine Lotos-
blüte, in der anderen aber eine Schlange hält. Da wir sie
aber nur in ägyptischen Darstellungen kennen, ist es fraglich,
wie weit diese das Bild in Syrien treu wiedergeben; die Schlange
könnte eine in Ägypten vor sich gegangene Umwandlung
sein, wie denn eine dieser Darstellungen sogar in beiden
Händen Schlangen zeigt 2. Ob auch die Bekleidung eine ägyp-
tische Zutat ist, bleibe dahingestellt; denn auch hierin gibt
eine Darstellung sie nackt; die palästinensischen Beispiele sind
nackt, falls das Gewand nicht etwa ursprünglich nur durch
Farbe gegeben war. Zu beachten ist dabei, daß der genannte
hethitische Typus zwischen gewandeten und nackten Figuren
wechselt. Pilz führt (163f.) im Anschluß an Poulsen (Orient
und frühgriech. Kunst 43ff.) richtig aus, daß die ‘Hathorfrisur’
mit den babylonischen Spirallocken in Zusammenhang zu
bringen ist, und scheidet dabei zwischen einer Frisur ohne
und einer mit Scheitelung. Hinzuzufügen ist, daß möglicher-
weise überhaupt die ägyptische Hathorfrisur, die anscheinend
zuerst im Mittleren Reich auftritt, aus Vorderasien dorthin ge-
kommen ist 3; bei den palästinensischen Beispielen würde also die
Rückkehr einer asiatischen Form in ägyptischer Umwandlung
vorliegen.
Besonders bezeichnend ist die Stellung der Figur in Vorder-
ansicht. Sie aus Ägypten herzuleiten ist unmöglich, da dort
1 Rev. d’Assyriol. XIV 1917, 201 Abb. 103; l’Anthropologie XXXI 1921,
429 Abb. 35 Nr. 1. Vgl. Lagrange, Melanges d’histoire religieuse 302. Über
Beziehungen von Elam zu Syrien-Palaestina vgl. Vincent, Syria V1924,81 ff.
2 W. M. Müller, Asien und Europa 314f.; Greßmann, Altorient. Texte
und Bilder 2 (mir durch die Güte des Verfassers in Korrektur zugänglich)
Nr. 270—2, 276; Pilz a. a. O. 149f. Figuren, die in den symmetrisch aus-
gestreckten Armen Pflanzen oder andere Attribute halten, kommen auch
rein ägyptisch vor, sind aber dann kniend und im Profil, nicht in Vorder-
ansicht gegeben: vgl. Journ. Egypt. Arch. I 1914, 204 Taf. 34 Nr. 3 links;
eb. VIII 1922, 203 Taf. 21 Nr. 13; Carter-Mace, Tut-ench-Amun Taf. 49.
Der Typus in Vorderansicht auf Hyksosskarabäen (JEA. VIII 1922, 203f.;
Newberry, Scarabs Taf. 25 Nr. 6) weist auf fremden Einfluß; vgl. Vincent,
Syria V 1924, 298 Anm. 3.
3 Vgl. H. Schäfer, V. ägypt. Kunst 2 197, 292 Anm. 63.