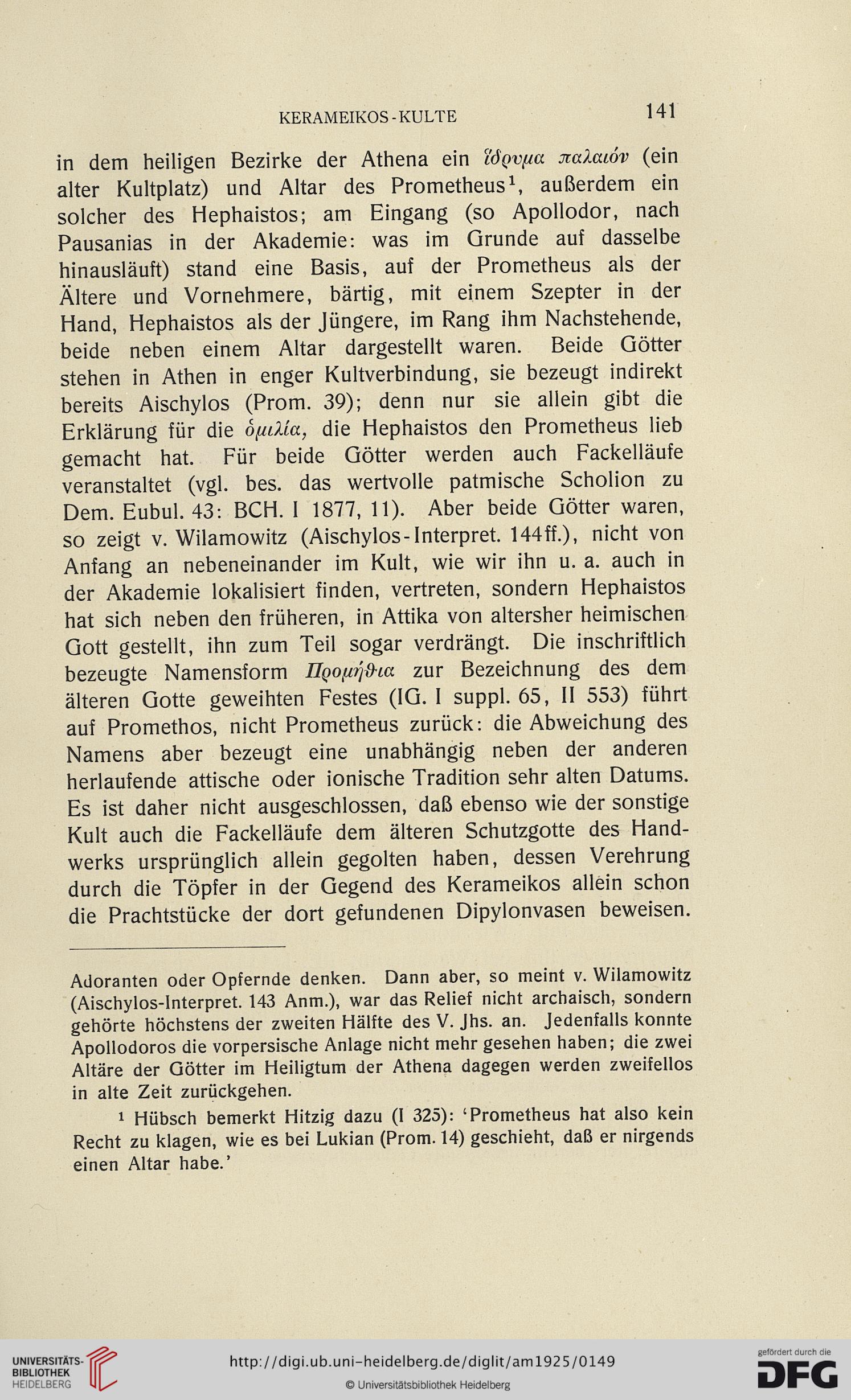KERAMEIKOS - KULTE
141
in dem heiligen Bezirke der Athena ein iÖQv/za jtaXaiöv (ein
alter Kultplatz) und Altar des Prometheus * 1, außerdem ein
solcher des Hephaistos; am Eingang (so Apollodor, nach
Pausanias in der Akademie: was im Qrunde auf dasselbe
hinausläuft) stand eine Basis, auf der Prometheus als der
Ältere und Vornehmere, bärtig, mit einem Szepter in der
Hand, Hephaistos als der Jüngere, im Rang ihm Nachstehende,
beide neben einem Altar dargestellt waren. Beide Götter
stehen in Athen in enger Kultverbindung, sie bezeugt indirekt
bereits Aischylos (Prom. 39); denn nur sie allein gibt die
Erklärung für die opiUa, die Hephaistos den Prometheus lieb
gemacht hat. Fiir beide Qötter werden auch Fackelläufe
veranstaltet (vgl. bes. das wertvolle patmische Scholion zu
Dem. Eubul. 43: BCH. I 1877, 11). Aber beide Götter waren,
so zeigt v. Wilamowitz (Aischylos-Interpret. 144ff.), nicht von
Anfang an nebeneinander im Kult, wie wir ihn u. a. auch in
der Akademie lokalisiert finden, vertreten, sondern Hephaistos
hat sich neben den friiheren, in Attika von altersher heimischen
Gott gestellt, ihn zum Teil sogar verdrängt. Die inschriftlich
bezeugte Namensform IlQo/ü]d-ta zur Bezeichnung des dem
älteren Gotte geweihten Festes (IG. I suppl. 65, II 553) fiihrt
auf Promethos, nicht Prometheus zurück: die Abweichung des
Namens aber bezeugt eine unabhängig neben der anderen
herlaufende attische oder ionische Tradition sehr alten Datums.
Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß ebenso wie der sonstige
Kult auch die Fackelläufe dem älteren Schutzgotte des Hand-
werks urspriinglich allein gegolten haben, dessen Verehrung
durch die Töpfer in der Gegend des Kerameikos allein schon
die Prachtstiicke der dort gefundenen Dipylonvasen beweisen.
Adoranten oder Opfernde denken. Dann aber, so meint v. Wilamowitz
(Aischylos-lnterpret. 143 Anm.), war das Relief nicht archaisch, sondern
gehörte höchstens der zweiten Hälfte des V. Jhs. an. Jedenfalls konnte
Apollodoros die vorpersische Anlage nicht mehr gesehen haben; die zwei
Altäre der Götter im Heiligtum der Athena dagegen werden zweifellos
in alte Zeit zurückgehen.
1 Hübsch bemerkt Hitzig dazu (I 325): ‘Prometheus hat also kein
Recht zu klagen, wie es bei Lukian (Prom. 14) geschieht, daß er nirgends
einen Altar habe.’
141
in dem heiligen Bezirke der Athena ein iÖQv/za jtaXaiöv (ein
alter Kultplatz) und Altar des Prometheus * 1, außerdem ein
solcher des Hephaistos; am Eingang (so Apollodor, nach
Pausanias in der Akademie: was im Qrunde auf dasselbe
hinausläuft) stand eine Basis, auf der Prometheus als der
Ältere und Vornehmere, bärtig, mit einem Szepter in der
Hand, Hephaistos als der Jüngere, im Rang ihm Nachstehende,
beide neben einem Altar dargestellt waren. Beide Götter
stehen in Athen in enger Kultverbindung, sie bezeugt indirekt
bereits Aischylos (Prom. 39); denn nur sie allein gibt die
Erklärung für die opiUa, die Hephaistos den Prometheus lieb
gemacht hat. Fiir beide Qötter werden auch Fackelläufe
veranstaltet (vgl. bes. das wertvolle patmische Scholion zu
Dem. Eubul. 43: BCH. I 1877, 11). Aber beide Götter waren,
so zeigt v. Wilamowitz (Aischylos-Interpret. 144ff.), nicht von
Anfang an nebeneinander im Kult, wie wir ihn u. a. auch in
der Akademie lokalisiert finden, vertreten, sondern Hephaistos
hat sich neben den friiheren, in Attika von altersher heimischen
Gott gestellt, ihn zum Teil sogar verdrängt. Die inschriftlich
bezeugte Namensform IlQo/ü]d-ta zur Bezeichnung des dem
älteren Gotte geweihten Festes (IG. I suppl. 65, II 553) fiihrt
auf Promethos, nicht Prometheus zurück: die Abweichung des
Namens aber bezeugt eine unabhängig neben der anderen
herlaufende attische oder ionische Tradition sehr alten Datums.
Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß ebenso wie der sonstige
Kult auch die Fackelläufe dem älteren Schutzgotte des Hand-
werks urspriinglich allein gegolten haben, dessen Verehrung
durch die Töpfer in der Gegend des Kerameikos allein schon
die Prachtstiicke der dort gefundenen Dipylonvasen beweisen.
Adoranten oder Opfernde denken. Dann aber, so meint v. Wilamowitz
(Aischylos-lnterpret. 143 Anm.), war das Relief nicht archaisch, sondern
gehörte höchstens der zweiten Hälfte des V. Jhs. an. Jedenfalls konnte
Apollodoros die vorpersische Anlage nicht mehr gesehen haben; die zwei
Altäre der Götter im Heiligtum der Athena dagegen werden zweifellos
in alte Zeit zurückgehen.
1 Hübsch bemerkt Hitzig dazu (I 325): ‘Prometheus hat also kein
Recht zu klagen, wie es bei Lukian (Prom. 14) geschieht, daß er nirgends
einen Altar habe.’