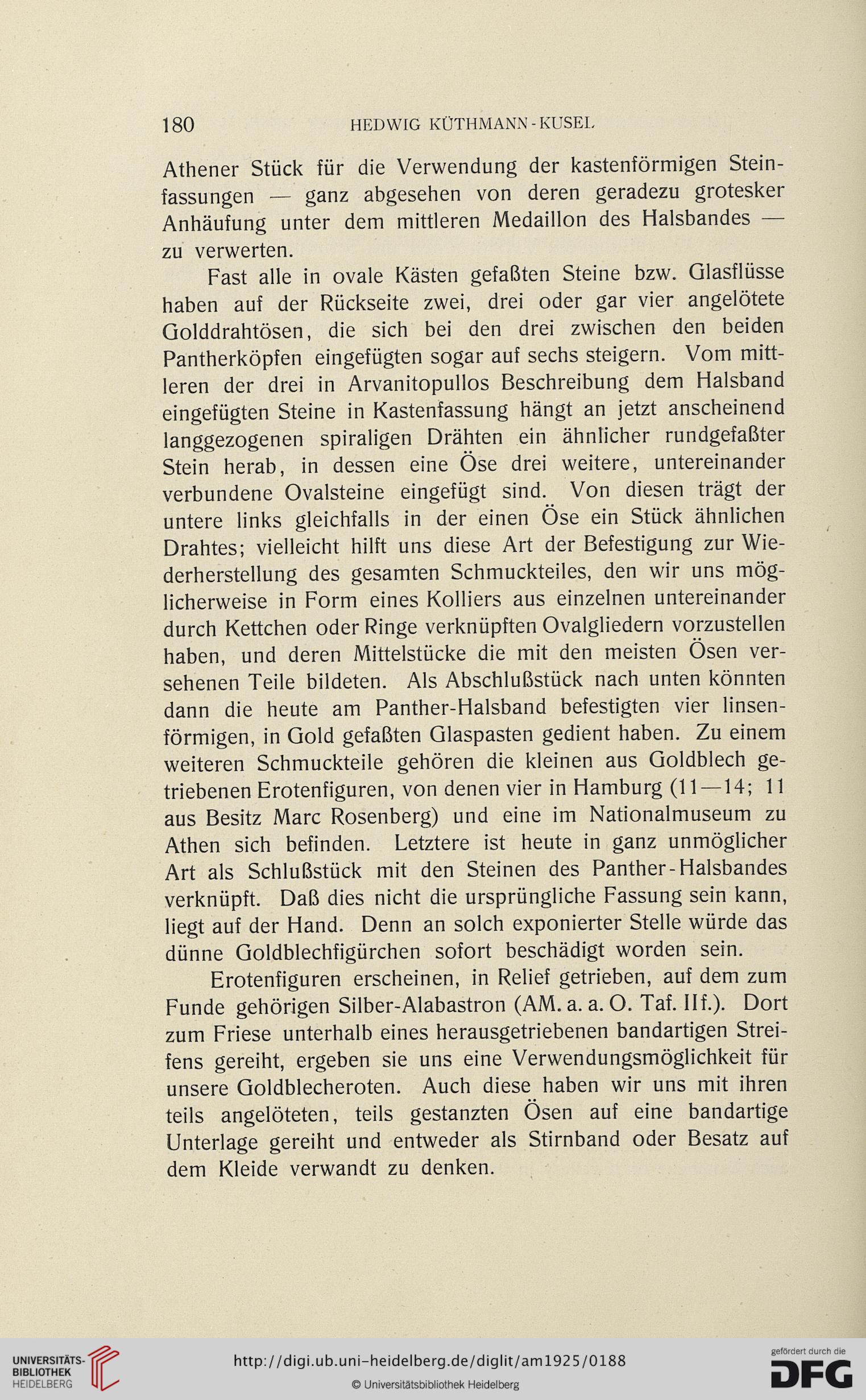180
HEDWIG KÜTHMANN - KUSEL
Athener Stück für die Verwendung der kastenförmigen Stein-
fassungen — ganz abgesehen von deren geradezu grotesker
Anhäufung unter dem mittleren Medaillon des Halsbandes —
zu verwerten.
Fast alle in ovale Kästen gefaßten Steine bzw. Glasfliisse
haben auf der Rückseite zwei, drei oder gar vier angelötete
Golddrahtösen, die sich bei den drei zwischen den beiden
Pantherköpfen eingefügten sogar auf sechs steigern. Vom mitt-
leren der drei in Arvanitopullos Beschreibung dem Halsband
eingefügten Steine in Kastenfassung hängt an jetzt anscheinend
langgezogenen spiraligen Drähten ein ähniicher rundgefaßter
Stein herab, in dessen eine Öse drei weitere, untereinander
verbundene Ovalsteine eingefügt sind. Von diesen trägt der
untere links gleichfalls in der einen Öse ein Stück ähnlichen
Drahtes; vielleicht hilft uns diese Art der Befestigung zur Wie-
derherstellung des gesamten Schmuckteiles, den wir uns mög-
licherweise in Form eines Kolliers aus einzelnen untereinander
durch Kettchen oder Ringe verknüpften Ovalgliedern vorzustellen
haben, und deren Mittelstücke die mit den meisten Ösen ver-
sehenen Teile bildeten. Als Abschlußstück nach unten könnten
dann die heute am Panther-Halsband befestigten vier linsen-
förmigen, in Gold gefaßten Glaspasten gedient haben. Zu einem
weiteren Schmuckteile gehören die kleinen aus Goldblech ge-
triebenen Erotenfiguren, von denen vier in Hamburg (11 —14; 11
aus Besitz Marc Rosenberg) und eine im Nationalmuseum zu
Athen sich befinden. Letztere ist heute in ganz unmöglicher
Art als Schlußstück mit den Steinen des Panther-Halsbandes
verknüpft. Daß dies nicht die ursprüngliche Fassung sein kann,
liegt auf der Hand. Denn an solch exponierter Stelle würde das
dünne Goldblechfigürchen sofort beschädigt worden sein.
Erotenfiguren erscheinen, in Relief getrieben, auf dem zum
Funde gehörigen Silber-Alabastron (AM. a. a. O. Taf. Ilf.). Dort
zum Friese unterhalb eines herausgetriebenen bandartigen Strei-
fens gereiht, ergeben sie uns eine Verwendungsmöglichkeit für
unsere Goldblecheroten. Auch diese haben wir uns mit ihren
teils angelöteten, teils gestanzten Ösen auf eine bandartige
Unterlage gereiht und entweder als Stirnband oder Besatz auf
dem Kleide verwandt zu denken.
HEDWIG KÜTHMANN - KUSEL
Athener Stück für die Verwendung der kastenförmigen Stein-
fassungen — ganz abgesehen von deren geradezu grotesker
Anhäufung unter dem mittleren Medaillon des Halsbandes —
zu verwerten.
Fast alle in ovale Kästen gefaßten Steine bzw. Glasfliisse
haben auf der Rückseite zwei, drei oder gar vier angelötete
Golddrahtösen, die sich bei den drei zwischen den beiden
Pantherköpfen eingefügten sogar auf sechs steigern. Vom mitt-
leren der drei in Arvanitopullos Beschreibung dem Halsband
eingefügten Steine in Kastenfassung hängt an jetzt anscheinend
langgezogenen spiraligen Drähten ein ähniicher rundgefaßter
Stein herab, in dessen eine Öse drei weitere, untereinander
verbundene Ovalsteine eingefügt sind. Von diesen trägt der
untere links gleichfalls in der einen Öse ein Stück ähnlichen
Drahtes; vielleicht hilft uns diese Art der Befestigung zur Wie-
derherstellung des gesamten Schmuckteiles, den wir uns mög-
licherweise in Form eines Kolliers aus einzelnen untereinander
durch Kettchen oder Ringe verknüpften Ovalgliedern vorzustellen
haben, und deren Mittelstücke die mit den meisten Ösen ver-
sehenen Teile bildeten. Als Abschlußstück nach unten könnten
dann die heute am Panther-Halsband befestigten vier linsen-
förmigen, in Gold gefaßten Glaspasten gedient haben. Zu einem
weiteren Schmuckteile gehören die kleinen aus Goldblech ge-
triebenen Erotenfiguren, von denen vier in Hamburg (11 —14; 11
aus Besitz Marc Rosenberg) und eine im Nationalmuseum zu
Athen sich befinden. Letztere ist heute in ganz unmöglicher
Art als Schlußstück mit den Steinen des Panther-Halsbandes
verknüpft. Daß dies nicht die ursprüngliche Fassung sein kann,
liegt auf der Hand. Denn an solch exponierter Stelle würde das
dünne Goldblechfigürchen sofort beschädigt worden sein.
Erotenfiguren erscheinen, in Relief getrieben, auf dem zum
Funde gehörigen Silber-Alabastron (AM. a. a. O. Taf. Ilf.). Dort
zum Friese unterhalb eines herausgetriebenen bandartigen Strei-
fens gereiht, ergeben sie uns eine Verwendungsmöglichkeit für
unsere Goldblecheroten. Auch diese haben wir uns mit ihren
teils angelöteten, teils gestanzten Ösen auf eine bandartige
Unterlage gereiht und entweder als Stirnband oder Besatz auf
dem Kleide verwandt zu denken.