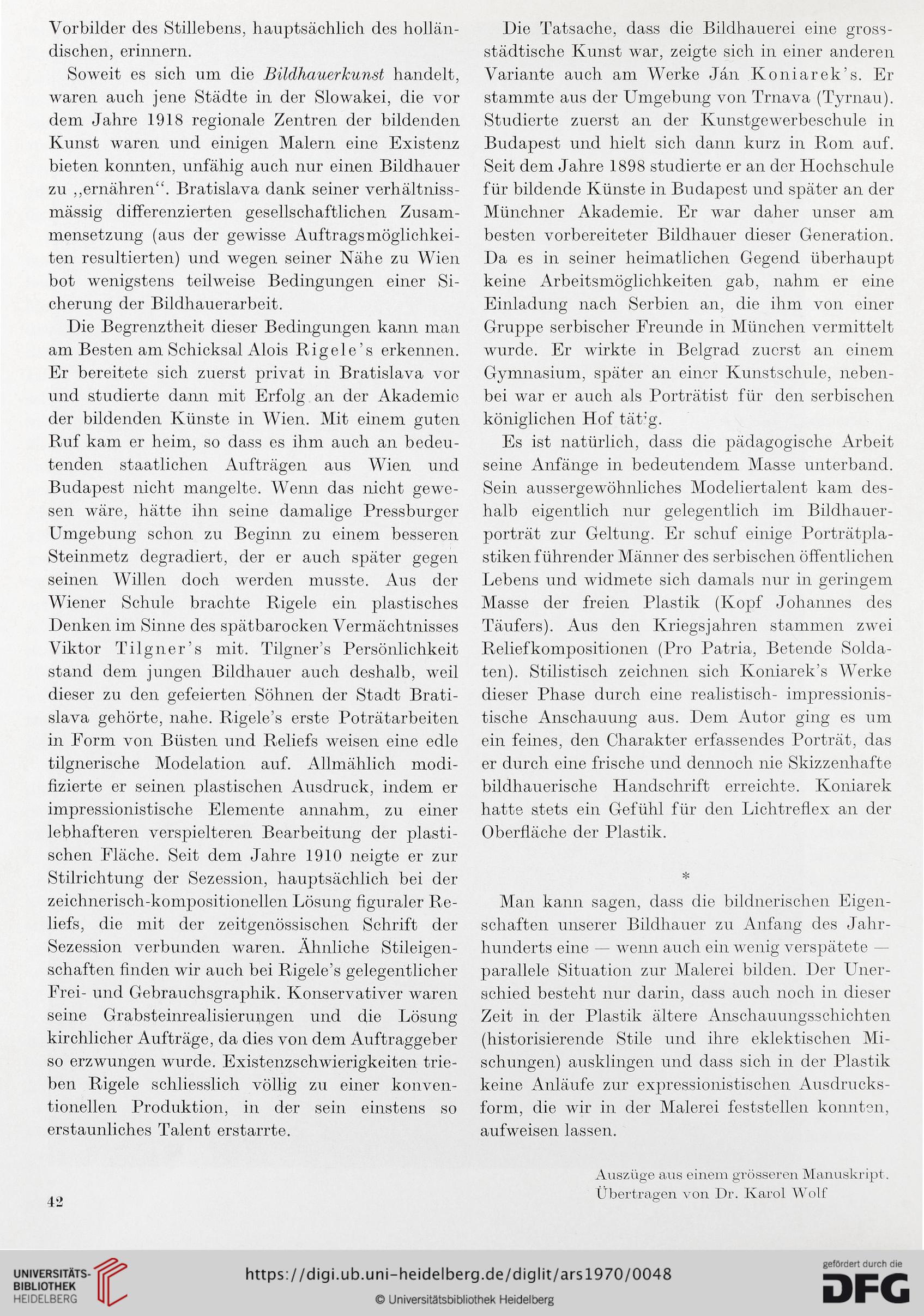Vorbilder des Stillebens, hauptsächlich des hollän-
dischen, erinnern.
Soweit es sich um die Bildhauerkunst handelt,
waren auch jene Städte in der Slowakei, die vor
dem Jahre 1918 regionale Zentren der bildenden
Kunst waren und einigen Malern eine Existenz
bieten konnten, unfähig auch nur einen Bildhauer
zu ,,ernähren“. Bratislava dank seiner verhältniss-
mässig differenzierten gesellschaftlichen Zusam-
mensetzung (aus der gewisse Auftragsmöglichkei-
ten resultierten) und wegen seiner Nähe zu Wien
bot wenigstens teilweise Bedingungen einer Si-
cherung der Bildhauerarbeit.
Die Begrenztheit dieser Bedingungen kann man
am Besten am Schicksal Alois Rigele’s erkennen.
Er bereitete sich zuerst privat in Bratislava vor
und studierte dann mit Erfolg an der Akademie
der bildenden Künste in Wien. Mit einem guten
Ruf kam er heim, so dass es ihm auch an bedeu-
tenden staatlichen Aufträgen aus Wien und
Budapest nicht mangelte. Wenn das nicht gewe-
sen wäre, hätte ihn seine damalige Pressburger
Umgebung schon zu Beginn zu einem besseren
Steinmetz degradiert, der er auch später gegen
seinen Willen doch werden musste. Aus der
Wiener Schule brachte Rigele ein plastisches
Denken im Sinne des spätbarocken Vermächtnisses
Viktor Tilgner’s mit. Tilgner’s Persönlichkeit
stand dem jungen Bildhauer auch deshalb, weil
dieser zu den gefeierten Söhnen der Stadt Brati-
slava gehörte, nahe. Rigele’s erste Poträtarbeiten
in Form von Büsten und Reliefs weisen eine edle
tilgnerische Modelation auf. Allmählich modi-
fizierte er seinen plastischen Ausdruck, indem er
impressionistische Elemente annahm, zu einer
lebhafteren verspielteren Bearbeitung der plasti-
schen Fläche. Seit dem Jahre 1910 neigte er zur
Stilrichtung der Sezession, hauptsächlich bei der
zeichnerisch-kompositionellen Lösung figuraler Re-
liefs, die mit der zeitgenössischen Schrift der
Sezession verbunden waren. Ähnliche Stileigen-
schaften finden wir auch bei Rigele’s gelegentlicher
Frei- und Gebrauchsgraphik. Konservativer waren
seine Grabsteinrealisierungen und die Lösung
kirchlicher Aufträge, da dies von dem Auftraggeber
so erzwungen wurde. Existenzschwierigkeiten trie-
ben Rigele schliesslich völlig zu einer konven-
tionellen Produktion, in der sein einstens so
erstaunliches Talent erstarrte.
42
Die Tatsache, dass die Bildhauerei eine gross-
städtische Kunst war, zeigte sich in einer anderen
Variante auch am Werke Ján Koniarek’s. Er
stammte aus der Umgebung von Trnava (Tyrnau).
Studierte zuerst an der Kunstgewerbeschule in
Budapest und hielt sich dann kurz in Rom auf.
Seit dem Jahre 1898 studierte er an der Hochschule
für bildende Künste in Budapest und später an der
Münchner Akademie. Er war daher unser am
besten vorbereiteter Bildhauer dieser Generation.
Da es in seiner heimatlichen Gegend überhaupt
keine Arbeitsmöglichkeiten gab, nahm er eine
Einladung nach Serbien an, die ihm von einer
Gruppe serbischer Freunde in München vermittelt
wurde. Er wirkte in Belgrad zuerst an einem
Gymnasium, später an einer Kunstschule, neben-
bei war er auch als Porträtist für den serbischen
königlichen Hof tätz'g.
Es ist natürlich, dass die pädagogische Arbeit
seine Anfänge in bedeutendem Masse unterband.
Sein aussergewöhnliches Modeliertalent kam des-
halb eigentlich nur gelegentlich im Bildhauer-
porträt zur Geltung. Er schuf einige Porträtpla-
stiken führender Männer des serbischen öffentlichen
Lebens und widmete sich damals nur in geringem
Masse der freien Plastik (Kopf Johannes des
Täufers). Aus den Kriegs jähren stammen zwei
Reliefkompositionen (Pro Patria, Betende Solda-
ten). Stilistisch zeichnen sich Koniarek’s Werke
dieser Phase durch eine realistisch- impressionis-
tische Anschauung aus. Dem Autor ging es um
ein feines, den Charakter erfassendes Porträt, das
er durch eine frische und dennoch nie Skizzenhafte
bildhauerische Handschrift erreichte. Koniarek
hatte stets ein Gefühl für den Lichtreflex an der
Oberfläche der Plastik.
*
Man kann sagen, dass die bildnerischen Eigen-
schaften unserer Bildhauer zu Anfang des Jahr-
hunderts eine — wenn auch ein wenig verspätete —
parallele Situation zur Malerei bilden. Der Uner-
schied besteht nur darin, dass auch noch in dieser
Zeit in der Plastik ältere Anschauungsschichten
(historisierende Stile und ihre eklektischen Mi-
schungen) ausklingen und dass sich in der Plastik
keine Anläufe zur expressionistischen Ausdrucks-
form, die wir in der Malerei feststellen konnten,
aufweisen lassen.
Auszüge aus einem grösseren Manuskript .
Übertragen von Dr. Karol Wolf
dischen, erinnern.
Soweit es sich um die Bildhauerkunst handelt,
waren auch jene Städte in der Slowakei, die vor
dem Jahre 1918 regionale Zentren der bildenden
Kunst waren und einigen Malern eine Existenz
bieten konnten, unfähig auch nur einen Bildhauer
zu ,,ernähren“. Bratislava dank seiner verhältniss-
mässig differenzierten gesellschaftlichen Zusam-
mensetzung (aus der gewisse Auftragsmöglichkei-
ten resultierten) und wegen seiner Nähe zu Wien
bot wenigstens teilweise Bedingungen einer Si-
cherung der Bildhauerarbeit.
Die Begrenztheit dieser Bedingungen kann man
am Besten am Schicksal Alois Rigele’s erkennen.
Er bereitete sich zuerst privat in Bratislava vor
und studierte dann mit Erfolg an der Akademie
der bildenden Künste in Wien. Mit einem guten
Ruf kam er heim, so dass es ihm auch an bedeu-
tenden staatlichen Aufträgen aus Wien und
Budapest nicht mangelte. Wenn das nicht gewe-
sen wäre, hätte ihn seine damalige Pressburger
Umgebung schon zu Beginn zu einem besseren
Steinmetz degradiert, der er auch später gegen
seinen Willen doch werden musste. Aus der
Wiener Schule brachte Rigele ein plastisches
Denken im Sinne des spätbarocken Vermächtnisses
Viktor Tilgner’s mit. Tilgner’s Persönlichkeit
stand dem jungen Bildhauer auch deshalb, weil
dieser zu den gefeierten Söhnen der Stadt Brati-
slava gehörte, nahe. Rigele’s erste Poträtarbeiten
in Form von Büsten und Reliefs weisen eine edle
tilgnerische Modelation auf. Allmählich modi-
fizierte er seinen plastischen Ausdruck, indem er
impressionistische Elemente annahm, zu einer
lebhafteren verspielteren Bearbeitung der plasti-
schen Fläche. Seit dem Jahre 1910 neigte er zur
Stilrichtung der Sezession, hauptsächlich bei der
zeichnerisch-kompositionellen Lösung figuraler Re-
liefs, die mit der zeitgenössischen Schrift der
Sezession verbunden waren. Ähnliche Stileigen-
schaften finden wir auch bei Rigele’s gelegentlicher
Frei- und Gebrauchsgraphik. Konservativer waren
seine Grabsteinrealisierungen und die Lösung
kirchlicher Aufträge, da dies von dem Auftraggeber
so erzwungen wurde. Existenzschwierigkeiten trie-
ben Rigele schliesslich völlig zu einer konven-
tionellen Produktion, in der sein einstens so
erstaunliches Talent erstarrte.
42
Die Tatsache, dass die Bildhauerei eine gross-
städtische Kunst war, zeigte sich in einer anderen
Variante auch am Werke Ján Koniarek’s. Er
stammte aus der Umgebung von Trnava (Tyrnau).
Studierte zuerst an der Kunstgewerbeschule in
Budapest und hielt sich dann kurz in Rom auf.
Seit dem Jahre 1898 studierte er an der Hochschule
für bildende Künste in Budapest und später an der
Münchner Akademie. Er war daher unser am
besten vorbereiteter Bildhauer dieser Generation.
Da es in seiner heimatlichen Gegend überhaupt
keine Arbeitsmöglichkeiten gab, nahm er eine
Einladung nach Serbien an, die ihm von einer
Gruppe serbischer Freunde in München vermittelt
wurde. Er wirkte in Belgrad zuerst an einem
Gymnasium, später an einer Kunstschule, neben-
bei war er auch als Porträtist für den serbischen
königlichen Hof tätz'g.
Es ist natürlich, dass die pädagogische Arbeit
seine Anfänge in bedeutendem Masse unterband.
Sein aussergewöhnliches Modeliertalent kam des-
halb eigentlich nur gelegentlich im Bildhauer-
porträt zur Geltung. Er schuf einige Porträtpla-
stiken führender Männer des serbischen öffentlichen
Lebens und widmete sich damals nur in geringem
Masse der freien Plastik (Kopf Johannes des
Täufers). Aus den Kriegs jähren stammen zwei
Reliefkompositionen (Pro Patria, Betende Solda-
ten). Stilistisch zeichnen sich Koniarek’s Werke
dieser Phase durch eine realistisch- impressionis-
tische Anschauung aus. Dem Autor ging es um
ein feines, den Charakter erfassendes Porträt, das
er durch eine frische und dennoch nie Skizzenhafte
bildhauerische Handschrift erreichte. Koniarek
hatte stets ein Gefühl für den Lichtreflex an der
Oberfläche der Plastik.
*
Man kann sagen, dass die bildnerischen Eigen-
schaften unserer Bildhauer zu Anfang des Jahr-
hunderts eine — wenn auch ein wenig verspätete —
parallele Situation zur Malerei bilden. Der Uner-
schied besteht nur darin, dass auch noch in dieser
Zeit in der Plastik ältere Anschauungsschichten
(historisierende Stile und ihre eklektischen Mi-
schungen) ausklingen und dass sich in der Plastik
keine Anläufe zur expressionistischen Ausdrucks-
form, die wir in der Malerei feststellen konnten,
aufweisen lassen.
Auszüge aus einem grösseren Manuskript .
Übertragen von Dr. Karol Wolf