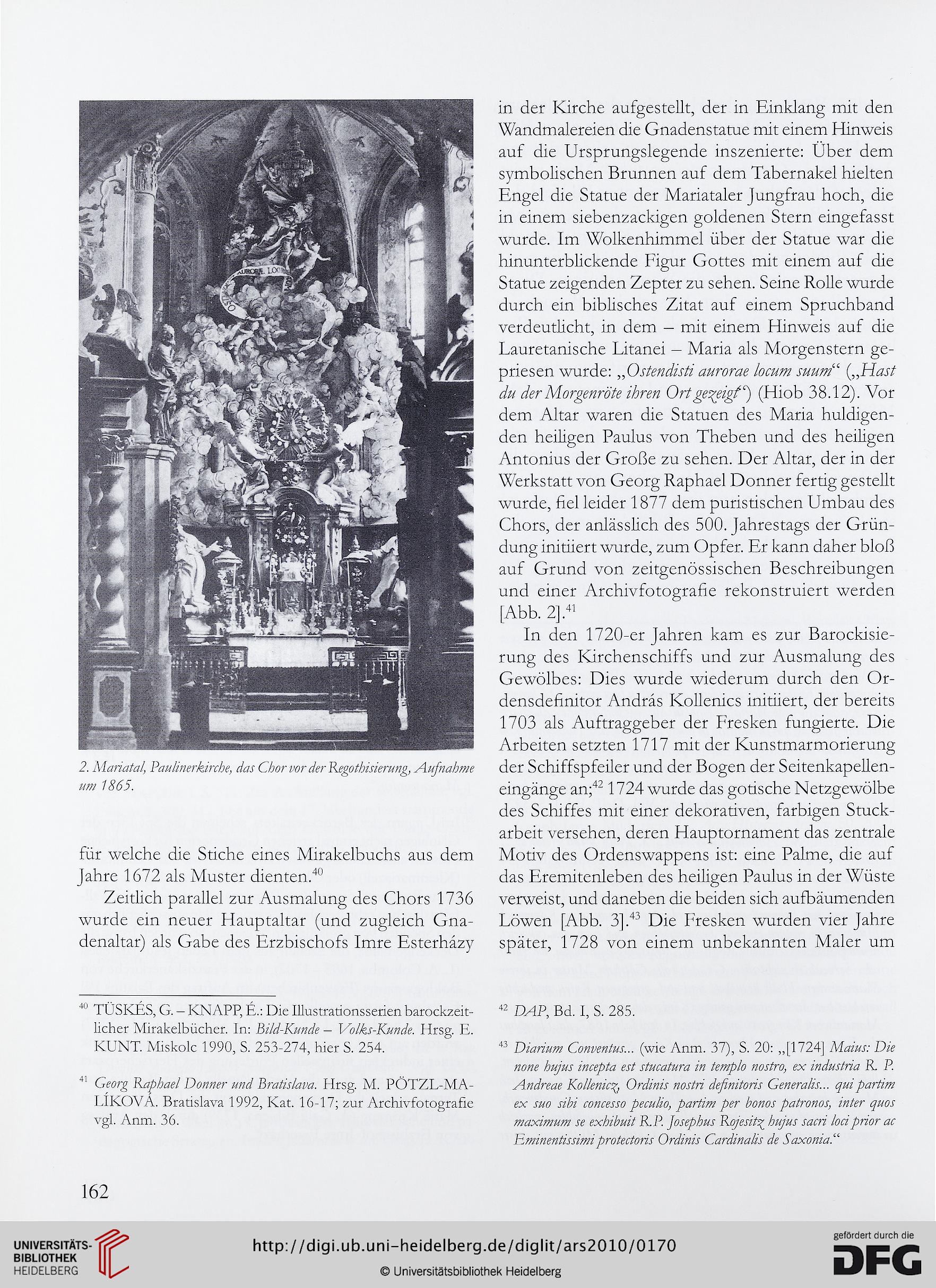%/ar /A67.
für welche die Stiche eines Mirakelbuchs aus dem
Jahre 1672 als Muster dienten/-
Zeitlich parallel zur Ausmalung des Chors 1736
wurde ein neuer Hauptaltar (und zugleich Gna-
denaltar) als Gabe des Erzbischofs Imre Esterhazy
TÜSKÉS, G. — KNAPP, É.: Die Iüustrationssenen barockzeit-
licher Mirakelbücher. In: Bz'AfGwA - Ui/U-XwzA Hrsg. E.
KUNT. Miskolc 1990, S. 253-274, hier S. 254.
^ GKy? RzpAA Hrsg. M. PÖTZL-MA-
LÍKOVA. Bratislava 1992, Kat. 16-17; zur Archivfotograhe
vgl. Anm. 36.
in der Kirche aufgestellt, der in Einklang mit den
Wandmalereien die Gnadenstatue mit einem Hinweis
auf die Ursprungslegende inszenierte: Über dem
symbolischen Brunnen auf dem Tabernakel hielten
Engel die Statue der Mariataler Jungfrau hoch, die
in einem siebenzackigen goldenen Stern eingefasst
wurde. Im Wolkenhimmel über der Statue war die
hinunterblickende Figur Gottes mit einem auf die
Statue zeigenden Zepter zu sehen. Seine Rolle wurde
durch ein biblisches Zitat auf einem Spruchband
verdeutlicht, in dem - mit einem Hinweis auf die
Lauretanische Litanei — Maria als Morgenstern ge-
priesen wurde: („EU#
Of/gyyAgC) (Hiob 38.12). Vor
dem Altar waren die Statuen des Maria huldigen-
den heiligen Paulus von Theben und des heiligen
Antonius der Große zu sehen. Der Altar, der in der
Werkstatt von Georg Raphael Donner fertig gestellt
wurde, fiel leider 1877 dem puristischen Umbau des
Chors, der anlässlich des 500. Jahrestags der Grün-
dung initiiert wurde, zum Opfer. Er kann daher bloß
auf Grund von zeitgenössischen Beschreibungen
und einer Archivfotografie rekonstruiert werden
[Abb. 2]/'
In den 1720-er Jahren kam es zur Barockisie-
rung des Kirchenschiffs und zur Ausmalung des
Gewölbes: Dies wurde wiederum durch den Or-
densdehnitor András Kollenics initiiert, der bereits
1703 als Auftraggeber der Fresken fungierte. Die
Arbeiten setzten 1717 mit der Kunstmarmorierung
der Schiffspfeiler und der Bogen der Seitenkapellen-
eingänge anü 1724 wurde das gotische Netzgewölbe
des Schiffes mit einer dekorativen, farbigen Stück-
arbeit versehen, deren Hauptornament das zentrale
Modv des Ordenswappens ist: eine Palme, die auf
das Eremitenleben des heiligen Paulus in der Wüste
verweist, und daneben die beiden sich aufbäumenden
Löwen [Abb. 3]V Die Fresken wurden vier Jahre
später, 1728 von einem unbekannten Maler um
42 DMP, Bd. I, S. 285.
42 DMA/x? (wie Anm. 37), S. 20: „[1724] Æwv Dzř
Ar<pA? ^ jAzzwAn? 7? P%p<6 ^ AükiïK? R P.
M/Uma? KAKPy, OKAP zzcAn' A/A2A7P G^nAk.. ^zzzpzzPA?
jwo PA' pívzAT, p<%?VA? p^r Azzoj pAw/Mj, zzzPr yzzoj
axA'AzP R. P. Rc/APy IpA PApzwr
E/AwAPiAPprA^AzP OKAP GzKAK'j* A Ww%A."
162