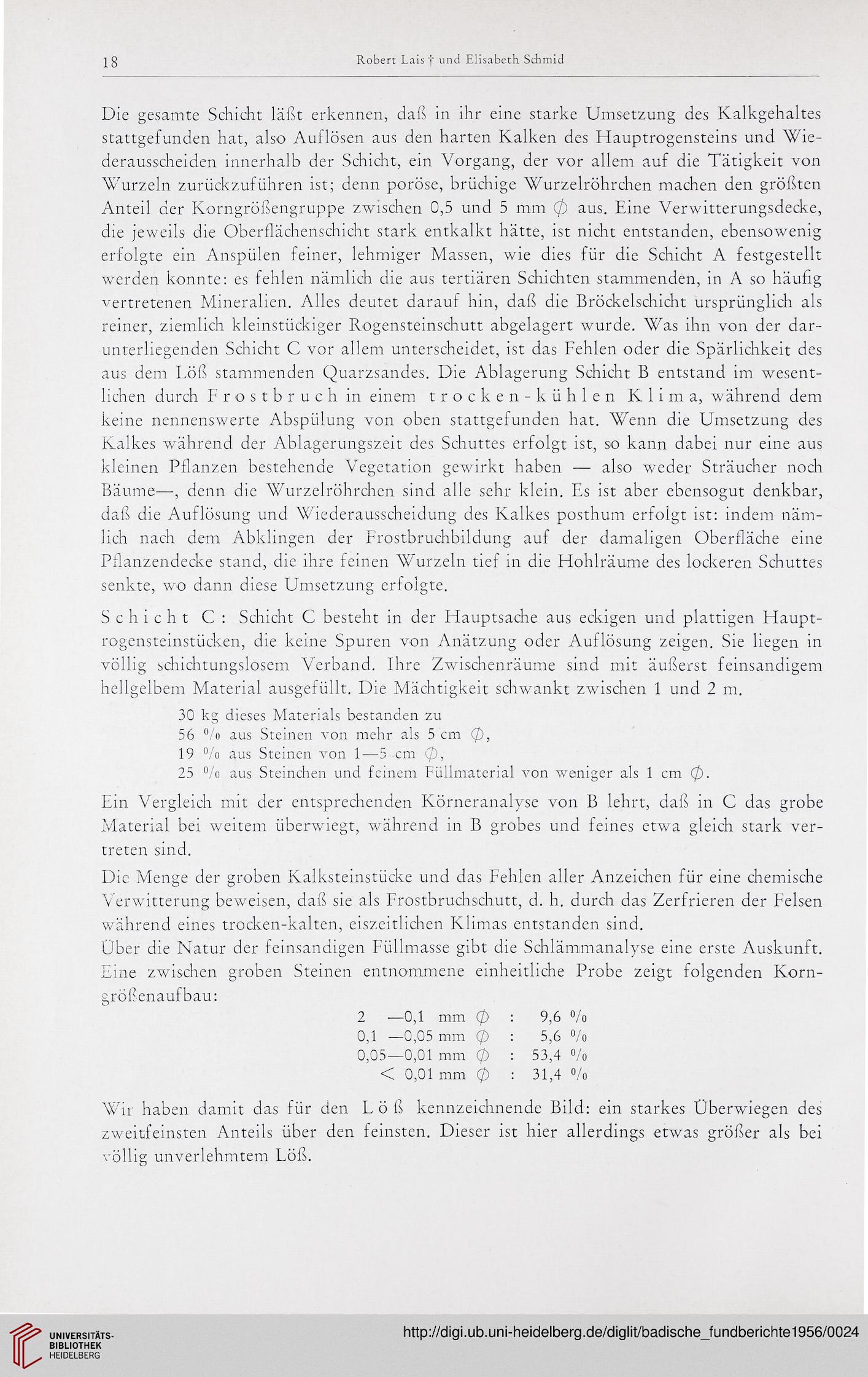Robert Lais f und Elisabeth Schmid
Die gesamte Schicht läßt erkennen, daß in ihr eine starke Umsetzung des Kalkgehaltes
stattgefunden hat, also Auflösen aus den harten Kalken des Hauptrogensteins und Wie-
derausscheiden innerhalb der Schicht, ein Vorgang, der vor allem auf die Tätigkeit von
Wurzeln zurückzuführen ist; denn poröse, brüchige Wurzelröhrchen machen den größten
Anteil der Korngrößengruppe zwischen 0,5 und 5 mm 0 aus. Eine Verwitterungsdecke,
die jeweils die Oberflächenschicht stark entkalkt hätte, ist nicht entstanden, ebensowenig
erfolgte ein Anspülen feiner, lehmiger Massen, wie dies für die Schicht A festgestellt
werden konnte: es fehlen nämlich die aus tertiären Schichten stammenden, in A so häufig
vertretenen Mineralien. Alles deutet darauf hin, daß die Bröckelschicht ursprünglich als
reiner, ziemlich kleinstückiger Rogensteinschutt abgelagert wurde. Was ihn von der dar-
unterliegenden Schicht C vor allem unterscheidet, ist das Fehlen oder die Spärlichkeit des
aus dem Löß stammenden Quarzsandes. Die Ablagerung Schicht B entstand im wesent-
lichen durch F ros t b r u c h in einem trocken-kühlen Klima, während dem
keine nennenswerte Abspülung von oben stattgefunden hat. Wenn die Umsetzung des
Kalkes während der Ablagerungszeit des Schuttes erfolgt ist, so kann dabei nur eine aus
kleinen Pflanzen bestehende Vegetation gewirkt haben — also weder Sträucher noch
Bäume—, denn die Wurzelröhrchen sind alle sehr klein. Es ist aber ebensogut denkbar,
daß die Auflösung und Wiederausscheidung des Kalkes posthum erfolgt ist: indem näm-
lich nach dem Abklingen der Frostbruchbildung auf der damaligen Oberfläche eine
Pflanzendecke stand, die ihre feinen Wurzeln tief in die Hohlräume des lockeren Schuttes
senkte, wo dann diese Umsetzung erfolgte.
Schicht C : Schicht C besteht in der Hauptsache aus eckigen und plattigen Haupt-
rogensteinstücken, die keine Spuren von Anätzung oder Auflösung zeigen. Sie liegen in
völlig schichtungslosem Verband. Ihre Zwischenräume sind mit äußerst feinsandigem
hellgelbem Material ausgefüllt. Die Mächtigkeit schwankt zwischen 1 und 2 m.
30 kg dieses Materials bestanden zu
56 °/o aus Steinen von mehr als 5 cm 0,
19 °/o aus Steinen von 1—5 -cm 0,
25 °/o aus Steinchen und feinem Füllmaterial von weniger als 1 cm 0.
Ein Vergleich mit der entsprechenden Körneranalyse von B lehrt, daß in C das grobe
Material bei weitem überwiegt, während in B grobes und feines etwa gleich stark ver-
treten sind.
Die Menge der groben Kalksteinstücke und das Fehlen aller Anzeichen für eine chemische
Verwitterung beweisen, daß sie als Frostbruchschutt, d. h. durch das Zerfrieren der Felsen
während eines trocken-kalten, eiszeitlichen Klimas entstanden sind.
Über die Natur der feinsandigen Füllmasse gibt die Schlämmanalyse eine erste Auskunft.
Eine zwischen groben Steinen entnommene einheitliche Probe zeigt folgenden Korn¬
größenaufbau:
2 —0,1 mm
0,1 —0,05 mm
0,05—0,01 mm
< 0,01 mm
0
9,6 o/o
0
5,6 »/o
0
53,4 °/o
0
31,4 %
Wir haben damit das für den Löß kennzeichnende Bild: ein starkes Überwiegen des
zweitfeinsten Anteils über den feinsten. Dieser ist hier allerdings etwas größer als bei
völlig unverlehmtem Löß.
Die gesamte Schicht läßt erkennen, daß in ihr eine starke Umsetzung des Kalkgehaltes
stattgefunden hat, also Auflösen aus den harten Kalken des Hauptrogensteins und Wie-
derausscheiden innerhalb der Schicht, ein Vorgang, der vor allem auf die Tätigkeit von
Wurzeln zurückzuführen ist; denn poröse, brüchige Wurzelröhrchen machen den größten
Anteil der Korngrößengruppe zwischen 0,5 und 5 mm 0 aus. Eine Verwitterungsdecke,
die jeweils die Oberflächenschicht stark entkalkt hätte, ist nicht entstanden, ebensowenig
erfolgte ein Anspülen feiner, lehmiger Massen, wie dies für die Schicht A festgestellt
werden konnte: es fehlen nämlich die aus tertiären Schichten stammenden, in A so häufig
vertretenen Mineralien. Alles deutet darauf hin, daß die Bröckelschicht ursprünglich als
reiner, ziemlich kleinstückiger Rogensteinschutt abgelagert wurde. Was ihn von der dar-
unterliegenden Schicht C vor allem unterscheidet, ist das Fehlen oder die Spärlichkeit des
aus dem Löß stammenden Quarzsandes. Die Ablagerung Schicht B entstand im wesent-
lichen durch F ros t b r u c h in einem trocken-kühlen Klima, während dem
keine nennenswerte Abspülung von oben stattgefunden hat. Wenn die Umsetzung des
Kalkes während der Ablagerungszeit des Schuttes erfolgt ist, so kann dabei nur eine aus
kleinen Pflanzen bestehende Vegetation gewirkt haben — also weder Sträucher noch
Bäume—, denn die Wurzelröhrchen sind alle sehr klein. Es ist aber ebensogut denkbar,
daß die Auflösung und Wiederausscheidung des Kalkes posthum erfolgt ist: indem näm-
lich nach dem Abklingen der Frostbruchbildung auf der damaligen Oberfläche eine
Pflanzendecke stand, die ihre feinen Wurzeln tief in die Hohlräume des lockeren Schuttes
senkte, wo dann diese Umsetzung erfolgte.
Schicht C : Schicht C besteht in der Hauptsache aus eckigen und plattigen Haupt-
rogensteinstücken, die keine Spuren von Anätzung oder Auflösung zeigen. Sie liegen in
völlig schichtungslosem Verband. Ihre Zwischenräume sind mit äußerst feinsandigem
hellgelbem Material ausgefüllt. Die Mächtigkeit schwankt zwischen 1 und 2 m.
30 kg dieses Materials bestanden zu
56 °/o aus Steinen von mehr als 5 cm 0,
19 °/o aus Steinen von 1—5 -cm 0,
25 °/o aus Steinchen und feinem Füllmaterial von weniger als 1 cm 0.
Ein Vergleich mit der entsprechenden Körneranalyse von B lehrt, daß in C das grobe
Material bei weitem überwiegt, während in B grobes und feines etwa gleich stark ver-
treten sind.
Die Menge der groben Kalksteinstücke und das Fehlen aller Anzeichen für eine chemische
Verwitterung beweisen, daß sie als Frostbruchschutt, d. h. durch das Zerfrieren der Felsen
während eines trocken-kalten, eiszeitlichen Klimas entstanden sind.
Über die Natur der feinsandigen Füllmasse gibt die Schlämmanalyse eine erste Auskunft.
Eine zwischen groben Steinen entnommene einheitliche Probe zeigt folgenden Korn¬
größenaufbau:
2 —0,1 mm
0,1 —0,05 mm
0,05—0,01 mm
< 0,01 mm
0
9,6 o/o
0
5,6 »/o
0
53,4 °/o
0
31,4 %
Wir haben damit das für den Löß kennzeichnende Bild: ein starkes Überwiegen des
zweitfeinsten Anteils über den feinsten. Dieser ist hier allerdings etwas größer als bei
völlig unverlehmtem Löß.