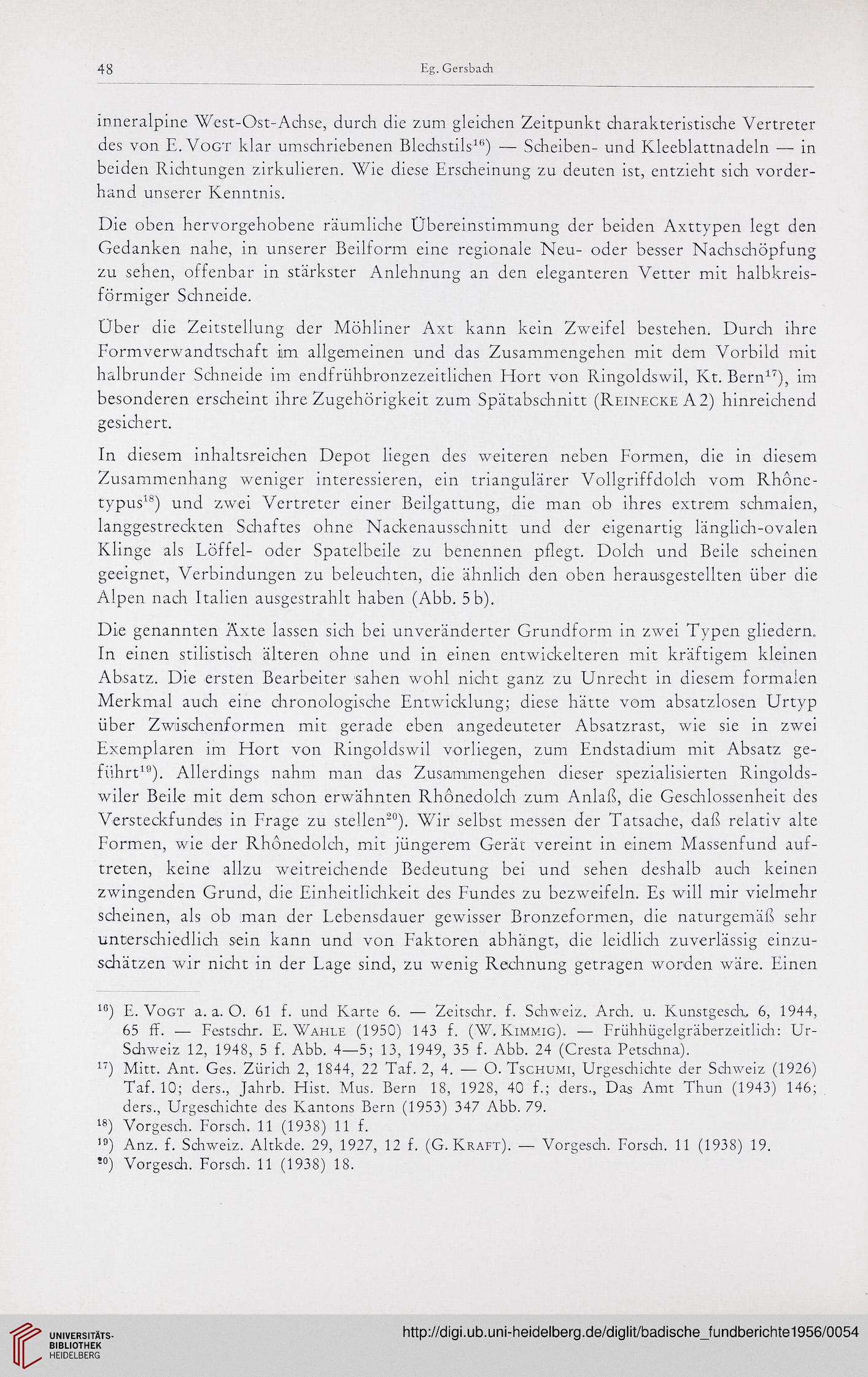48
Eg. Gersbach.
inneralpine West-Ost-Achse, durch die zum gleichen Zeitpunkt charakteristische Vertreter
des von E. Vogt klar umschriebenen Blechstils* * 16) — Scheiben- und Kleeblattnadeln — in
beiden Richtungen zirkulieren. Wie diese Erscheinung zu deuten ist, entzieht sich vorder-
hand unserer Kenntnis.
Die oben hervorgehobene räumliche Übereinstimmung der beiden Axttypen legt den
Gedanken nahe, in unserer Beilform eine regionale Neu- oder besser Nachschöpfung
zu sehen, offenbar in stärkster Anlehnung an den eleganteren Vetter mit halbkreis-
förmiger Schneide.
Über die Zeitstellung der Möhliner Axt kann kein Zweifel bestehen. Durch ihre
Formverwandtschaft im allgemeinen und das Zusammengehen mit dem Vorbild mit
halbrunder Schneide im endfrühbronzezeitlichen Flort von Ringoldswil, Kt. Bern17), im
besonderen erscheint ihre Zugehörigkeit zum Spätabschnitt (Reinecke A 2) hinreichend
gesichert.
In diesem inhaltsreichen Depot liegen des weiteren neben Formen, die in diesem
Zusammenhang weniger interessieren, ein triangulärer Vollgriffdolch vom Rhone-
typus18) und zwei Vertreter einer Beilgattung, die man ob ihres extrem schmalen,
langgestreckten Schaftes ohne Nackenausschnitt und der eigenartig länglich-ovalen
Klinge als Löffel- oder Spatelbeile zu benennen pflegt. Dolch und Beile scheinen
geeignet, Verbindungen zu beleuchten, die ähnlich den oben herausgestellten über die
Alpen nach Italien ausgestrahlt haben (Abb. 5b).
Die genannten Äxte lassen sich bei unveränderter Grundform in zwei Typen gliedern.
In einen stilistisch älteren ohne und in einen entwickelteren mit kräftigem kleinen
Absatz. Die ersten Bearbeiter sahen wohl nicht ganz zu Unrecht in diesem formalen
Merkmal auch eine chronologische Entwicklung; diese hätte vom absatzlosen Urtyp
über Zwischenformen mit gerade eben angedeuteter Absatzrast, wie sie in zwei
Exemplaren im Hort von Ringoldswil vorliegen, zum Endstadium mit Absatz ge-
führt19). Allerdings nahm man das Zusammengehen dieser spezialisierten Ringolds-
wiler Beile mit dem schon erwähnten Rhönedolch zum Anlaß, die Geschlossenheit des
Versteckfundes in Frage zu stellen20). Wir selbst messen der Tatsache, daß relativ alte
Formen, wie der Rhönedolch, mit jüngerem Gerät vereint in einem Massenfund auf-
treten, keine allzu weitreichende Bedeutung bei und sehen deshalb auch keinen
zwingenden Grund, die Einheitlichkeit des Fundes zu bezweifeln. Es will mir vielmehr
scheinen, als ob man der Lebensdauer gewisser Bronzeformen, die naturgemäß sehr
unterschiedlich sein kann und von Faktoren abhängt, die leidlich zuverlässig einzu-
schätzen wir nicht in der Lage sind, zu wenig Rechnung getragen worden wäre. Einen
lß) E. Vogt a. a. O. 61 f. und Karte 6. — Zeitschr. f. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 6, 1944,
65 ff. — Festschr. E. Wahle (1950) 143 f. (W. Kimmig). — Frühhügelgräberzeitlich: Ur-
Schweiz 12, 1948, 5 f. Abb. 4—5; 13, 1949, 35 f. Abb. 24 (Cresta Petschna).
17) Mitt. Ant. Ges. Zürich 2, 1844, 22 Taf. 2, 4. — O. Tschumi, Urgeschichte der Schweiz (1926)
Taf. 10; ders., Jahrb. Hist. Mus. Bern 18, 1928, 40 f.; ders., Das Amt Thun (1943) 146;
ders., Urgeschichte des Kantons Bern (1953) 347 Abb. 79.
18) Vorgesch. Forsch. 11 (1938) 11 f.
)9) Anz. f. Schweiz. Altkde. 29, 1927, 12 f. (G. Kraft). — Vorgesch. Forsch. 11 (1938) 19.
so) Vorgesch. Forsch. 11 (1938) 18.
Eg. Gersbach.
inneralpine West-Ost-Achse, durch die zum gleichen Zeitpunkt charakteristische Vertreter
des von E. Vogt klar umschriebenen Blechstils* * 16) — Scheiben- und Kleeblattnadeln — in
beiden Richtungen zirkulieren. Wie diese Erscheinung zu deuten ist, entzieht sich vorder-
hand unserer Kenntnis.
Die oben hervorgehobene räumliche Übereinstimmung der beiden Axttypen legt den
Gedanken nahe, in unserer Beilform eine regionale Neu- oder besser Nachschöpfung
zu sehen, offenbar in stärkster Anlehnung an den eleganteren Vetter mit halbkreis-
förmiger Schneide.
Über die Zeitstellung der Möhliner Axt kann kein Zweifel bestehen. Durch ihre
Formverwandtschaft im allgemeinen und das Zusammengehen mit dem Vorbild mit
halbrunder Schneide im endfrühbronzezeitlichen Flort von Ringoldswil, Kt. Bern17), im
besonderen erscheint ihre Zugehörigkeit zum Spätabschnitt (Reinecke A 2) hinreichend
gesichert.
In diesem inhaltsreichen Depot liegen des weiteren neben Formen, die in diesem
Zusammenhang weniger interessieren, ein triangulärer Vollgriffdolch vom Rhone-
typus18) und zwei Vertreter einer Beilgattung, die man ob ihres extrem schmalen,
langgestreckten Schaftes ohne Nackenausschnitt und der eigenartig länglich-ovalen
Klinge als Löffel- oder Spatelbeile zu benennen pflegt. Dolch und Beile scheinen
geeignet, Verbindungen zu beleuchten, die ähnlich den oben herausgestellten über die
Alpen nach Italien ausgestrahlt haben (Abb. 5b).
Die genannten Äxte lassen sich bei unveränderter Grundform in zwei Typen gliedern.
In einen stilistisch älteren ohne und in einen entwickelteren mit kräftigem kleinen
Absatz. Die ersten Bearbeiter sahen wohl nicht ganz zu Unrecht in diesem formalen
Merkmal auch eine chronologische Entwicklung; diese hätte vom absatzlosen Urtyp
über Zwischenformen mit gerade eben angedeuteter Absatzrast, wie sie in zwei
Exemplaren im Hort von Ringoldswil vorliegen, zum Endstadium mit Absatz ge-
führt19). Allerdings nahm man das Zusammengehen dieser spezialisierten Ringolds-
wiler Beile mit dem schon erwähnten Rhönedolch zum Anlaß, die Geschlossenheit des
Versteckfundes in Frage zu stellen20). Wir selbst messen der Tatsache, daß relativ alte
Formen, wie der Rhönedolch, mit jüngerem Gerät vereint in einem Massenfund auf-
treten, keine allzu weitreichende Bedeutung bei und sehen deshalb auch keinen
zwingenden Grund, die Einheitlichkeit des Fundes zu bezweifeln. Es will mir vielmehr
scheinen, als ob man der Lebensdauer gewisser Bronzeformen, die naturgemäß sehr
unterschiedlich sein kann und von Faktoren abhängt, die leidlich zuverlässig einzu-
schätzen wir nicht in der Lage sind, zu wenig Rechnung getragen worden wäre. Einen
lß) E. Vogt a. a. O. 61 f. und Karte 6. — Zeitschr. f. Schweiz. Arch. u. Kunstgesch. 6, 1944,
65 ff. — Festschr. E. Wahle (1950) 143 f. (W. Kimmig). — Frühhügelgräberzeitlich: Ur-
Schweiz 12, 1948, 5 f. Abb. 4—5; 13, 1949, 35 f. Abb. 24 (Cresta Petschna).
17) Mitt. Ant. Ges. Zürich 2, 1844, 22 Taf. 2, 4. — O. Tschumi, Urgeschichte der Schweiz (1926)
Taf. 10; ders., Jahrb. Hist. Mus. Bern 18, 1928, 40 f.; ders., Das Amt Thun (1943) 146;
ders., Urgeschichte des Kantons Bern (1953) 347 Abb. 79.
18) Vorgesch. Forsch. 11 (1938) 11 f.
)9) Anz. f. Schweiz. Altkde. 29, 1927, 12 f. (G. Kraft). — Vorgesch. Forsch. 11 (1938) 19.
so) Vorgesch. Forsch. 11 (1938) 18.