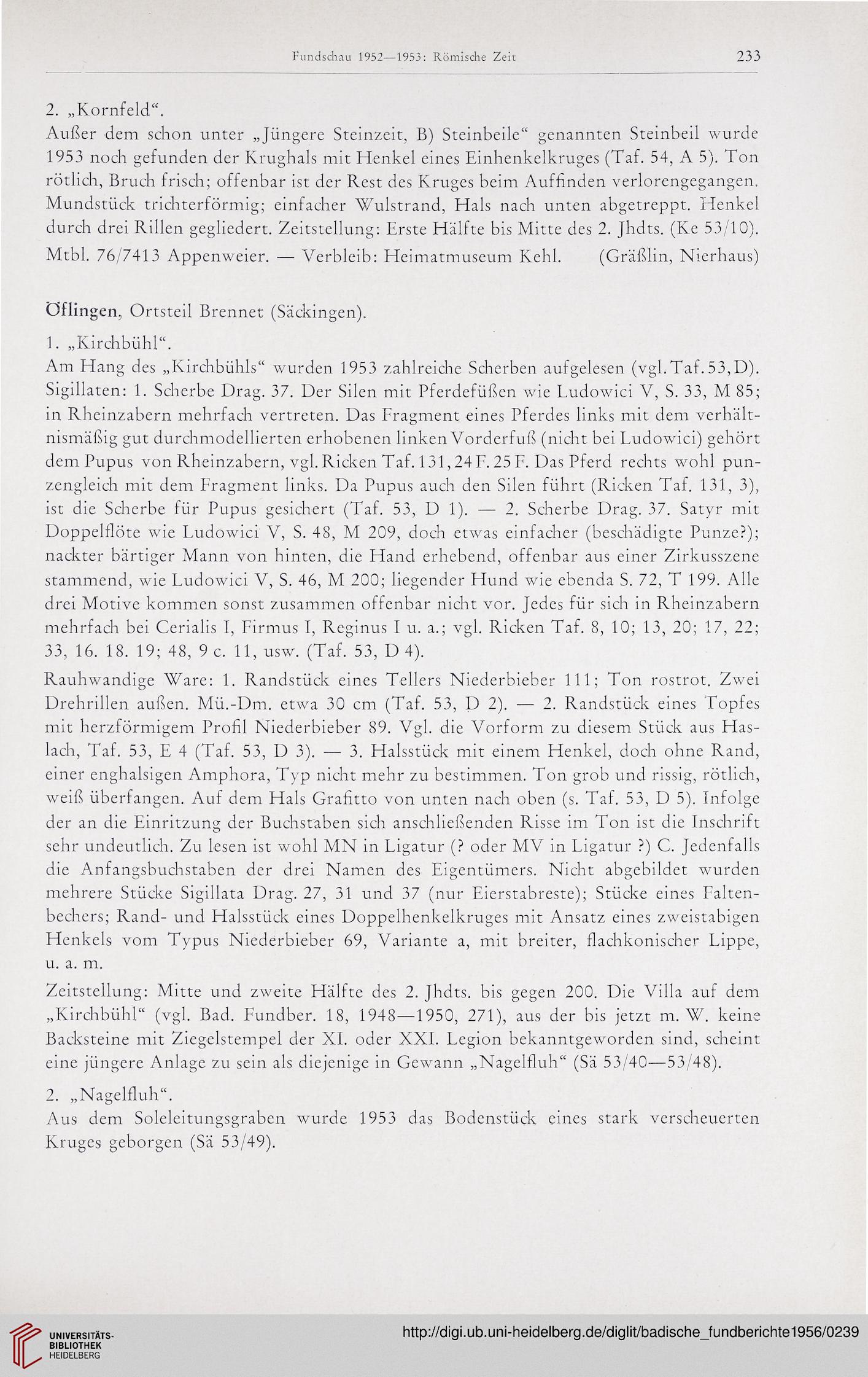Fundschau 1952—1953: Römische Zeit
233
2. „Kornfeld“.
Außer dem schon unter „Jüngere Steinzeit, B) Steinbeile“ genannten Steinbeil wurde
1953 noch gefunden der Krughals mit Henkel eines Einhenkelkruges (Taf. 54, A 5). Ton
rötlich, Bruch frisch; offenbar ist der Rest des Kruges beim Auffinden verlorengegangen.
Mundstück trichterförmig; einfacher Wulstrand, Hals nach unten abgetreppt. Henkel
durch drei Rillen gegliedert. Zeitstellung: Erste Hälfte bis Mitte des 2. Jhdts. (Ke 53/10).
Mtbl. 76/7413 Appenweier. — Verbleib: Heimatmuseum Kehl. (Gräßlin, Nierhaus)
Öflingen, Ortsteil Brennet (Säckingen).
1. „Kirchbühl“.
Am Hang des „Kirchbühls“ wurden 1953 zahlreiche Scherben aufgelesen (vgl.Taf. 53,D).
Sigillaten: 1. Scherbe Drag. 37. Der Silen mit Pferdefüßen wie Ludowici V, S. 33, M 85;
in Rheinzabern mehrfach vertreten. Das Fragment eines Pferdes links mit dem verhält-
nismäßig gut durchmodellierten erhobenen linken Vorderfuß (nicht bei Ludowici) gehört
dem Pupus von Rheinzabern, vgl. Ricken Taf. 131,24 F. 25 F. Das Pferd rechts wohl pun-
zengleich mit dem Fragment links. Da Pupus auch den Silen führt (Ricken Taf. 131, 3),
ist die Scherbe für Pupus gesichert (Taf. 53, D 1). — 2. Scherbe Drag. 37. Satyr mit
Doppelflöte wie Ludowici V, S. 48, M 209, doch etwas einfacher (beschädigte Punze?);
nackter bärtiger Mann von hinten, die Hand erhebend, offenbar aus einer Zirkusszene
stammend, wie Ludowici V, S. 46, M 200; liegender Hund wie ebenda S. 72, T 199. Alle
drei Motive kommen sonst zusammen offenbar nicht vor. Jedes für sich in Rheinzabern
mehrfach bei Cerialis I, Firmus I, Reginus I u. a.; vgl. Ricken Taf. 8, 10; 13, 20; 17, 22;
33, 16. 18. 19; 48, 9 c. 11, usw. (Taf. 53, D 4).
Rauhwandige Ware: 1. Randstück eines Tellers Niederbieber 111; Ton rostrot. Zwei
Drehrillen außen. Mü.-Dm. etwa 30 cm (Taf. 53, D 2). — 2. Randstück eines Topfes
mit herzförmigem Profil Niederbieber 89. Vgl. die Vorform zu diesem Stück aus Has-
lach, Taf. 53, E 4 (Taf. 53, D 3). — 3. Halsstück mit einem Henkel, doch ohne Rand,
einer enghalsigen Amphora, Typ nicht mehr zu bestimmen. Ton grob und rissig, rötlich,
weiß überfangen. Auf dem Hals Grafitto von unten nach oben (s. Taf. 53, D 5). Infolge
der an die Einritzung der Buchstaben sich anschließenden Risse im Ton ist die Inschrift
sehr undeutlich. Zu lesen ist wohl MN in Ligatur (? oder MV in Ligatur ?) C. Jedenfalls
die Anfangsbuchstaben der drei Namen des Eigentümers. Nicht abgebildet wurden
mehrere Stücke Sigillata Drag. 27, 31 und 37 (nur Eierstabreste); Stücke eines Falten-
bechers; Rand- und Halsstück eines Doppelhenkelkruges mit Ansatz eines zweistabigen
Henkels vom Typus Niederbieber 69, Variante a, mit breiter, flachkonischer Lippe,
u. a. m.
Zeitstellung: Mitte und zweite Hälfte des 2. Jhdts. bis gegen 200. Die Villa auf dem
„Kirchbühl“ (vgl. Bad. Fundber. 18, 1948—1950, 271), aus der bis jetzt m. W. keine
Backsteine mit Ziegelstempel der XI. oder XXL Legion bekanntgeworden sind, scheint
eine jüngere Anlage zu sein als diejenige in Gewann „Nagelfluh“ (Sä 53/40—53/48).
2. „Nagelfluh“.
Aus dem Soleleitungsgraben wurde 1953 das Bodenstück eines stark verscheuerten
Kruges geborgen (Sä 53/49).
233
2. „Kornfeld“.
Außer dem schon unter „Jüngere Steinzeit, B) Steinbeile“ genannten Steinbeil wurde
1953 noch gefunden der Krughals mit Henkel eines Einhenkelkruges (Taf. 54, A 5). Ton
rötlich, Bruch frisch; offenbar ist der Rest des Kruges beim Auffinden verlorengegangen.
Mundstück trichterförmig; einfacher Wulstrand, Hals nach unten abgetreppt. Henkel
durch drei Rillen gegliedert. Zeitstellung: Erste Hälfte bis Mitte des 2. Jhdts. (Ke 53/10).
Mtbl. 76/7413 Appenweier. — Verbleib: Heimatmuseum Kehl. (Gräßlin, Nierhaus)
Öflingen, Ortsteil Brennet (Säckingen).
1. „Kirchbühl“.
Am Hang des „Kirchbühls“ wurden 1953 zahlreiche Scherben aufgelesen (vgl.Taf. 53,D).
Sigillaten: 1. Scherbe Drag. 37. Der Silen mit Pferdefüßen wie Ludowici V, S. 33, M 85;
in Rheinzabern mehrfach vertreten. Das Fragment eines Pferdes links mit dem verhält-
nismäßig gut durchmodellierten erhobenen linken Vorderfuß (nicht bei Ludowici) gehört
dem Pupus von Rheinzabern, vgl. Ricken Taf. 131,24 F. 25 F. Das Pferd rechts wohl pun-
zengleich mit dem Fragment links. Da Pupus auch den Silen führt (Ricken Taf. 131, 3),
ist die Scherbe für Pupus gesichert (Taf. 53, D 1). — 2. Scherbe Drag. 37. Satyr mit
Doppelflöte wie Ludowici V, S. 48, M 209, doch etwas einfacher (beschädigte Punze?);
nackter bärtiger Mann von hinten, die Hand erhebend, offenbar aus einer Zirkusszene
stammend, wie Ludowici V, S. 46, M 200; liegender Hund wie ebenda S. 72, T 199. Alle
drei Motive kommen sonst zusammen offenbar nicht vor. Jedes für sich in Rheinzabern
mehrfach bei Cerialis I, Firmus I, Reginus I u. a.; vgl. Ricken Taf. 8, 10; 13, 20; 17, 22;
33, 16. 18. 19; 48, 9 c. 11, usw. (Taf. 53, D 4).
Rauhwandige Ware: 1. Randstück eines Tellers Niederbieber 111; Ton rostrot. Zwei
Drehrillen außen. Mü.-Dm. etwa 30 cm (Taf. 53, D 2). — 2. Randstück eines Topfes
mit herzförmigem Profil Niederbieber 89. Vgl. die Vorform zu diesem Stück aus Has-
lach, Taf. 53, E 4 (Taf. 53, D 3). — 3. Halsstück mit einem Henkel, doch ohne Rand,
einer enghalsigen Amphora, Typ nicht mehr zu bestimmen. Ton grob und rissig, rötlich,
weiß überfangen. Auf dem Hals Grafitto von unten nach oben (s. Taf. 53, D 5). Infolge
der an die Einritzung der Buchstaben sich anschließenden Risse im Ton ist die Inschrift
sehr undeutlich. Zu lesen ist wohl MN in Ligatur (? oder MV in Ligatur ?) C. Jedenfalls
die Anfangsbuchstaben der drei Namen des Eigentümers. Nicht abgebildet wurden
mehrere Stücke Sigillata Drag. 27, 31 und 37 (nur Eierstabreste); Stücke eines Falten-
bechers; Rand- und Halsstück eines Doppelhenkelkruges mit Ansatz eines zweistabigen
Henkels vom Typus Niederbieber 69, Variante a, mit breiter, flachkonischer Lippe,
u. a. m.
Zeitstellung: Mitte und zweite Hälfte des 2. Jhdts. bis gegen 200. Die Villa auf dem
„Kirchbühl“ (vgl. Bad. Fundber. 18, 1948—1950, 271), aus der bis jetzt m. W. keine
Backsteine mit Ziegelstempel der XI. oder XXL Legion bekanntgeworden sind, scheint
eine jüngere Anlage zu sein als diejenige in Gewann „Nagelfluh“ (Sä 53/40—53/48).
2. „Nagelfluh“.
Aus dem Soleleitungsgraben wurde 1953 das Bodenstück eines stark verscheuerten
Kruges geborgen (Sä 53/49).