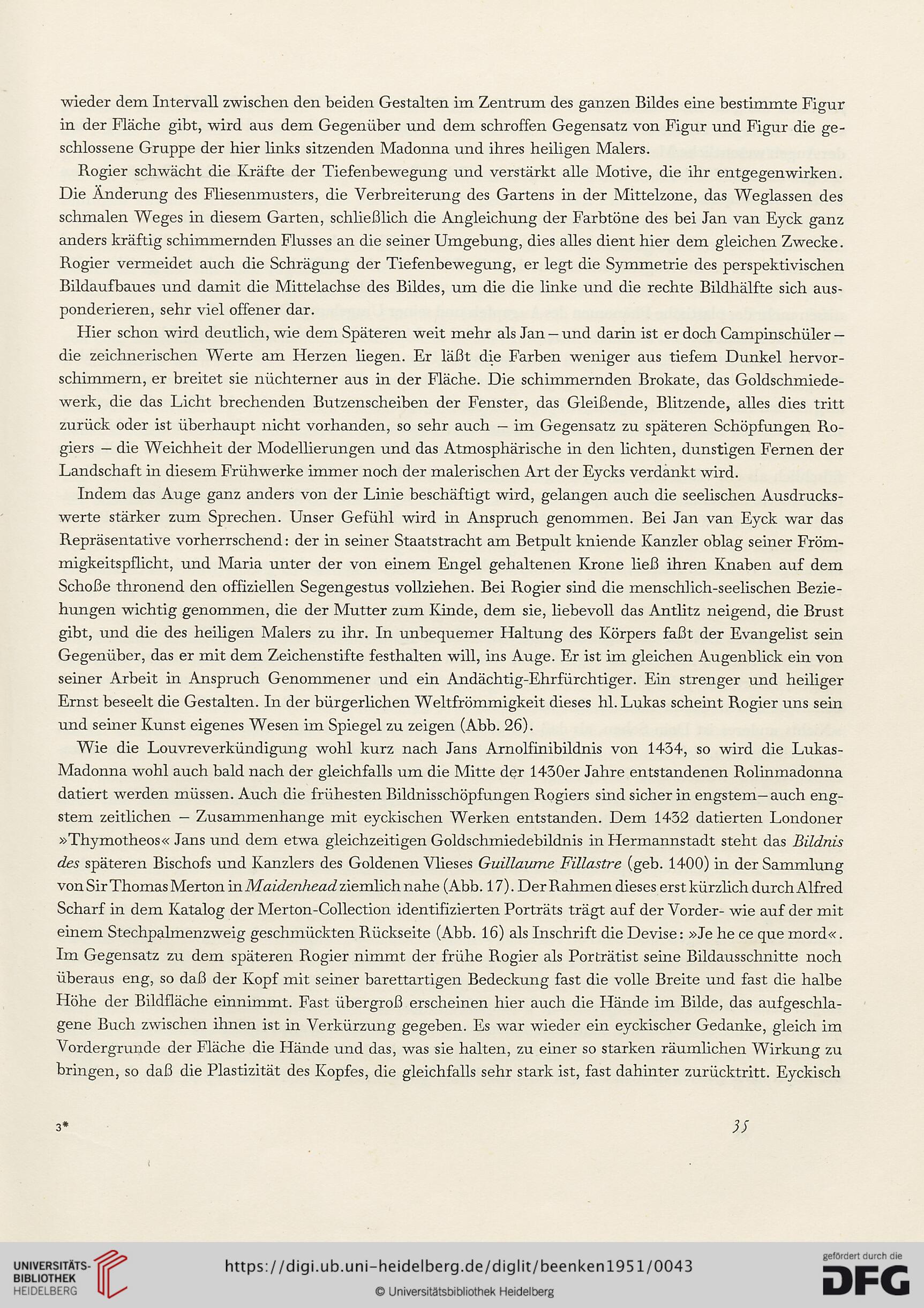wieder dem Intervall zwischen den beiden Gestalten im Zentrum des ganzen Bildes eine bestimmte Figur
in der Fläche gibt, wird aus dem Gegenüber und dem schroffen Gegensatz von Figur und Figur die ge-
schlossene Gruppe der hier links sitzenden Madonna und ihres heiligen Malers.
Rogier schwächt die Kräfte der Tiefenbewegung und verstärkt alle Motive, die ihr entgegenwirken.
Die Änderung des Fliesenmusters, die Verbreiterung des Gartens in der Mittelzone, das Weglassen des
schmalen Weges in diesem Garten, schließlich die Angleichung der Farbtöne des bei Jan van Eyck ganz
anders kräftig schimmernden Flusses an die seiner Umgebung, dies alles dient hier dem gleichen Zwecke.
Rogier vermeidet auch die Schrägung der Tiefenbewegung, er legt die Symmetrie des perspektivischen
Bildaufbaues und damit die Mittelachse des Bildes, um die die linke und die rechte Bildhälfte sich aus-
ponderieren, sehr viel offener dar.
Hier schon wird deutlich, wie dem Späteren weit mehr als Jan — und darin ist er doch Campinschüler —
die zeichnerischen Werte am Herzen liegen. Er läßt die Farben weniger aus tiefem Dunkel hervor-
schimmern, er breitet sie nüchterner aus in der Fläche. Die schimmernden Brokate, das Goldschmiede-
werk, die das Licht brechenden Butzenscheiben der Fenster, das Gleißende, Blitzende, alles dies tritt
zurück oder ist überhaupt nicht vorhanden, so sehr auch — im Gegensatz zu späteren Schöpfungen Ro-
giers — die Weichheit der Modellierungen und das Atmosphärische in den lichten, dunstigen Fernen der
Landschaft in diesem Frühwerke immer noch der malerischen Art der Eycks verdankt wird.
Indem das Auge ganz anders von der Linie beschäftigt wird, gelangen auch die seelischen Ausdrucks-
werte stärker zum Sprechen. Unser Gefühl wird in Anspruch genommen. Bei Jan van Eyck war das
Repräsentative vorherrschend: der in seiner Staatstracht am Betpult kniende Kanzler oblag seiner Fröm-
migkeitspflicht, und Maria unter der von einem Engel gehaltenen Krone ließ ihren Knaben auf dem
Schoße thronend den offiziellen Segengestus vollziehen. Bei Rogier sind die menschlich-seelischen Bezie-
hungen wichtig genommen, die der Mutter zum Kinde, dem sie, liebevoll das Antlitz neigend, die Brust
gibt, und die des heiligen Malers zu ihr. In unbequemer Haltung des Körpers faßt der Evangelist sein
Gegenüber, das er mit dem Zeichenstifte festhalten will, ins Auge. Er ist im gleichen Augenblick ein von
seiner Arbeit in Anspruch Genommener und ein Andächtig-Ehrfürchtiger. Ein strenger und heiliger
Ernst beseelt die Gestalten. In der bürgerlichen Weltfrömmigkeit dieses hl. Lukas scheint Rogier uns sein
und seiner Kunst eigenes Wesen im Spiegel zu zeigen (Abb. 26).
Wie die Louvreverkündigung wohl kurz nach Jans Arnolfinibildnis von 1434, so wird die Lukas-
Madonna wohl auch bald nach der gleichfalls um die Mitte der 1430er Jahre entstandenen Rolinmadonna
datiert werden müssen. Auch die frühesten Bildnisschöpfungen Rogiers sind sicher in engstem-auch eng-
stem zeitlichen — Zusammenhänge mit eyckischen Werken entstanden. Dem 1432 datierten Londoner
»Thymotheos« Jans und dem etwa gleichzeitigen Goldschmiedebildnis in Hermannstadt steht das Bildnis
des späteren Bischofs und Kanzlers des Goldenen Vlieses Guillaume Fillastre (geb. 1400) in der Sammlung
von Sir Thomas Merton in Maidenhead ziemlich nahe (Abb. 17). Der Rahmen dieses erst kürzlich durch Alfred
Scharf in dem Katalog der Merton-Collection identifizierten Porträts trägt auf der Vorder- wie auf der mit
einem Stechpalmenzweig geschmückten Rückseite (Abb. 16) als Inschrift die Devise: »Je he ce que mord«.
Im Gegensatz zu dem späteren Rogier nimmt der frühe Rogier als Porträtist seine Bildausschnitte noch
überaus eng, so daß der Kopf mit seiner barettartigen Bedeckung fast die volle Breite und fast die halbe
Höhe der Bildfläche einnimmt. Fast übergroß erscheinen hier auch die Hände im Bilde, das aufgeschla-
gene Buch zwischen ihnen ist in Verkürzung gegeben. Es war wieder ein eyckischer Gedanke, gleich im
Vordergründe der Fläche die Hände und das, was sie halten, zu einer so starken räumlichen Wirkung zu
bringen, so daß die Plastizität des Kopfes, die gleichfalls sehr stark ist, fast dahinter zurücktritt. Eyckisch
51
3'
in der Fläche gibt, wird aus dem Gegenüber und dem schroffen Gegensatz von Figur und Figur die ge-
schlossene Gruppe der hier links sitzenden Madonna und ihres heiligen Malers.
Rogier schwächt die Kräfte der Tiefenbewegung und verstärkt alle Motive, die ihr entgegenwirken.
Die Änderung des Fliesenmusters, die Verbreiterung des Gartens in der Mittelzone, das Weglassen des
schmalen Weges in diesem Garten, schließlich die Angleichung der Farbtöne des bei Jan van Eyck ganz
anders kräftig schimmernden Flusses an die seiner Umgebung, dies alles dient hier dem gleichen Zwecke.
Rogier vermeidet auch die Schrägung der Tiefenbewegung, er legt die Symmetrie des perspektivischen
Bildaufbaues und damit die Mittelachse des Bildes, um die die linke und die rechte Bildhälfte sich aus-
ponderieren, sehr viel offener dar.
Hier schon wird deutlich, wie dem Späteren weit mehr als Jan — und darin ist er doch Campinschüler —
die zeichnerischen Werte am Herzen liegen. Er läßt die Farben weniger aus tiefem Dunkel hervor-
schimmern, er breitet sie nüchterner aus in der Fläche. Die schimmernden Brokate, das Goldschmiede-
werk, die das Licht brechenden Butzenscheiben der Fenster, das Gleißende, Blitzende, alles dies tritt
zurück oder ist überhaupt nicht vorhanden, so sehr auch — im Gegensatz zu späteren Schöpfungen Ro-
giers — die Weichheit der Modellierungen und das Atmosphärische in den lichten, dunstigen Fernen der
Landschaft in diesem Frühwerke immer noch der malerischen Art der Eycks verdankt wird.
Indem das Auge ganz anders von der Linie beschäftigt wird, gelangen auch die seelischen Ausdrucks-
werte stärker zum Sprechen. Unser Gefühl wird in Anspruch genommen. Bei Jan van Eyck war das
Repräsentative vorherrschend: der in seiner Staatstracht am Betpult kniende Kanzler oblag seiner Fröm-
migkeitspflicht, und Maria unter der von einem Engel gehaltenen Krone ließ ihren Knaben auf dem
Schoße thronend den offiziellen Segengestus vollziehen. Bei Rogier sind die menschlich-seelischen Bezie-
hungen wichtig genommen, die der Mutter zum Kinde, dem sie, liebevoll das Antlitz neigend, die Brust
gibt, und die des heiligen Malers zu ihr. In unbequemer Haltung des Körpers faßt der Evangelist sein
Gegenüber, das er mit dem Zeichenstifte festhalten will, ins Auge. Er ist im gleichen Augenblick ein von
seiner Arbeit in Anspruch Genommener und ein Andächtig-Ehrfürchtiger. Ein strenger und heiliger
Ernst beseelt die Gestalten. In der bürgerlichen Weltfrömmigkeit dieses hl. Lukas scheint Rogier uns sein
und seiner Kunst eigenes Wesen im Spiegel zu zeigen (Abb. 26).
Wie die Louvreverkündigung wohl kurz nach Jans Arnolfinibildnis von 1434, so wird die Lukas-
Madonna wohl auch bald nach der gleichfalls um die Mitte der 1430er Jahre entstandenen Rolinmadonna
datiert werden müssen. Auch die frühesten Bildnisschöpfungen Rogiers sind sicher in engstem-auch eng-
stem zeitlichen — Zusammenhänge mit eyckischen Werken entstanden. Dem 1432 datierten Londoner
»Thymotheos« Jans und dem etwa gleichzeitigen Goldschmiedebildnis in Hermannstadt steht das Bildnis
des späteren Bischofs und Kanzlers des Goldenen Vlieses Guillaume Fillastre (geb. 1400) in der Sammlung
von Sir Thomas Merton in Maidenhead ziemlich nahe (Abb. 17). Der Rahmen dieses erst kürzlich durch Alfred
Scharf in dem Katalog der Merton-Collection identifizierten Porträts trägt auf der Vorder- wie auf der mit
einem Stechpalmenzweig geschmückten Rückseite (Abb. 16) als Inschrift die Devise: »Je he ce que mord«.
Im Gegensatz zu dem späteren Rogier nimmt der frühe Rogier als Porträtist seine Bildausschnitte noch
überaus eng, so daß der Kopf mit seiner barettartigen Bedeckung fast die volle Breite und fast die halbe
Höhe der Bildfläche einnimmt. Fast übergroß erscheinen hier auch die Hände im Bilde, das aufgeschla-
gene Buch zwischen ihnen ist in Verkürzung gegeben. Es war wieder ein eyckischer Gedanke, gleich im
Vordergründe der Fläche die Hände und das, was sie halten, zu einer so starken räumlichen Wirkung zu
bringen, so daß die Plastizität des Kopfes, die gleichfalls sehr stark ist, fast dahinter zurücktritt. Eyckisch
51
3'