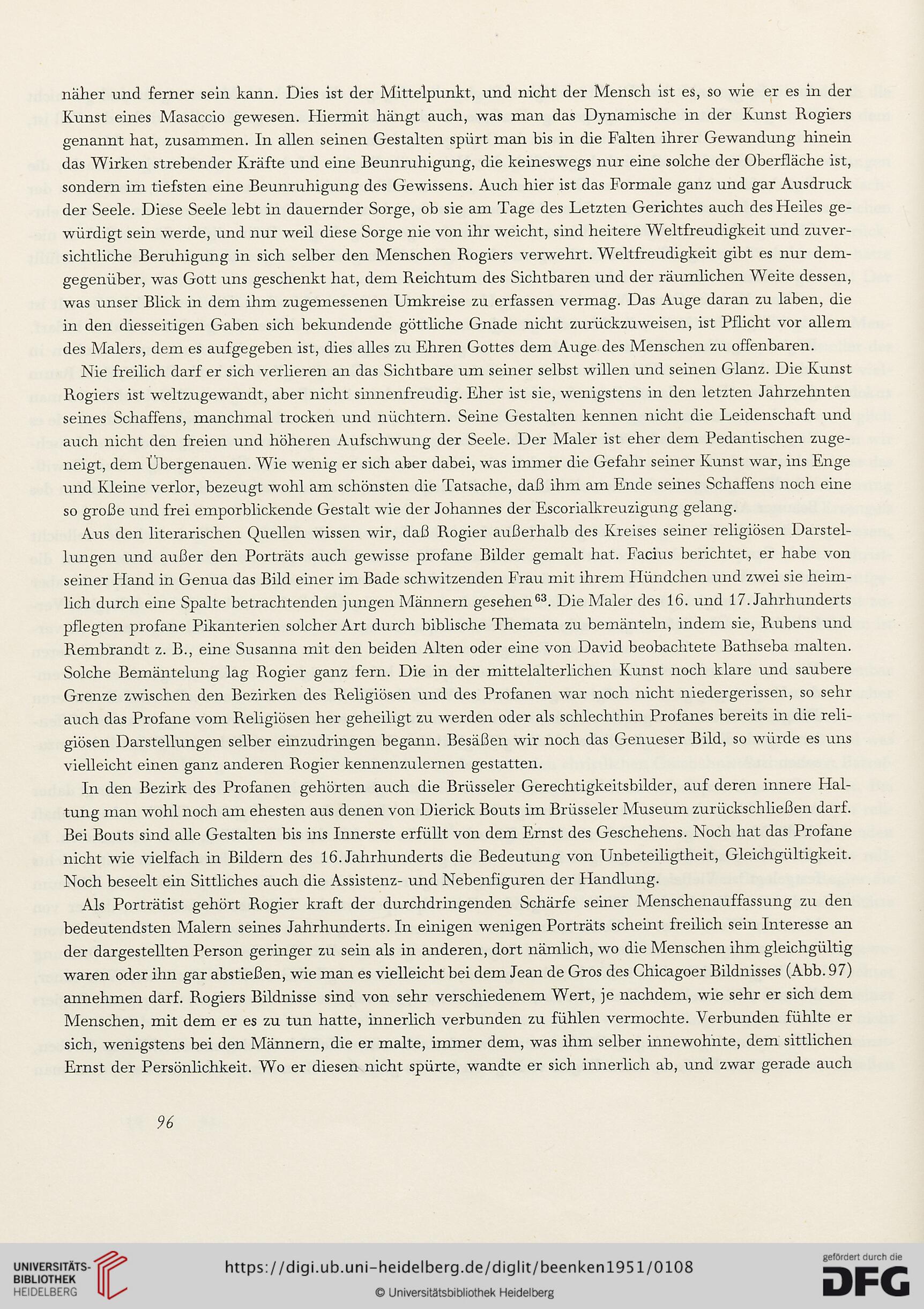näher und ferner sein kann. Dies ist der Mittelpunkt, und nicht der Mensch ist es, so wie er es in der
Kunst eines Masaccio gewesen. Hiermit hängt auch, was man das Dynamische in der Kunst Rogiers
genannt hat, zusammen. In allen seinen Gestalten spürt man bis in die Falten ihrer Gewandung hinein
das Wirken strebender Kräfte und eine Beunruhigung, die keineswegs nur eine solche der Oberfläche ist,
sondern im tiefsten eine Beunruhigung des Gewissens. Auch hier ist das Formale ganz und gar Ausdruck
der Seele. Diese Seele lebt in dauernder Sorge, ob sie am Tage des Letzten Gerichtes auch des Heiles ge-
würdigt sein werde, und nur weil diese Sorge nie von ihr weicht, sind heitere Weltfreudigkeit und zuver-
sichtliche Beruhigung in sich selber den Menschen Rogiers verwehrt. Weltfreudigkeit gibt es nur dem-
gegenüber, was Gott uns geschenkt hat, dem Reichtum des Sichtbaren und der räumlichen Weite dessen,
was unser Blick in dem ihm zugemessenen Umkreise zu erfassen vermag. Das Auge daran zu laben, die
in den diesseitigen Gaben sich bekundende göttliche Gnade nicht zurückzuweisen, ist Pflicht vor allem
des Malers, dem es aufgegeben ist, dies alles zu Ehren Gottes dem Auge des Menschen zu offenbaren.
Nie freilich darf er sich verlieren an das Sichtbare um seiner selbst willen und seinen Glanz. Die Kunst
Rogiers ist weltzugewandt, aber nicht sinnenfreudig. Eher ist sie, wenigstens in den letzten Jahrzehnten
seines Schaffens, manchmal trocken und nüchtern. Seine Gestalten kennen nicht die Leidenschaft und
auch nicht den freien und höheren Aufschwung der Seele. Der Maler ist eher dem Pedantischen zuge-
neigt, dem Übergenauen. Wie wenig er sich aber dabei, was immer die Gefahr seiner Kunst war, ins Enge
und Kleine verlor, bezeugt wohl am schönsten die Tatsache, daß ihm am Ende seines Schaffens noch eine
so große und frei emporblickende Gestalt wie der Johannes der Escorialkreuzigung gelang.
Aus den literarischen Quellen wissen wir, daß Rogier außerhalb des Kreises seiner religiösen Darstel-
lungen und außer den Porträts auch gewisse profane Bilder gemalt hat. Facius berichtet, er habe von
seiner Hand in Genua das Bild einer im Bade schwitzenden Frau mit ihrem Hündchen und zwei sie heim-
lich durch eine Spalte betrachtenden jungen Männern gesehen63. Die Maler des 16. und 17. Jahrhunderts
pflegten profane Pikanterien solcher Art durch biblische Themata zu bemänteln, indem sie, Rubens und
Rembrandt z. B., eine Susanna mit den beiden Alten oder eine von David beobachtete Bathseba malten.
Solche Bemäntelung lag Rogier ganz fern. Die in der mittelalterlichen Kunst noch klare und saubere
Grenze zwischen den Bezirken des Religiösen und des Profanen war noch nicht nieder gerissen, so sehr
auch das Profane vom Religiösen her geheiligt zu werden oder als schlechthin Profanes bereits in die reli-
giösen Darstellungen selber einzudringen begann. Besäßen wir noch das Genueser Bild, so würde es uns
vielleicht einen ganz anderen Rogier kennenzulernen gestatten.
In den Bezirk des Profanen gehörten auch die Brüsseler Gerechtigkeitsbilder, auf deren innere Hal-
tung man wohl noch am ehesten aus denen von Dierick Bouts im Brüsseler Museum zurückschließen darf.
Bei Bouts sind alle Gestalten bis ins Innerste erfüllt von dem Ernst des Geschehens. Noch hat das Profane
nicht wie vielfach in Bildern des 16. Jahrhunderts die Bedeutung von Unbeteiligtheit, Gleichgültigkeit.
Noch beseelt ein Sittliches auch die Assistenz- und Nebenfiguren der Handlung.
Als Porträtist gehört Rogier kraft der durchdringenden Schärfe seiner Menschenauffassung zu den
bedeutendsten Malern seines Jahrhunderts. In einigen wenigen Porträts scheint freilich sein Interesse an
der dargestellten Person geringer zu sein als in anderen, dort nämlich, wo die Menschen ihm gleichgültig
waren oder ihn gar abstießen, wie man es vielleicht bei dem Jean de Gros des Chicagoer Bildnisses (Abb. 97)
annehmen darf. Rogiers Bildnisse sind von sehr verschiedenem Wert, je nachdem, wie sehr er sich dem
Menschen, mit dem er es zu tun hatte, innerlich verbunden zu fühlen vermochte. Verbunden fühlte er
sich, wenigstens bei den Männern, die er malte, immer dem, was ihm selber innewohnte, dem sittlichen
Ernst der Persönlichkeit. Wo er diesen nicht spürte, wandte er sich innerlich ab, und zwar gerade auch
96
Kunst eines Masaccio gewesen. Hiermit hängt auch, was man das Dynamische in der Kunst Rogiers
genannt hat, zusammen. In allen seinen Gestalten spürt man bis in die Falten ihrer Gewandung hinein
das Wirken strebender Kräfte und eine Beunruhigung, die keineswegs nur eine solche der Oberfläche ist,
sondern im tiefsten eine Beunruhigung des Gewissens. Auch hier ist das Formale ganz und gar Ausdruck
der Seele. Diese Seele lebt in dauernder Sorge, ob sie am Tage des Letzten Gerichtes auch des Heiles ge-
würdigt sein werde, und nur weil diese Sorge nie von ihr weicht, sind heitere Weltfreudigkeit und zuver-
sichtliche Beruhigung in sich selber den Menschen Rogiers verwehrt. Weltfreudigkeit gibt es nur dem-
gegenüber, was Gott uns geschenkt hat, dem Reichtum des Sichtbaren und der räumlichen Weite dessen,
was unser Blick in dem ihm zugemessenen Umkreise zu erfassen vermag. Das Auge daran zu laben, die
in den diesseitigen Gaben sich bekundende göttliche Gnade nicht zurückzuweisen, ist Pflicht vor allem
des Malers, dem es aufgegeben ist, dies alles zu Ehren Gottes dem Auge des Menschen zu offenbaren.
Nie freilich darf er sich verlieren an das Sichtbare um seiner selbst willen und seinen Glanz. Die Kunst
Rogiers ist weltzugewandt, aber nicht sinnenfreudig. Eher ist sie, wenigstens in den letzten Jahrzehnten
seines Schaffens, manchmal trocken und nüchtern. Seine Gestalten kennen nicht die Leidenschaft und
auch nicht den freien und höheren Aufschwung der Seele. Der Maler ist eher dem Pedantischen zuge-
neigt, dem Übergenauen. Wie wenig er sich aber dabei, was immer die Gefahr seiner Kunst war, ins Enge
und Kleine verlor, bezeugt wohl am schönsten die Tatsache, daß ihm am Ende seines Schaffens noch eine
so große und frei emporblickende Gestalt wie der Johannes der Escorialkreuzigung gelang.
Aus den literarischen Quellen wissen wir, daß Rogier außerhalb des Kreises seiner religiösen Darstel-
lungen und außer den Porträts auch gewisse profane Bilder gemalt hat. Facius berichtet, er habe von
seiner Hand in Genua das Bild einer im Bade schwitzenden Frau mit ihrem Hündchen und zwei sie heim-
lich durch eine Spalte betrachtenden jungen Männern gesehen63. Die Maler des 16. und 17. Jahrhunderts
pflegten profane Pikanterien solcher Art durch biblische Themata zu bemänteln, indem sie, Rubens und
Rembrandt z. B., eine Susanna mit den beiden Alten oder eine von David beobachtete Bathseba malten.
Solche Bemäntelung lag Rogier ganz fern. Die in der mittelalterlichen Kunst noch klare und saubere
Grenze zwischen den Bezirken des Religiösen und des Profanen war noch nicht nieder gerissen, so sehr
auch das Profane vom Religiösen her geheiligt zu werden oder als schlechthin Profanes bereits in die reli-
giösen Darstellungen selber einzudringen begann. Besäßen wir noch das Genueser Bild, so würde es uns
vielleicht einen ganz anderen Rogier kennenzulernen gestatten.
In den Bezirk des Profanen gehörten auch die Brüsseler Gerechtigkeitsbilder, auf deren innere Hal-
tung man wohl noch am ehesten aus denen von Dierick Bouts im Brüsseler Museum zurückschließen darf.
Bei Bouts sind alle Gestalten bis ins Innerste erfüllt von dem Ernst des Geschehens. Noch hat das Profane
nicht wie vielfach in Bildern des 16. Jahrhunderts die Bedeutung von Unbeteiligtheit, Gleichgültigkeit.
Noch beseelt ein Sittliches auch die Assistenz- und Nebenfiguren der Handlung.
Als Porträtist gehört Rogier kraft der durchdringenden Schärfe seiner Menschenauffassung zu den
bedeutendsten Malern seines Jahrhunderts. In einigen wenigen Porträts scheint freilich sein Interesse an
der dargestellten Person geringer zu sein als in anderen, dort nämlich, wo die Menschen ihm gleichgültig
waren oder ihn gar abstießen, wie man es vielleicht bei dem Jean de Gros des Chicagoer Bildnisses (Abb. 97)
annehmen darf. Rogiers Bildnisse sind von sehr verschiedenem Wert, je nachdem, wie sehr er sich dem
Menschen, mit dem er es zu tun hatte, innerlich verbunden zu fühlen vermochte. Verbunden fühlte er
sich, wenigstens bei den Männern, die er malte, immer dem, was ihm selber innewohnte, dem sittlichen
Ernst der Persönlichkeit. Wo er diesen nicht spürte, wandte er sich innerlich ab, und zwar gerade auch
96