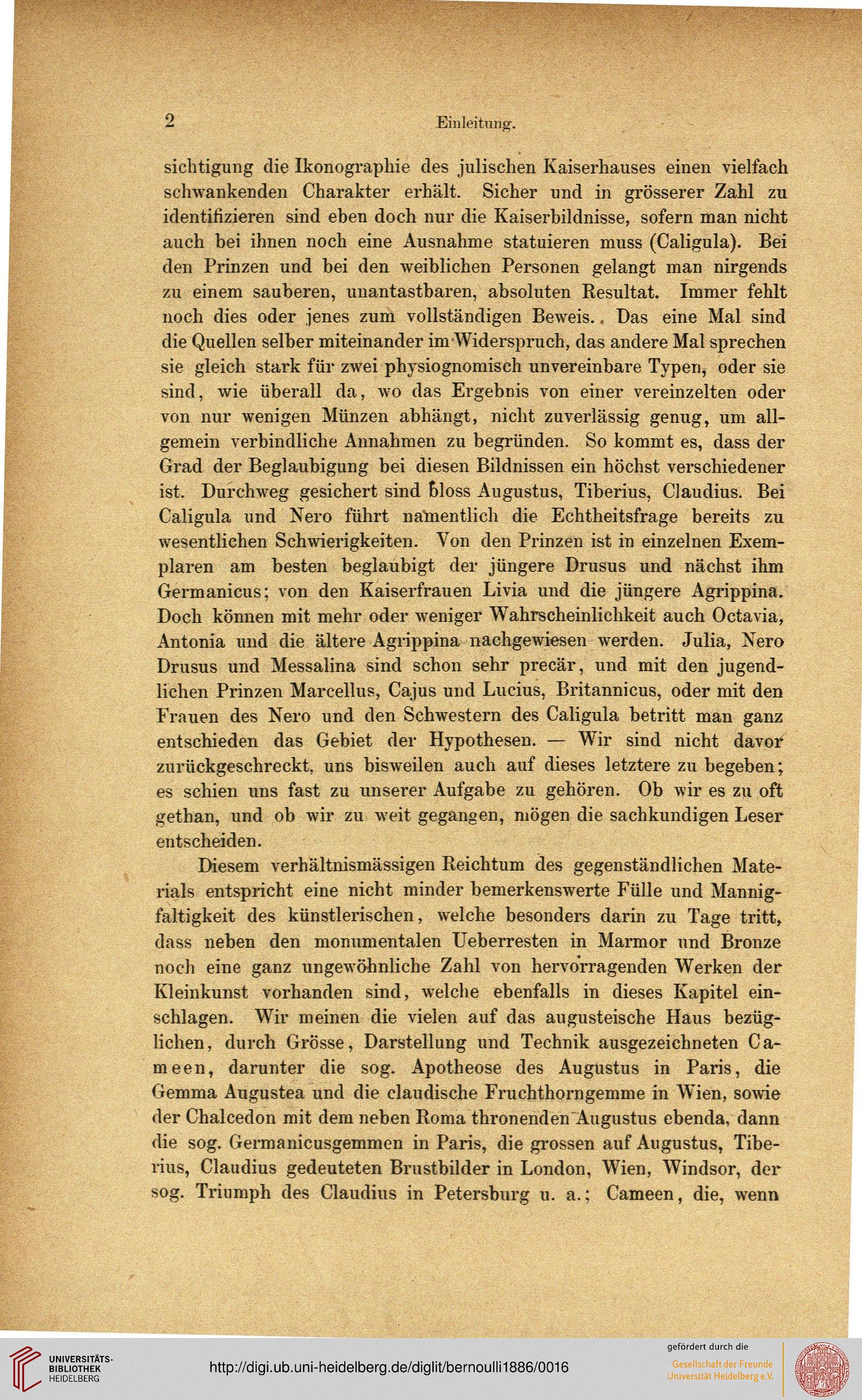Einle:
sichtigung die Ikonographie des julischen Kaiserhauses einen vielfach
schwankenden Charakter erhält. Sicher und in grösserer Zahl zu
identifizieren sind eben doch nur die Kaiserbildnisse, sofern man nicht
auch bei ihnen noch eine Ausnahme statuieren muss (Caligula). Bei
den Prinzen und bei den weiblichen Personen gelangt man nirgends
zu einem sauberen, unantastbaren, absoluten Resultat. Immer fehlt
noch dies oder jenes zum vollständigen Beweis., Das eine Mal sind
die Quellen selber miteinander im Widerspruch, das andere Mal sprechen
sie gleich stark für zwei physiognomisch unvereinbare Typen, oder sie
sind, wie überall da, wo das Ergebnis von einer vereinzelten oder
von nur wenigen Münzen abhängt, nicht zuverlässig genug, um all-
gemein verbindliche Annahmen zu begründen. So kommt es, dass der
Grad der Beglaubigung bei diesen Bildnissen ein höchst verschiedener
ist. Durchweg gesichert sind bloss Augustus, Tiberius, Claudius. Bei
Caligula und Nero führt namentlich die Echtheitsfrage bereits zu
wesentlichen Schwierigkeiten. Von den Prinzen ist in einzelnen Exem-
plaren am besten beglaubigt der jüngere Drusus und nächst ihm
Germanicus; von den Kaiserfrauen Livia und die jüngere Agrippina.
Doch können mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit auch Octavia,
Antonia und die ältere Agrippina nachgewiesen werden. Julia, Nero
Drusus und Messalina sind schon sehr precär, und mit den jugend-
lichen Prinzen Marcellus, Cajus und Lucius, Britannicus, oder mit den
Frauen des Nero und den Schwestern des Caligula betritt man ganz
entschieden das Gebiet der Hypothesen. — Wir sind nicht davor
zurückgeschreckt, uns bisweilen auch auf dieses letztere zu begeben;
es schien uns fast zu unserer Aufgabe zu gehören. Ob wir es zu oft
gethan, und ob wir zu weit gegangen, mögen die sachkundigen Leser
entscheiden.
Diesem verhältnismässigen Reichtum des gegenständlichen Mate-
rials entspricht eine nicht minder bemerkenswerte Fülle und Mannig-
faltigkeit des künstlerischen, welche besonders darin zu Tage tritt,
dass neben den monumentalen Ueberresten in Marmor und Bronze
noch eine ganz ungewöhnliche Zahl von hervorragenden Werken der
Kleinkunst vorhanden sind, welche ebenfalls in dieses Kapitel ein-
schlagen. Wir meinen die vielen auf das augusteische Haus bezüg-
lichen, durch Grösse, Darstellung und Technik ausgezeichneten Ca-
meen, darunter die sog. Apotheose des Augustus in Paris, die
Gemma Augustea und die claudische Fruchthorngemme in Wien, sowie
der Chalcedon mit dem neben Roma thronenden Augustus ebenda, dann
die sog. Germanicusgemmen in Paris, die grossen auf Augustus, Tibe-
rius, Claudius gedeuteten Brustbilder in London, Wien, Windsor, der
sog. Triumph des Claudius in Petersburg u. a.; Cameen, die, wenn
sichtigung die Ikonographie des julischen Kaiserhauses einen vielfach
schwankenden Charakter erhält. Sicher und in grösserer Zahl zu
identifizieren sind eben doch nur die Kaiserbildnisse, sofern man nicht
auch bei ihnen noch eine Ausnahme statuieren muss (Caligula). Bei
den Prinzen und bei den weiblichen Personen gelangt man nirgends
zu einem sauberen, unantastbaren, absoluten Resultat. Immer fehlt
noch dies oder jenes zum vollständigen Beweis., Das eine Mal sind
die Quellen selber miteinander im Widerspruch, das andere Mal sprechen
sie gleich stark für zwei physiognomisch unvereinbare Typen, oder sie
sind, wie überall da, wo das Ergebnis von einer vereinzelten oder
von nur wenigen Münzen abhängt, nicht zuverlässig genug, um all-
gemein verbindliche Annahmen zu begründen. So kommt es, dass der
Grad der Beglaubigung bei diesen Bildnissen ein höchst verschiedener
ist. Durchweg gesichert sind bloss Augustus, Tiberius, Claudius. Bei
Caligula und Nero führt namentlich die Echtheitsfrage bereits zu
wesentlichen Schwierigkeiten. Von den Prinzen ist in einzelnen Exem-
plaren am besten beglaubigt der jüngere Drusus und nächst ihm
Germanicus; von den Kaiserfrauen Livia und die jüngere Agrippina.
Doch können mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit auch Octavia,
Antonia und die ältere Agrippina nachgewiesen werden. Julia, Nero
Drusus und Messalina sind schon sehr precär, und mit den jugend-
lichen Prinzen Marcellus, Cajus und Lucius, Britannicus, oder mit den
Frauen des Nero und den Schwestern des Caligula betritt man ganz
entschieden das Gebiet der Hypothesen. — Wir sind nicht davor
zurückgeschreckt, uns bisweilen auch auf dieses letztere zu begeben;
es schien uns fast zu unserer Aufgabe zu gehören. Ob wir es zu oft
gethan, und ob wir zu weit gegangen, mögen die sachkundigen Leser
entscheiden.
Diesem verhältnismässigen Reichtum des gegenständlichen Mate-
rials entspricht eine nicht minder bemerkenswerte Fülle und Mannig-
faltigkeit des künstlerischen, welche besonders darin zu Tage tritt,
dass neben den monumentalen Ueberresten in Marmor und Bronze
noch eine ganz ungewöhnliche Zahl von hervorragenden Werken der
Kleinkunst vorhanden sind, welche ebenfalls in dieses Kapitel ein-
schlagen. Wir meinen die vielen auf das augusteische Haus bezüg-
lichen, durch Grösse, Darstellung und Technik ausgezeichneten Ca-
meen, darunter die sog. Apotheose des Augustus in Paris, die
Gemma Augustea und die claudische Fruchthorngemme in Wien, sowie
der Chalcedon mit dem neben Roma thronenden Augustus ebenda, dann
die sog. Germanicusgemmen in Paris, die grossen auf Augustus, Tibe-
rius, Claudius gedeuteten Brustbilder in London, Wien, Windsor, der
sog. Triumph des Claudius in Petersburg u. a.; Cameen, die, wenn