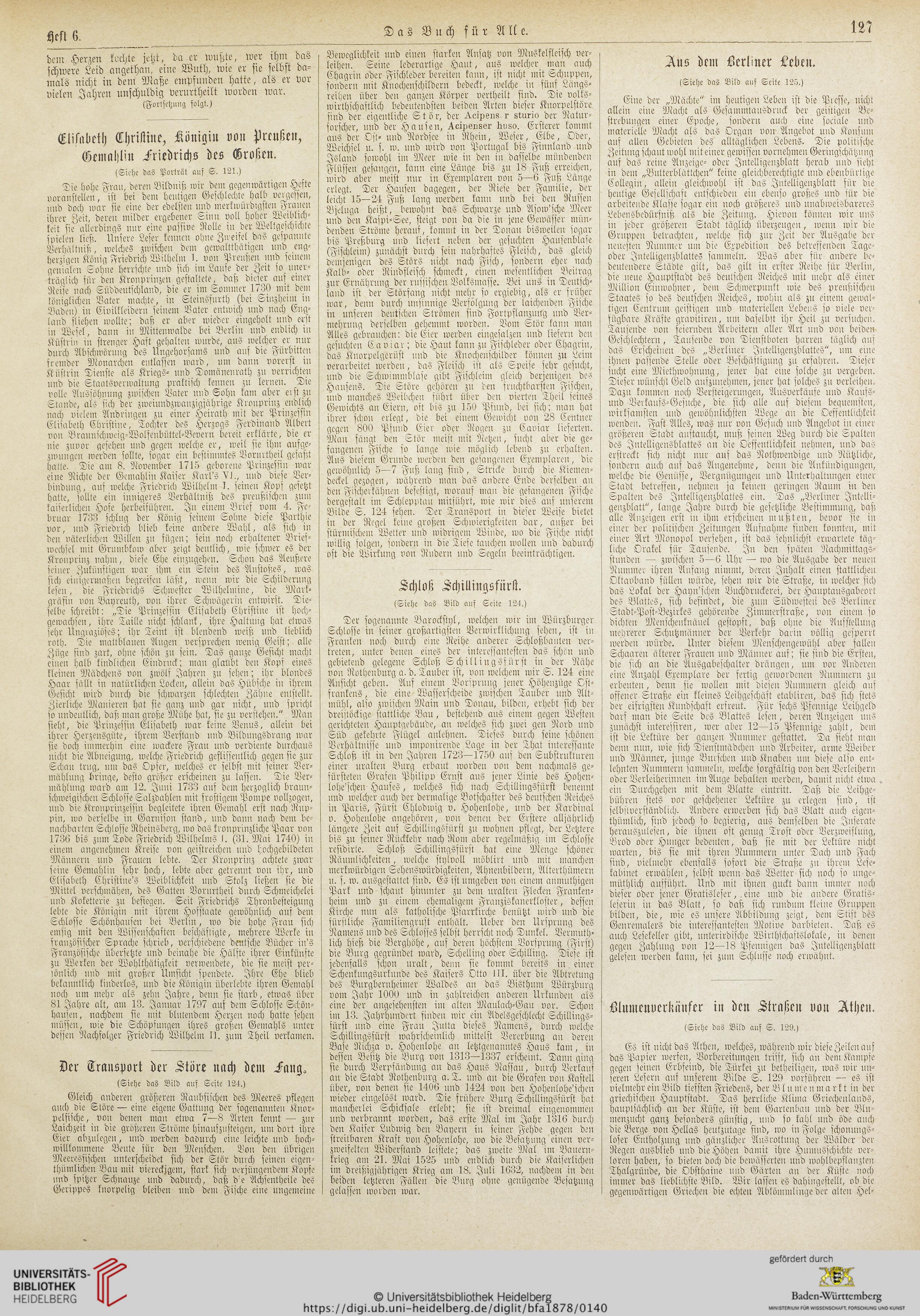Heft 6. __
dem Herzen kochte jetzt, da er wußte, wer ihm das
schwere Leid angethan, eine Wnth, wie er sie selbst da-
mals nicht in dem Maße empfunden hatte, als er vor-
vielen Jahren unschuldig verurtheilt worden war.
(Forisctzung folg!.)
EMbeth Christine) Königin non prcußeil)
Gemahlin Friedrichs des Großen.
(Siche das Porträt auf S. 121.)
Die hohe Frau, deren Bildnis; wir dem gegenwärtigen Hefte
voranstellen, ist bei dem heutigen Geschlechte halb vergessen,
und doch war sie eine der edelsten und merkwürdigsten Fronen
ihrer Zeit, deren milder ergebener Sinn voll hoher Weiblich-
keit sie allerdings nur eine passive Nolle in der Weltgeschichte
spielen ließ. Unsere Leser kennen ohne Zweifel dos gespannte
Verhältnis;, welches zwischen dem gewaltthätigen und eng-
herzigen König Friedrich Wilhelm 1. von Preußen und seinem
genialen Sohne herrschte und sich im Laufe der Zeit so, uner-
träglich sür den Kronprinzen gestaltete^ daß dieser ans einer
Reise nach Süddentschland, die er im Sommer 1730 mit dem
königlichen Vater machte, in Steinsfurth (bei Sinzheim in
Baden) in Civilkleidern seinem Vater entwich und nach Eng-
land fliehen wollte; daß er aber wieder eingeholt und erst
in Wesel, dann in Mittenwalde bei Berlin und endlich in
Küstrin in strenger Haft gehalten wurde, aus welcher er nur
durch Abschwörung des Ungehorsams und auf die Fürbitten
fremder Monarchen entlassen ward, um dann vorerst in
Küstrin Dienste als Kriegs- und Domänenrath zu verrichten
und die Staatsverwaltung praktisch kennen zu lernen. Die
volle Aussöhnung zwischen Vater und Sohn kam aber eist zu
Stande, als sich der zweiundzwanzigjährige Kronprinz endlich
nach vielem Andringen zu einer Heirath mit der Prinzessin
Elisabeth Christine, Tochter des Herzogs Ferdinand Albert
von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern bereit erklärte, die er
nie zuvor gesehen und gegen welche er, weil sie ihm aufge-
zwungcn werden sollte, sogar ein bestimmtes Vornrtheil gefaßt
halte. Die am 8. November 1715 geborene Prinzessin war
eine Nichte der Gemahlin Kaiser Karl's VU, und diese Ver-
bindung, auf welche Friedrich Wilhelm k. seinen Kopf gesetzt
hatte, sollte ein innigeres Verhältnis; des preußischen zum
kaiserlichen Hofe herbeiführen. In einem Brief vom 4. Fe-
bruar l733 schlug der König seinem Salme diese Parthie
vor, nnd Friedrich blieb keine andere Wahl, als sich in
den väterlichen Willen zn fügen; sein noch erhaltener Brief-
wechsel mit Grumbkow aber zeigt deutlich, wie schwer es der
Kronprinz nahm, diese Ehe einzngehen. Schon das Aeußere
seiner Zukünftigen war ihm ein Stein des Anstoßes, was
sich einigermaßen begreifen läßt, wenn wir die Schilderung
lesen, die Friedrichs Schwester Wilhelmine, die Mark-
gräfin von Bayreuth, von ihrer Schwägerin entwirft. Die-
selbe schreibt: „Die Prinzessin Elisabeth Christine ist hoch-
gewachsen, ihre Taille nicht schlank, ihre Haltung hat etwas
sehr Ungraziöses; ihr Teint ist blendend weiß und lieblich
roth. Die mattblauen Augen versprechen wenig Geist; alle
Züge sind zart, ohne schön zu sein. Das ganze Gesicht macht
einen halb kindlichen Eindruck; man glaubt den Kopf eines
kleinen Mädchens von zwölf Jahren zn sehen; ihr blondes
Haar sollt in natürlichen Locken, allein das Hübsche in ihrem
Gesicht wird durch die schwarzen schlechten Zähne entstellt.
Zierliche Manieren hat sie ganz und gar nicht, und spricht
so undeutlich, daß man große Mühe hat, sie zu verstehen." Man
sieht, die Prinzessin Elisabeth war keine Venus, allein bei
ihrer Herzensgüte, ihrem Verstand nnd Bildungsdrang war
sie doch immerhin eine wackere Frau und verdiente durchaus
nicht die Abneigung, welche Friedrich geflissentlich gegen sie zur
Schau trug, nm das Opfer, welches er selbst mit seiner Ver-
mählung bringe, desto größer erscheinen zn lassen. Die Ver-
mählung ward am 12. Juni 1733 auf dem herzoglich braun-
schweigischen Schlosse Salzdahlen mit frostigem Pompe vollzogen,
und die Kronprinzessin begleitete ihren Gemahl erst nach Rup-
pin, wo derselbe in Garnison stand, und dann nach dem be-
nachbarten Schlosse Rheinsberg, wo das kronprinzliche Paar von
1736 bis zum Tode Friedrich Wilhelms I. (31. Mai 1740) in
einem angenehmen Kreise von geistreichen und hochgebildeten
Männern und Frauen lebte. Der Kronprinz achtete zwar
seine Gemahlin sehr hoch, lebte aber getrennt von ihr, und
Elisabeth Christine's Weiblichkeit und Stolz ließen sie die
Mittel verschmähen, des Gatten Vornrtheil durch Schmeichelei
nnd Koketterie zn besiegen. Seit Friedrichs Thronbesteigung
lebte die Königin niit ihrem Hofstaate gewöhnlich auf dem
Schlosse Schönhansen bei Berlin, wo die hohe Frau sich
emsig mit den Wissenschaften beschäftigte, mehrere Werke in
französischer Sprache schrieb, verschiedene deutsche Bücher in's
Französische übersetzte und beinahe die Hälfte ihrer Einkünfte
zu Werken der Wohlthätigkeit verwendete, die sie meist per-
sönlich und mit großer Umsicht spendete. Ihre Ehe blieb
bekanntlich kinderlos, und die Königin überlebte ihren Gemahl
noch um mehr als zehn Jahre, denn sie starb, etwas über
81 Jahre alt, am 13. Januar 1797 auf dem Schlosse Schön-
hausen, nachdem sie mit blutendem Herzen noch hatte sehen
müssen, wst die Schöpfungen ihres großen Gemahls unter-
dessen Nachfolger Friedrich Wilhelm ll. zum Theil verkamen.
Der Transport der -Störe nach dem Fang»
(Siehe Las Bild auf Seite 124.)
Gleich anderen größeren Raubfischen des Meeres pflegen
auch die Störe — eine eigene Gattung der sogenannten Knor-
pelfische , voi; denen man etwa 7—8 Arten kennt — zur
Laichzeit in die größeren Ströme hinaufzusteigen, um dort ihre
Eier abzulegen, und werden dadurch eine leichte und hoch-
willkommene Beute sür den Menschen. Von den übrigen
Meeresfischen unterscheidet sich der Stör durch seinen eigen-
thümlicben Ban mit viereckjgem, stark sich verjüngendem Kopfe
und spitzer Schnauze und dadurch, daß d e Achsentheile des
Gerippes knorpelig bleiben und dem Fische eine ungemeine
Das Buch für Alte.
iS?
Beweglichkeit und einen starken Ansatz von Muskelfleisch ver-
leihen. Seine lederartige Haut, aus welcher man auch
Chagrin oder Fischleder bereiten kann, ist nicht mit iLchnppen,
sondern mit Knochenschildern bedeckt, welche in fünf Längs-
reihen über den ganzen Körper vertheilt sind. Die volks-
wirthschaftlich bedeutendsten beiden Arten dieser Knorpelstöre
sind der eigentliche Stör, der feixens r sturio der Natur-
forscher, und der Hansen, Feixonsor livso. Ersterer kommt
ans der Ost- und Nordsee in Rhein, Weser, Elbe, Oder,
Weichsel u. s. w. und wird von Portugal bis Finnland nnd
Island sowohl im Meer wie in den in dasselbe mündenden
Flüssen gefangen, kann eine Länge bis zu 18 Fuß erreichen,
wird aber meist nur in Exemplaren von 5—6 Fuß Länge
erlegt. Der Hansen dagegen, der Riese der Familie, der
leicht 15—24 Fuß lang werden kann nnd bei den Nnssen
Bjeluga heißt, bewohnt das Schwarze und Asow'sche Meer
und den Kaspi-See, steigt von da die in jene Gewässer mün-
denden Ströme herauf, kommt in der Donau bisweilen sogar
bis Preßburg und liefert neben der gepichten Hausenblase
(Fischleim) zunächst durch sein nahrhaftes Fleisch, das gleich
demjenigen des Störs nicht nach Fisch, sondern eher nach
Kalb- oder Rindfleisch schmeckt, einen wesentlichen Beitrag
zur Ernährung der russischen Volksmasse. Bei uns in Deutsch-
land ist der Störfang nicht mehr so ergiebig, als er früher-
war, denn durch unsinnige Verfolgung der laichenden Fische
in unseren deutschen Strömen sind Fortpflanzung nnd Ver-
mehrung derselben gehemmt worden. Vom Stör kann man
Alles gebrauchen: die Eier werden eingesalzen und liefern den
gesuchten Caviar; die Haut kann zn Fischleder oder Chagrin,
das Knorpelgerüst und die Knochenschilder können zu Leim
verarbeitet werden, das Fleisch ist als Speise sehr gesucht,
und die Schwimmblase gibt Fischleim gleich derjenigen des
Hansens. Die Störe gehören zn den fruchtbarsten Fischen,
und manches Weibchen führt über den vierten Theil seines
Gewichts an Eiern, oft bis zu 150 Pfund, bei sich; man hat
ihrer schon erlegt, die bei einem Gewicht von 28 Centner
gegen 800 Pfund Eier oder Rogen zu Caviar lieferten.
Man fängt den Stör meist mit Netzen, sucht aber die ge-
fangenen Fische so lange wie möglich lebend zu erhalten.
Aus diesem Grunde werden den gefangenen Exemplaren, die
gewöhnlich 5—7 Fuß lang sind, Stricke durch die Kiemen-
deckel gezogen, während man das andere Ende derselben an
den Fischerkähnen befestigt, worauf man die gefangenen Fische
dergestalt im Schlepptau umführt, wie wir dies auf unserem
Bilde S. 124 sehen. Der Transport in dieser Weise bietet
in der Regel keine großen Schwierigkeiten dar, außer bei
stürmischem Wetter und widrigem Winde, wo die Fische nicht
willig folgen, sondern in die Tiefe tauchen wollen und dadurch
ost die Wirkung von Rudern und Segeln beeinträchtigen.
Schloß Schillingsfürst.
(Siehe Las Bild auf Seite 124.)
Der sogenannte Varockstyl, welchen wir im Würzburger
Schlosse in seiner großartigsten Verwirklichung sehen, ist in
Franken noch durch eine Reihe anderer Schloßbanten ver-
treten, unter denen eines der interessantesten das schön und
gebietend gelegene Schloß Schillingsfürst in der Nähe
von Rothenburg a.d. Tauber ist, von welchem wir S. 124 eine
Ansicht geben. Auf einem Vorsprung jener Höhenzüge Ost-
frankens, die eine Wasserscheide zwischen Tanber und Alt-
mühl, also zwischen Main und Donau, bilden, erhebt sich der
dreistöckige stattliche Bau, bestehend aus einem gegen Westen
gerichteten Hauptgebäude, an welches sich zivei gen Nord und
Süd gekehrte Flügel anlehnen. Dieses durch feine schönen
Verhältnisse und imponirende Lage in der Lhat interessante
Schloß ist in den Jahren 1723—1750 auf den Substrukturen
einer uralten Burg erbaut worden von dem nachmals ge-
fürsteten Grafen Philipv Ernst ans jener Linie des Hohen-
lohe'schen Hauses, welches sich nach Schillingsfürst benennt
und welcher auch der dermalige Botschafter des deutschen Reiches
in Paris, Fürst Chlodwig v. Hohenlohe, und der Kardinal
v. Hohenlohe angehören, von denen der Erstere alljährlich
längere Zeit auf Schillingsfürst zu wohnen pflegt, der Letztere
bis zn feiner Rückkehr nach Rom aber regelmäßig im Schlosse
residirte. Schloß Schillingsfürst hat eine Menge schöner
Räumlichkeiten, welche stylvoll möblirt und mit manchen
merkwürdigen Sehenswürdigkeiten, Ahnenbildern, Alterthümern
u. s. w. ausgestattet sind. Es ist umgeben von einem anmuthigen
Park und schaut hinunter zu dem uralten Flecken Franken-
heim und zu einem ehemaligen! Franziskanerkloster, dessen
Kirche nun als katholische Pfarrkirche benützt wird und die
fürstliche Familiengruft enthält, lieber den Ursprung des
Namens und des Schlosses selbst herrscht noch Dunkel. Vermnth-
lich hieß die Berghöhe, auf deren höchsteni^Vorsprung (First)
die Burg gegründet ward, Schelling oder Schilling. Diese ist
jedenfalls schon uralt, denn sie kommt bereits in einer
Schenkungsurkunde des Kaisers Otto tll. über die Abtretung
des Burgbernheimer Waldes an das Bisthum Würzburg
vom Jahr 1000 und in zahlreichen anderen Urkunden als
eine der angesehensten im alten Maulach-Gau vor. Schon
im 13. Jahrhundert finden wir ein Adelsgeschlecht Schillings-
fürst und eine Fran Jutta dieses Namens, durch welche
Schillingsfürst wahrscheinlich mittelst Vererbung an deren
Bafe Nichza v. Hohenlohe an letztgenanntes Haus kam, in
dessen Besitz die Burg von 1313—1337 erscheint. Dann ging
sie durch Verpfändung an das Haus Nassau, durch Verkauf
an die Stadt Rothenburg a. T. und an die Grafen von Kastell
über, von denen sie 1406 und 1424 von den Hohenlohe'schen
wieder eingelöst ward. Die frühere Burg Schillingsfürst hat
mancherlei Schicksale erlebt; sie ist dreimal eingenommen
nnd verbrannt worden, das erste Mal im Jahr 1316 durch
den Kaiser Ludwig den Bayern in seiner Fehde gegen den
streitbaren Kraft von Hohenlohe, wo die Besatzung einen ver-
zweifelten Widerstand leistete; das zweite Mal im Bauern-
krieg am 2k. Mai 1525 und endlich durch die Kaiserlichen
im dreißigjährigen Krieg am 18. Juli 1632, nachdem in den
beiden letzteren Füllen die Burg ohne genügende Besatzung
gelassen worden war.
Aus dem Berliner Leben.
(Siehe Los Bild auf Seite 125.)
Eine der „Mächte" im heutigen Leben ist die Presse, nicht
allein eine Macht als Gesammtausdruck der geistigen Be-
strebungen einer Epoche, sondern auch eine sociale und
materielle Macht als das Organ von Angebot und Konsum
auf allen Gebieten des alltäglichen Lebens. Die politische
Zeitung schaut wohl mit einer gewissen vornehmen Geringschätzung
auf das reine Anzeige- oder Jntelligenzblatt herab nnd sieht
in dem „Butterblüttchen" keine gleichberechtigte und ebenbürtige
Collegin, allein gleichwohl ist das Jntelligenzblatt für die
heutige Gesellschaft entschieden ein ebenso großes und für die
arbeitende Klasse sogar ein noch größeres und unabweisbareres
Lebensbedürfniß als die Zeitung. Hievon können wir uns
in jeder größeren Stadt täglich überzeugen, wenn wir die
Gruppen betrachten, welche sich zur Zeit der Ausgabe dcr
neuesten Nummer um die Expedition des betreffenden Tage-
oder Jntelligenzblattes sammeln. Was aber für andere be-
deutendere Städte gilt, das gilt in erster Reihe sür Berlin,
die neue Hauptstadt des deutschen Reiches mit mehr als einer
Million Einwohner, denn Schwerpunkt ivie des preußischen
Staates so des deutschen Reiches, wohin als zu einem gewal-
tigen Centrum geistigen und materiellen Lebens so viele ver-
fügbare Kräfte gravitiren, um daselbst ihr Heil zu versuchen.
Tausende von feiernden Arbeitern aller Art und von beiden
Geschlechtern, Tausende von Dienstboten harren täglich auf
das Erscheinen des „Berliner Jntelligenzblattes", um eine
ihnen passende Stelle oder Beschäftigung zu erfahren. Dieser
sucht eine Miethwohnung, jener hat eine solche zn vergeben.
Dieser wünscht Geld aufzunehinen, jener hat solches zu verleihen.
Dazu kommen noch Versteigerungen, Ausverkäufe und Kaufs-
und Verkaufs-Gesuche, die sich alle auf diesem bequemsten,
wirksamsten und gewöhnlichsten Wege an die Oeffentlichkeit
wenden. Fast Alles, was nur von Gesuch und Angebot in einer
größeren Stadt auftaucht, muß seinen Weg durch die Spalten
des Jntelligensblattes an die Oeffentlichkeit nehmen, und das
erstreckt sich nicht nur auf das Nothwendige und Nützliche,
sondern auch auf das Angenehme, denn die Ankündigungen,
welche die Genüsse, Vergnügungen und Unterhaltungen einer
Stadt betreffen, nehmen ja keinen geringen Raum in den
Spalten des Jntelligenzblattes ein. Das „Berliner Jntelli-
genzblatt", lange Jahre durch die gesetzliche Bestimmung, daß
alle Anzeigen erst in ihm erscheinen mußten, bevor sie in
einer der politischen Zeitungen Aufnahme finden konnten, mit
einer Art Monopol versehen, ist das sehnlichst erwartete täg-
liche Orakel für Tausende. In den späten Nachmittags-
stunden — zwischen 5—6 Uhr — wo die Ausgabe der neuen
Nummer ihren Anfang nimmt, deren Inhalt einen stattlichen
Oktavband füllen würde, sehen wir die Straße, in welcher sich
das Lokal der Hayn'schen Buchdruckerei, der Hauptausgabeort
des Blattes, sich befindet, die zum Südwesten des Berlincr
Stadt-Post-Bezirkes gehörende Zimmerstraße, von einem so
dichten Menschenknäuel gestopft, daß ohne die Aufstellung
mehrerer Schutzmänner der Verkehr darin völlig gesperrt
werden würde. Unter diesem Menschengewühl aber fallen
Schaaren älterer Frauen und Männer ans; sie sind die Ersten,
die sich an die Ausgabeschalter drängen, um vor Anderen
eine Anzahl Exemplare der fertig gewordenen Nummern zu
erbeuten, denn sie wollen mit diesen Nummern gleich auf
offener Straße ein kleines Leihgeschäft etabliren, das sich stets
der eifrigsten Kundschaft erfreut. Für sechs Pfennige Leihgeld
darf man die Seite des Blattes lesen, deren Anzeigen nns
zunächst interessiren, wer aber 12—15 Pfennige zahlt, dem
ist die Lektüre der ganzen Nummer gestattet. Da sieht man
denn nun, wie sich Dienstmädchen und Arbeiter, arme Weiber
und Männer, junge Burschen und Knaben nm diese also ent-
lehnten Nummern sammeln, welche sorgfältig von den Verleihern
oder Verleiherinnen im Auge behalten werden, damit nicht etwa
ein Durchgehen mit dem Blatte eintritt. Daß die Leihge-
bühren stets vor geschehener Lektüre zu erlegen sind, ist
selbstverständlich. Andere erwerben sich das Blatt auch cigen-
thümlich, find jedoch so begierig, aus demselben die Inserate
herauszulesen, die ihnen oft genug Trost oder Verzweiflung,
Brod oder Hunger bedeuten, daß sie mit der Lektüre nicht
warten, bis sie mit ihren Nummern unter Dach und Fach
sind, vielmehr ebenfalls sofort die Straße zn ihrem Lese-
kabinet erwählen, selbst wenn das Wetter sich noch so unge-
müthlich aufführt. Und mit ihnen guckt dann immer noch
dieser oder jener Gratisleser, eine und die andere Gratis-
leserin in das Blatt, so daß sich rundum kleine Gruppen
bilden, die, wie es unsere Abbildung zeigt, dein Stift des
Genremalers die interessantesten Motive darbieten. Daß es
auch Leseteller gibt, nnterirdifche Wirthschaftslokale, in denen
gegen Zahlung von 12—18 Pfennigen das Jntelligenzblatt
gelesen werden kann, sei zum Schlüsse noch erwähnt.
Llumcnverßöuftr in den Straßen von Athen.
(Siehe Las BilL auf S. 129.)
Es ist nicht das Athen, welches, während wir diese Zeilen auf
das Papier werfen, Vorbereitungen trifft, sich an dem Kampfe
gegen seinen Erbfeind, die Türkei zn betheiligen, was nur un-
seren Lesern auf unserem Bilde S. 129 vorführen — es ist
vielmehr ein Bild tiefsten Friedens, der B l u m e n m arkt in der
griechischen Hauptstadt. Das herrliche Klima Griechenlands,
hauptsächlich an der Küste, ist dem Gartenbau und der Blu-
menzucht ganz besonders günstig, und so kahl und öde auch
die Berge von Hellas heutzutage sind, wo in Folge schonungs-
loser Entholzung und gänzlicher Ausrottung der Wälder der
Negen ausblieb und die Höhen damit ihre Humusschichtc ver-
loren haben, so bieten doch die bewässerten und wohlbepflanzten
Thalgründe, die Obsthaine und Gärten an der Küste noch
immer das lieblichste Bild. Wir lassen es dahingestellt, ob die
gegenwärtigen Griechen die echten Abkömmlinge der alten Hel-
dem Herzen kochte jetzt, da er wußte, wer ihm das
schwere Leid angethan, eine Wnth, wie er sie selbst da-
mals nicht in dem Maße empfunden hatte, als er vor-
vielen Jahren unschuldig verurtheilt worden war.
(Forisctzung folg!.)
EMbeth Christine) Königin non prcußeil)
Gemahlin Friedrichs des Großen.
(Siche das Porträt auf S. 121.)
Die hohe Frau, deren Bildnis; wir dem gegenwärtigen Hefte
voranstellen, ist bei dem heutigen Geschlechte halb vergessen,
und doch war sie eine der edelsten und merkwürdigsten Fronen
ihrer Zeit, deren milder ergebener Sinn voll hoher Weiblich-
keit sie allerdings nur eine passive Nolle in der Weltgeschichte
spielen ließ. Unsere Leser kennen ohne Zweifel dos gespannte
Verhältnis;, welches zwischen dem gewaltthätigen und eng-
herzigen König Friedrich Wilhelm 1. von Preußen und seinem
genialen Sohne herrschte und sich im Laufe der Zeit so, uner-
träglich sür den Kronprinzen gestaltete^ daß dieser ans einer
Reise nach Süddentschland, die er im Sommer 1730 mit dem
königlichen Vater machte, in Steinsfurth (bei Sinzheim in
Baden) in Civilkleidern seinem Vater entwich und nach Eng-
land fliehen wollte; daß er aber wieder eingeholt und erst
in Wesel, dann in Mittenwalde bei Berlin und endlich in
Küstrin in strenger Haft gehalten wurde, aus welcher er nur
durch Abschwörung des Ungehorsams und auf die Fürbitten
fremder Monarchen entlassen ward, um dann vorerst in
Küstrin Dienste als Kriegs- und Domänenrath zu verrichten
und die Staatsverwaltung praktisch kennen zu lernen. Die
volle Aussöhnung zwischen Vater und Sohn kam aber eist zu
Stande, als sich der zweiundzwanzigjährige Kronprinz endlich
nach vielem Andringen zu einer Heirath mit der Prinzessin
Elisabeth Christine, Tochter des Herzogs Ferdinand Albert
von Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern bereit erklärte, die er
nie zuvor gesehen und gegen welche er, weil sie ihm aufge-
zwungcn werden sollte, sogar ein bestimmtes Vornrtheil gefaßt
halte. Die am 8. November 1715 geborene Prinzessin war
eine Nichte der Gemahlin Kaiser Karl's VU, und diese Ver-
bindung, auf welche Friedrich Wilhelm k. seinen Kopf gesetzt
hatte, sollte ein innigeres Verhältnis; des preußischen zum
kaiserlichen Hofe herbeiführen. In einem Brief vom 4. Fe-
bruar l733 schlug der König seinem Salme diese Parthie
vor, nnd Friedrich blieb keine andere Wahl, als sich in
den väterlichen Willen zn fügen; sein noch erhaltener Brief-
wechsel mit Grumbkow aber zeigt deutlich, wie schwer es der
Kronprinz nahm, diese Ehe einzngehen. Schon das Aeußere
seiner Zukünftigen war ihm ein Stein des Anstoßes, was
sich einigermaßen begreifen läßt, wenn wir die Schilderung
lesen, die Friedrichs Schwester Wilhelmine, die Mark-
gräfin von Bayreuth, von ihrer Schwägerin entwirft. Die-
selbe schreibt: „Die Prinzessin Elisabeth Christine ist hoch-
gewachsen, ihre Taille nicht schlank, ihre Haltung hat etwas
sehr Ungraziöses; ihr Teint ist blendend weiß und lieblich
roth. Die mattblauen Augen versprechen wenig Geist; alle
Züge sind zart, ohne schön zu sein. Das ganze Gesicht macht
einen halb kindlichen Eindruck; man glaubt den Kopf eines
kleinen Mädchens von zwölf Jahren zn sehen; ihr blondes
Haar sollt in natürlichen Locken, allein das Hübsche in ihrem
Gesicht wird durch die schwarzen schlechten Zähne entstellt.
Zierliche Manieren hat sie ganz und gar nicht, und spricht
so undeutlich, daß man große Mühe hat, sie zu verstehen." Man
sieht, die Prinzessin Elisabeth war keine Venus, allein bei
ihrer Herzensgüte, ihrem Verstand nnd Bildungsdrang war
sie doch immerhin eine wackere Frau und verdiente durchaus
nicht die Abneigung, welche Friedrich geflissentlich gegen sie zur
Schau trug, nm das Opfer, welches er selbst mit seiner Ver-
mählung bringe, desto größer erscheinen zn lassen. Die Ver-
mählung ward am 12. Juni 1733 auf dem herzoglich braun-
schweigischen Schlosse Salzdahlen mit frostigem Pompe vollzogen,
und die Kronprinzessin begleitete ihren Gemahl erst nach Rup-
pin, wo derselbe in Garnison stand, und dann nach dem be-
nachbarten Schlosse Rheinsberg, wo das kronprinzliche Paar von
1736 bis zum Tode Friedrich Wilhelms I. (31. Mai 1740) in
einem angenehmen Kreise von geistreichen und hochgebildeten
Männern und Frauen lebte. Der Kronprinz achtete zwar
seine Gemahlin sehr hoch, lebte aber getrennt von ihr, und
Elisabeth Christine's Weiblichkeit und Stolz ließen sie die
Mittel verschmähen, des Gatten Vornrtheil durch Schmeichelei
nnd Koketterie zn besiegen. Seit Friedrichs Thronbesteigung
lebte die Königin niit ihrem Hofstaate gewöhnlich auf dem
Schlosse Schönhansen bei Berlin, wo die hohe Frau sich
emsig mit den Wissenschaften beschäftigte, mehrere Werke in
französischer Sprache schrieb, verschiedene deutsche Bücher in's
Französische übersetzte und beinahe die Hälfte ihrer Einkünfte
zu Werken der Wohlthätigkeit verwendete, die sie meist per-
sönlich und mit großer Umsicht spendete. Ihre Ehe blieb
bekanntlich kinderlos, und die Königin überlebte ihren Gemahl
noch um mehr als zehn Jahre, denn sie starb, etwas über
81 Jahre alt, am 13. Januar 1797 auf dem Schlosse Schön-
hausen, nachdem sie mit blutendem Herzen noch hatte sehen
müssen, wst die Schöpfungen ihres großen Gemahls unter-
dessen Nachfolger Friedrich Wilhelm ll. zum Theil verkamen.
Der Transport der -Störe nach dem Fang»
(Siehe Las Bild auf Seite 124.)
Gleich anderen größeren Raubfischen des Meeres pflegen
auch die Störe — eine eigene Gattung der sogenannten Knor-
pelfische , voi; denen man etwa 7—8 Arten kennt — zur
Laichzeit in die größeren Ströme hinaufzusteigen, um dort ihre
Eier abzulegen, und werden dadurch eine leichte und hoch-
willkommene Beute sür den Menschen. Von den übrigen
Meeresfischen unterscheidet sich der Stör durch seinen eigen-
thümlicben Ban mit viereckjgem, stark sich verjüngendem Kopfe
und spitzer Schnauze und dadurch, daß d e Achsentheile des
Gerippes knorpelig bleiben und dem Fische eine ungemeine
Das Buch für Alte.
iS?
Beweglichkeit und einen starken Ansatz von Muskelfleisch ver-
leihen. Seine lederartige Haut, aus welcher man auch
Chagrin oder Fischleder bereiten kann, ist nicht mit iLchnppen,
sondern mit Knochenschildern bedeckt, welche in fünf Längs-
reihen über den ganzen Körper vertheilt sind. Die volks-
wirthschaftlich bedeutendsten beiden Arten dieser Knorpelstöre
sind der eigentliche Stör, der feixens r sturio der Natur-
forscher, und der Hansen, Feixonsor livso. Ersterer kommt
ans der Ost- und Nordsee in Rhein, Weser, Elbe, Oder,
Weichsel u. s. w. und wird von Portugal bis Finnland nnd
Island sowohl im Meer wie in den in dasselbe mündenden
Flüssen gefangen, kann eine Länge bis zu 18 Fuß erreichen,
wird aber meist nur in Exemplaren von 5—6 Fuß Länge
erlegt. Der Hansen dagegen, der Riese der Familie, der
leicht 15—24 Fuß lang werden kann nnd bei den Nnssen
Bjeluga heißt, bewohnt das Schwarze und Asow'sche Meer
und den Kaspi-See, steigt von da die in jene Gewässer mün-
denden Ströme herauf, kommt in der Donau bisweilen sogar
bis Preßburg und liefert neben der gepichten Hausenblase
(Fischleim) zunächst durch sein nahrhaftes Fleisch, das gleich
demjenigen des Störs nicht nach Fisch, sondern eher nach
Kalb- oder Rindfleisch schmeckt, einen wesentlichen Beitrag
zur Ernährung der russischen Volksmasse. Bei uns in Deutsch-
land ist der Störfang nicht mehr so ergiebig, als er früher-
war, denn durch unsinnige Verfolgung der laichenden Fische
in unseren deutschen Strömen sind Fortpflanzung nnd Ver-
mehrung derselben gehemmt worden. Vom Stör kann man
Alles gebrauchen: die Eier werden eingesalzen und liefern den
gesuchten Caviar; die Haut kann zn Fischleder oder Chagrin,
das Knorpelgerüst und die Knochenschilder können zu Leim
verarbeitet werden, das Fleisch ist als Speise sehr gesucht,
und die Schwimmblase gibt Fischleim gleich derjenigen des
Hansens. Die Störe gehören zn den fruchtbarsten Fischen,
und manches Weibchen führt über den vierten Theil seines
Gewichts an Eiern, oft bis zu 150 Pfund, bei sich; man hat
ihrer schon erlegt, die bei einem Gewicht von 28 Centner
gegen 800 Pfund Eier oder Rogen zu Caviar lieferten.
Man fängt den Stör meist mit Netzen, sucht aber die ge-
fangenen Fische so lange wie möglich lebend zu erhalten.
Aus diesem Grunde werden den gefangenen Exemplaren, die
gewöhnlich 5—7 Fuß lang sind, Stricke durch die Kiemen-
deckel gezogen, während man das andere Ende derselben an
den Fischerkähnen befestigt, worauf man die gefangenen Fische
dergestalt im Schlepptau umführt, wie wir dies auf unserem
Bilde S. 124 sehen. Der Transport in dieser Weise bietet
in der Regel keine großen Schwierigkeiten dar, außer bei
stürmischem Wetter und widrigem Winde, wo die Fische nicht
willig folgen, sondern in die Tiefe tauchen wollen und dadurch
ost die Wirkung von Rudern und Segeln beeinträchtigen.
Schloß Schillingsfürst.
(Siehe Las Bild auf Seite 124.)
Der sogenannte Varockstyl, welchen wir im Würzburger
Schlosse in seiner großartigsten Verwirklichung sehen, ist in
Franken noch durch eine Reihe anderer Schloßbanten ver-
treten, unter denen eines der interessantesten das schön und
gebietend gelegene Schloß Schillingsfürst in der Nähe
von Rothenburg a.d. Tauber ist, von welchem wir S. 124 eine
Ansicht geben. Auf einem Vorsprung jener Höhenzüge Ost-
frankens, die eine Wasserscheide zwischen Tanber und Alt-
mühl, also zwischen Main und Donau, bilden, erhebt sich der
dreistöckige stattliche Bau, bestehend aus einem gegen Westen
gerichteten Hauptgebäude, an welches sich zivei gen Nord und
Süd gekehrte Flügel anlehnen. Dieses durch feine schönen
Verhältnisse und imponirende Lage in der Lhat interessante
Schloß ist in den Jahren 1723—1750 auf den Substrukturen
einer uralten Burg erbaut worden von dem nachmals ge-
fürsteten Grafen Philipv Ernst ans jener Linie des Hohen-
lohe'schen Hauses, welches sich nach Schillingsfürst benennt
und welcher auch der dermalige Botschafter des deutschen Reiches
in Paris, Fürst Chlodwig v. Hohenlohe, und der Kardinal
v. Hohenlohe angehören, von denen der Erstere alljährlich
längere Zeit auf Schillingsfürst zu wohnen pflegt, der Letztere
bis zn feiner Rückkehr nach Rom aber regelmäßig im Schlosse
residirte. Schloß Schillingsfürst hat eine Menge schöner
Räumlichkeiten, welche stylvoll möblirt und mit manchen
merkwürdigen Sehenswürdigkeiten, Ahnenbildern, Alterthümern
u. s. w. ausgestattet sind. Es ist umgeben von einem anmuthigen
Park und schaut hinunter zu dem uralten Flecken Franken-
heim und zu einem ehemaligen! Franziskanerkloster, dessen
Kirche nun als katholische Pfarrkirche benützt wird und die
fürstliche Familiengruft enthält, lieber den Ursprung des
Namens und des Schlosses selbst herrscht noch Dunkel. Vermnth-
lich hieß die Berghöhe, auf deren höchsteni^Vorsprung (First)
die Burg gegründet ward, Schelling oder Schilling. Diese ist
jedenfalls schon uralt, denn sie kommt bereits in einer
Schenkungsurkunde des Kaisers Otto tll. über die Abtretung
des Burgbernheimer Waldes an das Bisthum Würzburg
vom Jahr 1000 und in zahlreichen anderen Urkunden als
eine der angesehensten im alten Maulach-Gau vor. Schon
im 13. Jahrhundert finden wir ein Adelsgeschlecht Schillings-
fürst und eine Fran Jutta dieses Namens, durch welche
Schillingsfürst wahrscheinlich mittelst Vererbung an deren
Bafe Nichza v. Hohenlohe an letztgenanntes Haus kam, in
dessen Besitz die Burg von 1313—1337 erscheint. Dann ging
sie durch Verpfändung an das Haus Nassau, durch Verkauf
an die Stadt Rothenburg a. T. und an die Grafen von Kastell
über, von denen sie 1406 und 1424 von den Hohenlohe'schen
wieder eingelöst ward. Die frühere Burg Schillingsfürst hat
mancherlei Schicksale erlebt; sie ist dreimal eingenommen
nnd verbrannt worden, das erste Mal im Jahr 1316 durch
den Kaiser Ludwig den Bayern in seiner Fehde gegen den
streitbaren Kraft von Hohenlohe, wo die Besatzung einen ver-
zweifelten Widerstand leistete; das zweite Mal im Bauern-
krieg am 2k. Mai 1525 und endlich durch die Kaiserlichen
im dreißigjährigen Krieg am 18. Juli 1632, nachdem in den
beiden letzteren Füllen die Burg ohne genügende Besatzung
gelassen worden war.
Aus dem Berliner Leben.
(Siehe Los Bild auf Seite 125.)
Eine der „Mächte" im heutigen Leben ist die Presse, nicht
allein eine Macht als Gesammtausdruck der geistigen Be-
strebungen einer Epoche, sondern auch eine sociale und
materielle Macht als das Organ von Angebot und Konsum
auf allen Gebieten des alltäglichen Lebens. Die politische
Zeitung schaut wohl mit einer gewissen vornehmen Geringschätzung
auf das reine Anzeige- oder Jntelligenzblatt herab nnd sieht
in dem „Butterblüttchen" keine gleichberechtigte und ebenbürtige
Collegin, allein gleichwohl ist das Jntelligenzblatt für die
heutige Gesellschaft entschieden ein ebenso großes und für die
arbeitende Klasse sogar ein noch größeres und unabweisbareres
Lebensbedürfniß als die Zeitung. Hievon können wir uns
in jeder größeren Stadt täglich überzeugen, wenn wir die
Gruppen betrachten, welche sich zur Zeit der Ausgabe dcr
neuesten Nummer um die Expedition des betreffenden Tage-
oder Jntelligenzblattes sammeln. Was aber für andere be-
deutendere Städte gilt, das gilt in erster Reihe sür Berlin,
die neue Hauptstadt des deutschen Reiches mit mehr als einer
Million Einwohner, denn Schwerpunkt ivie des preußischen
Staates so des deutschen Reiches, wohin als zu einem gewal-
tigen Centrum geistigen und materiellen Lebens so viele ver-
fügbare Kräfte gravitiren, um daselbst ihr Heil zu versuchen.
Tausende von feiernden Arbeitern aller Art und von beiden
Geschlechtern, Tausende von Dienstboten harren täglich auf
das Erscheinen des „Berliner Jntelligenzblattes", um eine
ihnen passende Stelle oder Beschäftigung zu erfahren. Dieser
sucht eine Miethwohnung, jener hat eine solche zn vergeben.
Dieser wünscht Geld aufzunehinen, jener hat solches zu verleihen.
Dazu kommen noch Versteigerungen, Ausverkäufe und Kaufs-
und Verkaufs-Gesuche, die sich alle auf diesem bequemsten,
wirksamsten und gewöhnlichsten Wege an die Oeffentlichkeit
wenden. Fast Alles, was nur von Gesuch und Angebot in einer
größeren Stadt auftaucht, muß seinen Weg durch die Spalten
des Jntelligensblattes an die Oeffentlichkeit nehmen, und das
erstreckt sich nicht nur auf das Nothwendige und Nützliche,
sondern auch auf das Angenehme, denn die Ankündigungen,
welche die Genüsse, Vergnügungen und Unterhaltungen einer
Stadt betreffen, nehmen ja keinen geringen Raum in den
Spalten des Jntelligenzblattes ein. Das „Berliner Jntelli-
genzblatt", lange Jahre durch die gesetzliche Bestimmung, daß
alle Anzeigen erst in ihm erscheinen mußten, bevor sie in
einer der politischen Zeitungen Aufnahme finden konnten, mit
einer Art Monopol versehen, ist das sehnlichst erwartete täg-
liche Orakel für Tausende. In den späten Nachmittags-
stunden — zwischen 5—6 Uhr — wo die Ausgabe der neuen
Nummer ihren Anfang nimmt, deren Inhalt einen stattlichen
Oktavband füllen würde, sehen wir die Straße, in welcher sich
das Lokal der Hayn'schen Buchdruckerei, der Hauptausgabeort
des Blattes, sich befindet, die zum Südwesten des Berlincr
Stadt-Post-Bezirkes gehörende Zimmerstraße, von einem so
dichten Menschenknäuel gestopft, daß ohne die Aufstellung
mehrerer Schutzmänner der Verkehr darin völlig gesperrt
werden würde. Unter diesem Menschengewühl aber fallen
Schaaren älterer Frauen und Männer ans; sie sind die Ersten,
die sich an die Ausgabeschalter drängen, um vor Anderen
eine Anzahl Exemplare der fertig gewordenen Nummern zu
erbeuten, denn sie wollen mit diesen Nummern gleich auf
offener Straße ein kleines Leihgeschäft etabliren, das sich stets
der eifrigsten Kundschaft erfreut. Für sechs Pfennige Leihgeld
darf man die Seite des Blattes lesen, deren Anzeigen nns
zunächst interessiren, wer aber 12—15 Pfennige zahlt, dem
ist die Lektüre der ganzen Nummer gestattet. Da sieht man
denn nun, wie sich Dienstmädchen und Arbeiter, arme Weiber
und Männer, junge Burschen und Knaben nm diese also ent-
lehnten Nummern sammeln, welche sorgfältig von den Verleihern
oder Verleiherinnen im Auge behalten werden, damit nicht etwa
ein Durchgehen mit dem Blatte eintritt. Daß die Leihge-
bühren stets vor geschehener Lektüre zu erlegen sind, ist
selbstverständlich. Andere erwerben sich das Blatt auch cigen-
thümlich, find jedoch so begierig, aus demselben die Inserate
herauszulesen, die ihnen oft genug Trost oder Verzweiflung,
Brod oder Hunger bedeuten, daß sie mit der Lektüre nicht
warten, bis sie mit ihren Nummern unter Dach und Fach
sind, vielmehr ebenfalls sofort die Straße zn ihrem Lese-
kabinet erwählen, selbst wenn das Wetter sich noch so unge-
müthlich aufführt. Und mit ihnen guckt dann immer noch
dieser oder jener Gratisleser, eine und die andere Gratis-
leserin in das Blatt, so daß sich rundum kleine Gruppen
bilden, die, wie es unsere Abbildung zeigt, dein Stift des
Genremalers die interessantesten Motive darbieten. Daß es
auch Leseteller gibt, nnterirdifche Wirthschaftslokale, in denen
gegen Zahlung von 12—18 Pfennigen das Jntelligenzblatt
gelesen werden kann, sei zum Schlüsse noch erwähnt.
Llumcnverßöuftr in den Straßen von Athen.
(Siehe Las BilL auf S. 129.)
Es ist nicht das Athen, welches, während wir diese Zeilen auf
das Papier werfen, Vorbereitungen trifft, sich an dem Kampfe
gegen seinen Erbfeind, die Türkei zn betheiligen, was nur un-
seren Lesern auf unserem Bilde S. 129 vorführen — es ist
vielmehr ein Bild tiefsten Friedens, der B l u m e n m arkt in der
griechischen Hauptstadt. Das herrliche Klima Griechenlands,
hauptsächlich an der Küste, ist dem Gartenbau und der Blu-
menzucht ganz besonders günstig, und so kahl und öde auch
die Berge von Hellas heutzutage sind, wo in Folge schonungs-
loser Entholzung und gänzlicher Ausrottung der Wälder der
Negen ausblieb und die Höhen damit ihre Humusschichtc ver-
loren haben, so bieten doch die bewässerten und wohlbepflanzten
Thalgründe, die Obsthaine und Gärten an der Küste noch
immer das lieblichste Bild. Wir lassen es dahingestellt, ob die
gegenwärtigen Griechen die echten Abkömmlinge der alten Hel-