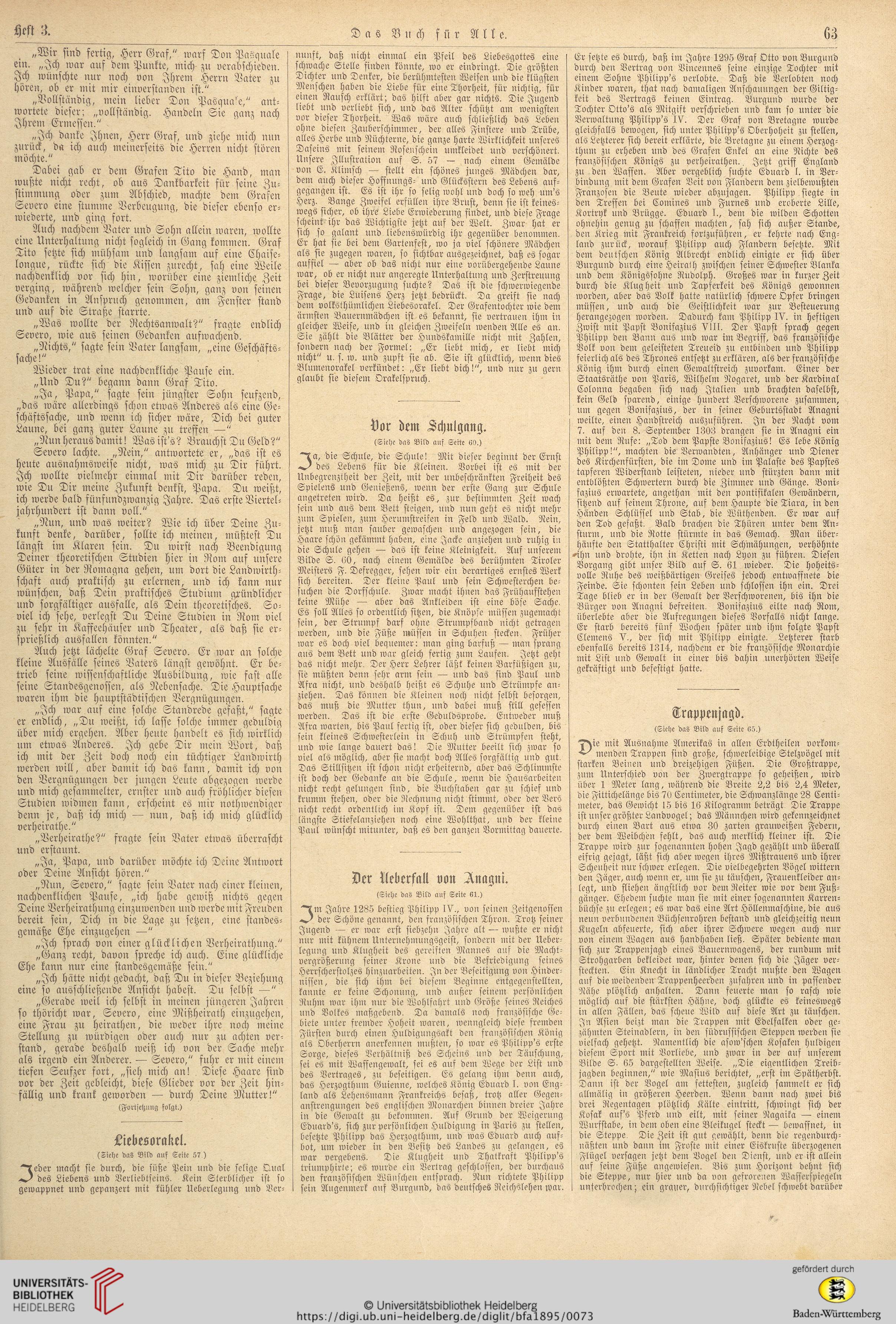Heft 3._
„Wir sind fertig, Herr Graf," warf Don Pasquale
ein. „Ich war auf dem Punkte, mich zu verabschieden.
Ich wünschte nur noch von Ihrem Herrn Vater zu
hören, ob er mit mir einverstanden ist."
„Vollständig, mein lieber Don PasquaP" ant-
wortete dieser; „vollständig. Handeln Sie ganz nach
Ihrem Ermessen."
„Ich danke Ihnen, Herr Graf, und ziehe mich nun
zurück, da ich auch meinerseits die Herren nicht stören
möchte."
Dabei gab er dem Grasen Tito die Hand, man
wußte nicht recht, ob aus Dankbarkeit für seine Zu-
stimmung oder zum Abschied, machte dem Grafen
Severo eine stumme Verbeugung, die dieser ebenso er-
wiederte, und ging fort.
Auch nachdem Vater und Sohn allein waren, wollte
eine Unterhaltung nicht sogleich in Gang kommen. Graf
Tito setzte sich mühsam und langsam "auf eine Chaise-
longue, rückte sich die Kissen zurecht, sah eine Weile
nachdenklich vor sich hin, worüber eine ziemliche Zeit
verging, während welcher sein Sohn, ganz von seinen
Gedanken in Anspruch genommen, am Fenster stand
und auf die Straße starrte.
„Was wollte der Rechtsanwalt?" fragte endlich
Severo, wie aus seinen Gedanken aufwachend.
„Nichts," sagte sein Vater langsam, „eine Geschäfts-
sache!" , '
Wieder trat eine nachdenkliche Pause ein.
„Und Du?" begann dann Graf Tito.
„In, Papa," sagte sein jüngster Sohn seufzend,
„das wäre allerdings fchon etwas Anderes als eine Ge-
schäftssache, und wenn ich sicher wäre, Dich bei guter
Laune, bei ganz guter Laune zu treffen —"
„Nun heraus damit! Was ist's? Brauchst Du Geld?"
Severo lachte. „Nein," antwortete er, „das ist es
heute ausnahmsweise nicht, was mich zu Dir führt.
Ich wollte vielmehr einmal mit Dir darüber reden,
wie Du Dir meine Zukunft denkst, Papa. Du weißt,
ich werde bald fünfundzwanzig Jahre. Das erste Viertel-
jahrhundert ist dann voll."
„Nun, und was weiter? Wie ich über Deine Zu-
kunft denke, darüber, sollte ich meinen, müßtest Du
längst im Klaren fein. Du wirst nach Beendigung
Deiner theoretischen Studien hier in Rom auf unsere
Güter in der Romagna gehen, um dort die Landwirth-
schaft auch praktisch zu erlernen, und ich kann nur
wünschen, daß Dein praktisches Studium gründlicher
und sorgfältiger ausfalle, als Dein theoretisches. So-
viel ich sehe, verlegst Du Deine Studien in Rom viel
zu sehr in Kaffeehäuser und Theater, als daß sie er-
sprießlich ausfallen könnten."
Auch jetzt lächelte Graf Severo. Er mar an solche
kleine Ausfälle feines Vaters längst gewöhnt. Er be-
trieb seine wissenschaftliche Ausbildung, wie fast alle
seine Standesgenossen, als Nebensache. Die Hauptsache
waren ihm die hauptstädtischen Vergnügungen.
„Ich war auf eine solche Standrede gefaßt," sagte
er endlich, „Du weißt, ich lasse solche immer geduldig
über mich ergehen. Aber heute handelt es sich wirklich
um etwas Anderes. Ich gebe Dir mein Wort, daß
ich mit der Zeit doch noch ein tüchtiger Landmirth
werden will, aber damit ich das kann, damit ich von
den Vergnügungen der jungen Leute abgezogen werde
und mich gesammelter, ernster und auch fröhlicher diesen
Studien widmen kann, erscheint es mir nothwendiger
denn je, daß ich mich — nun, daß ich mich glücklich
verheirathe."
„Verheirathe?" fragte sein Vater etwas überrascht
und erstaunt.
„Ja, Papa, und darüber möchte ich Deine Antwort
oder Deine Ansicht hören."
„Nun, Severo," sagte sein Vater nach einer kleinen,
nachdenklichen Pause, „ich habe gewiß nichts gegen
Deine Verheirathung einzuwenden und werde mit Freuden
bereit sein, Dich in die Lage zu setzen, eine standes-
gemäße Ehe einzugehen —"
„Ich sprach von einer glücklichen Verheirathung."
„Ganz recht, davon spreche ich auch. Eine glückliche
Ehe kann nur eine standesgemäße sein."
„Ich hätte nicht gedacht, daß Du in dieser Beziehung
eine so ausschließende Ansicht habest. Du selbst —"
„Gerade weil ich selbst in meinen jüngeren Jahren
so thöricht war, Severo, eine Mißheirath einzugehen,
eine Frau zu heirathen, die weder ihre noch meine
Stellung zu würdigen oder auch uur zu achten ver-
stand, gerade deshalb weiß ich von der Sache mehr
als irgend ein Anderer. — Severo," fuhr er mit einem
tiefen Seufzer fort, „sieh mich an! Diese Haare sind
vor der Zeit gebleicht, diese Glieder vor der Zeit hin-
fällig und krank geworden — durch Deine Mutter!"
(Fortsetzung folgt.)
Liebesorakel.
(Tiehe das Bild auf Teile 57 )
^keder macht sie durch, die süße Pein und die selige Qual
des Liebens und Verliebtseins. Kein Sterblicher ist so
gewappnet und gepanzert mit kühler Ueberlegung und Ver-
Das Vu ch f i'l r Alle.
mufft, daß nicht einmal ein Pfeil des Liebesgottes eine
schwache Stelle finden könnte, wo er eindringt. Die größten
Dichter und Denker, die berühmtesten Weisen lind dis klügsten
Menschen haben die Liebe für eine Thorheit, für nichtig, für
einen Rausch erklärt; das hilft aber gar nichts. Die Jugend
liebt und verliebt sich, und das Alter schützt am wenigsteil
vor dieser Thorheit. Was wäre auch schließlich das Leben
ohne diesen Zauberschimmer, der alles Finstere und Trübe,
alles Herbe und Nüchterne, die ganze harte Wirklichkeit unseres
Daseins mit seinem Rosenschein umkleidet und verschönert.
Unsere Illustration auf S. 57 — nach einem Gemälde
von E. Klinisch — stellt ein schönes junges Mädchen dar,
dem auch dieser Hoffnungs- und Glücksstern des Lebens auf-
gegangen ist. Es ist ihr so selig wohl und doch so weh um's
Herz. Bange Zweifel erfüllen ihre Brust, denn sie ist keines-
wegs sicher, ob ihre Liebe Erwiederung findet, und diese Frage
scheint ihr das Wichtigste jetzt auf der Welt. Zwar hat er
sich so galant und liebenswürdig ihr gegenüber benommen.
Er hat sie bei dem Gartenfest, wo ja viel schönere Mädchen
als sie zugegen waren, so sichtbar ausgezeichnet, daß es sogar
auffiel — aber ob das nicht nur eine vorübergehende Laune
mar, ob er nicht nur angeregte Unterhaltung und Zerstreuung
bei dieser Bevorzugung suchte? Das ist die schwerwiegende
Frage, dis Luisens Herz jetzt bedrückt. Da greift sie nach
dem volksthümlichen Liebesorakel. Der Grasentochter wie dem
ärmsten Bauernmädchen ist es bekannt, sie vertrauen ihm in
gleicher Weise, und in gleichen Zweifeln wenden Alle es an.
Sie zählt die Blätter der Hundskamille nicht mit Zahlen,
sondern nach der Formel: „Er liebt mich, er liebt mich
nicht" u. s. w. und zupft sie ab. Sie ist glücklich, wenn dies
Blumenorakel verkündet: „Er liebt dich!", und nur zu gern
glaubt sie diesem Orakelspruch.
Vor dem Schulgong.
Tka, die Schule, die Schule! Mit dieser beginnt der Ernst
des Lebens für die Kleinen. Vorbei ist es mit der
Unbegrenztheit der Zeit, mit der unbeschränkten Freiheit des
Spielens und Genießens, wenn der erste Gang zur Schule
angetreten wird. Da heißt es, zur bestimmten Zeit wach
sein und aus dem Bett steigen, und nun geht es nicht mehr
zum Spielen, zum Herumstreifen in Feld und Wald. Nein,
jetzt muß man sauber gewaschen und angezogen sein, die
Haare schön gekämmt haben, eine Jacke anziehen und ruhig in
die Schule gehen — das ist keine Kleinigkeit. Auf unserem
Bilde S. 00, nach einem Gemälde des berühmten Tiroler
Meisters F. Defregger, sehen wir ein derartiges ernstes Werk
sich bereiten. Der kleine Paul und sein Schwesterchen be-
suchen die Dorfschule. Zwar macht ihnen das Frühaufstehen
keine Mühe — aber das Ankleiden ist eine böse Sache.
Es soll Alles so ordentlich sitzen, die Knöpfe müssen zugemacht
sein, der Strumpf darf ohne Strumpfband nicht getragen
werden, und die Füße müssen in Schuhen stecken. Früher
war es doch viel bequemer: man ging barfuß — man sprang
aus dem Bett und war gleich fertig zum Lausen. Jetzt geht
das nicht mehr. Der Herr Lehrer läßt" keinen Barfüßigen zu,
sie müßten denn sehr arm sein — und das sind Paul und
Afra nicht, und deshalb heißt es Schuhe und Strümpfe an-
ziehen. Das können die Kleinen noch nicht selbst besorgen,
das muß die Mutter thun, und dabei muß still gesessen
werden. Das ist die erste Geduldsprobe. Entweder muß
Afra warten, bis Paul fertig ist, oder dieser sich gedulden, bis
sein kleines Schwesterlein in Schuh und Strümpfen steht,
und wie lange dauert das! Die Blutter beeilt sich zwar so
viel als möglich, aber sie macht doch Alles sorgfältig und gut.
Das Stillsitzen ist schon nicht erheiternd, aber das Schlimmste
ist doch der Gedanke an die Schule, wenn die Halisarbeiten
nicht recht gelungen sind, die Buchstaben gar zu schief und
! krumm stehen, oder die Rechnung nicht stimmt, oder der Vers
I nicht recht ordentlich im Kopf ist. Dem gegenüber ist das
längste Stiefelanziehen noch eine Wohlthat, und der kleine
Paul wünscht mitunter, daß es den ganzen Vormittag dauerte.
Ver Aekerfoll von Anogni.
(Siehe das Bild auf Seite 61.)
^m Jahre 1285 bestieg Philipp IV., von seinen Zeitgenossen
der Schöne genannt, den französischen Thron. Trotz seiner
Jugend — er war erst siebzehn Jahre alt — wußte er nicht
nur mit kühnem Unternehmungsgeist, sondern mit der Ueber-
legung und Klugheit des gereiften Mannes auf die Macht-
vergrößerung seiner Krone und die Befriedigung seines
Herrscherstolzes hinzuarbeiten. In der Beseitigung von Hinder-
nissen, die sich ihm bei diesem Beginne entgegenstellten,
kannte er keine Schonung, und außer seinem persönlichen
Ruhm war ihm nur die Wohlfahrt und Größe seines Reiches
und Volkes maßgebend. Da damals noch französische Ge-
biete unter fremder Hoheit waren, wenngleich diese fremden
Fürsten durch einen Huldigungsakt den französischen König
als Oberherrn anerkennen mußten, so war es Philipp's erste
Sorge, dieses Verhältniß des Scheins und der Täuschung,
sei es mit Waffengewalt, sei es auf dem Wege der List rind
des Vertrages, zu beseitigen. Es gelang ihm denn auch,
das Herzogthum Guienne, welches König Eduard I. von Eng-
land als Lehensmann Frankreichs besaß, trotz aller Gegen-
anstrengungen des englischen Monarchen binnen dreier Jahre
in die "Gewalt zu bekommen. Auf Grund der Weigerung
Eduard's, sich zur persönlichen Huldigung in Paris zu stellen,
besetzte Philipp das Herzogthum, und was Eduard auch aus-
bot, um wieder in den Besitz des Landes zu gelangen, es
war vergebens. Die Klugheit und Thatkraft Philipp's
triumphirle; es wurde ein Vertrag geschlossen, der durchaus
den französischen Wünschen entsprach. Nun richtete Philipp
sein Augenmerk ans Burgund, das deutsches Neichslehen war.
63
Er setzte es durch, daß im Jahre 1295 Graf Otto von Burgund
durch den Vertrag von Vincennes seine einzige Tochter mit
einem Sohne Philipp's verlobte. Daß die Verlobten noch
Kinder waren, that nach damaligen Anschauungen der Giltig-
keit des Vertrags keinen Eintrag. Burgund wurde der
Töchter Otto's als Mitgift verschrieben und kam so unter die
Verwaltung Philipp's IV. Der Graf von Bretagne wurde
gleichfalls bewogen, sich unter Philipp's Oberhoheit zu stellen,
als Letzterer sich bereit erklärte, die Bretagne zu einem Herzog-
thum zu erheben und des Grafen Enkel an eine Nichte des
französischen Königs zu verheirathen.. Jetzt griff England
zu den Waffen. Aber vergeblich suchte Eduard I. in Ver-
bindung mit dem Grafen Veit von Flandern dem zielbewußten
Franzosen die Beute wieder abzujagen. Philipp siegte in
den Treffen bei Comines und Furnes und eroberte Lille,
Kortryk und Brügge. Eduard I., dem die wilden Schotten
ohnehin genug zu schaffen machten, sah sich außer Stande,
den Krieg mit Frankreich fortzuführen, er kehrte nach Eng-
land zurück, worauf Philipp auch Flandern besetzte. Mit
dem deutschen König Albrecht endlich einigte er sich über
Burgund durch eine Heirath zwischen seiner Schwester Blanka
und dem Königssohne Rudolph. Großes war in kurzer Zeit
durch dis Klugheit und Tapferkeit des Königs gewonnen
worden, aber das Volk hatte natürlich schwere Opfer bringen
müssen, und auch die Geistlichkeit war zur Besteuerung
herangezogen worden. Dadurch kam Philipp IV. in heftigen
Zwist mit Papst Bonifazius VIII. Der Papst sprach gegen
Philipp den Bann aus und war im Begriff, das französische
Volk von dem geleisteten Treueid zu entbinden und Philipp
feierlich als des Thrones entsetzt zu erklären, als der französische
König ihm durch einen Gewaltstreich zuvorkam. Einer der
Staatsräthe von Paris, Wilhelm Nogaret, und der Kardinal
Colonna begaben sich nach Italien und brachten daselbst,
kein Geld sparend, einige hundert Verschworene zusammen,
um gegen Bonifazius, der in seiner Geburtsstadt Anagni
weilte, einen Handstreich auszuführen. In der Nacht vom
7. auf den 8. September 1303 drangen sie in Anagni ein
mit dem Rufe: „Tod dem Papste Bonifazius! Es lebe König
Philipp!", machten die Verwandten, Anhänger und Diener
des Kirchenfürsten, die im Dome und im Palaste des Papstes
tapferen Widerstand leisteten, nieder und stürzten dann mit
entblößten Schwertern durch die Zimmer und Gänge. Boni-
fazius erwartete, angethan mit den pontisikalen Gewändern,
sitzend auf seinem Throne, auf dem Haupte die Tiara, in den
Händen Schlüssel und Stab, die Wüthenden. Er war auf
den Tod gefaßt. Bald brachen die Thüren unter dem An-
sturm, und die Rotte stürmte in das Gemach. Man über-
häufte den Statthalter Christi mit Schmähungen, verhöhnte
^ihn und drohte, ihn in Ketten nach Lyon zu führen. Diesen
Vorgang gibt unser Bild auf S. 61 wieder. Die hoheits-
volle Ruhe des weißbärtigen Greises jedoch entwaffnete die
Feinde. Sie schonten sein Leben und schlossen ihn ein. Drei
Tage blieb er in der Gemalt der Verschworenen, bis ihn die
Bürger von Anagni befreiten. Bonifazius eilte nach Nom,
überlebte aber die Aufregungen dieses Vorfalls nicht lange.
Er starb bereits fünf Wochen später und ihm folgte Papst
Clemens V., der sich mit Philipp einigte. Letzterer starb
ebenfalls bereits 1314, nachdem er die französische Monarchie
mit List und Gewalt in einer bis dahin unerhörten Weise
gekräftigt und befestigt hatte.
Trappenjagd.
(Siehe das Bild auf Seite 65.)
"7>ie mit Ausnahme Amerikas in allen Erdtheilen vorkom-
menden Trappen sind große, schwerleibige Stelzvögel mit
starken Beinen und dreizehigen Füßen. Die Großtrappe,
zum Unterschied von der Zwergtrappe so geheißen, wird
über 1 Meter lang, während die Breite 2,2 bis 2,4 Meter,
die Fittichelänge bis 70 Centimeter, die Schwanzlänge 28 Centi-
meter, das Gewicht 15 bis 16 Kilogramm beträgt Die Trappe
ist unser größter Landvogel; das Männchen wird gekennzeichnet
durch einen Bart aus etwa 30 zarten grauweißen Federn,
der dem Weibchen fehlt, das auch merklich kleiner ist. Die
Trappe wird zur sogenannten hohen Jagd gezählt und überall
eifrig gejagt, läßt sich aber wegen ihres Mißtrauens und ihrer
Scheuheit nur schwer erlegen. Die vielbegehrten Vögel wittern
den Jäger, auch wenn er, um sie zu täuschen, Frauenkleider an-
legt, und fliehen ängstlich vor dem Reiter wie vor dem Fuß-
gänger. Ehedem suchte man sie mit einer sogenannten Karren-
büchse zu erlegen; es war das eine Art Höllenmaschine, die aus
neun verbundenen Büchsenrohren bestand und gleichzeitig neun
Kugeln abseuerte, sich aber ihrer Schwere wegen auch nur
von einem Wagen aus handhaben ließ. Später bediente man
sich zur Trappenjagd eines Bauernwagens, der rundum mit
Strohgarben bekleidet war, hinter denen sich die Jäger ver-
steckten. Ein Knecht in ländlicher Tracht mußte den Wagen
auf die weidenden Trappenheerden zusahren und in passender
Nähe plötzlich anhalten. Dann feuerte man so rasch wie
möglich auf die stärksten Hähne, doch glückte es keineswegs
in allen Füllen, das scheue Wild auf diese Art zu täuschen.
In Asien beizt man die Trappen mit Edelfalken oder ge-
zähmten Steinadlern, in den südrussischen Steppen werden sie
vielfach gehetzt. Namentlich die asow'schen Kosaken huldigen
diesem Sport mit Vorliebe, und zwar in der aus unserem
Bilde S- 65 dargestellten Weise. „Die eigentlichen Treib-
jagden beginnen," wie Masius berichtet, „erst im Spätherbst.
Dann ist der Vogel am fettesten, zugleich sammelt er sich
allmälig in größeren Heerden. Wenn dann nach zwei bis
drei Regentagen plötzlich Külte eintritt, schwingt sich der
Kosak auf's Pferd und eilt, mit seiner Nagaika — einem
Wurfstabe, in dem oben eine Bleikugel steckt — bewaffnet, in
die Steppe. Die Zeit ist gut gewählt, denn die regendurch-
näßten und dann im Froste mit einer Eiskruste überzogenen
Flügel versagen jetzt dem Vogel den Dienst, und er ist allein
auf seine Füße angewiesen. Vis zum Horizont dehnt sich
die Steppe, nur hier und da von gefrorenen Wasserspiegeln
unterbrochen; ein grauer, durchsichtiger Nebel schwebt darüber
„Wir sind fertig, Herr Graf," warf Don Pasquale
ein. „Ich war auf dem Punkte, mich zu verabschieden.
Ich wünschte nur noch von Ihrem Herrn Vater zu
hören, ob er mit mir einverstanden ist."
„Vollständig, mein lieber Don PasquaP" ant-
wortete dieser; „vollständig. Handeln Sie ganz nach
Ihrem Ermessen."
„Ich danke Ihnen, Herr Graf, und ziehe mich nun
zurück, da ich auch meinerseits die Herren nicht stören
möchte."
Dabei gab er dem Grasen Tito die Hand, man
wußte nicht recht, ob aus Dankbarkeit für seine Zu-
stimmung oder zum Abschied, machte dem Grafen
Severo eine stumme Verbeugung, die dieser ebenso er-
wiederte, und ging fort.
Auch nachdem Vater und Sohn allein waren, wollte
eine Unterhaltung nicht sogleich in Gang kommen. Graf
Tito setzte sich mühsam und langsam "auf eine Chaise-
longue, rückte sich die Kissen zurecht, sah eine Weile
nachdenklich vor sich hin, worüber eine ziemliche Zeit
verging, während welcher sein Sohn, ganz von seinen
Gedanken in Anspruch genommen, am Fenster stand
und auf die Straße starrte.
„Was wollte der Rechtsanwalt?" fragte endlich
Severo, wie aus seinen Gedanken aufwachend.
„Nichts," sagte sein Vater langsam, „eine Geschäfts-
sache!" , '
Wieder trat eine nachdenkliche Pause ein.
„Und Du?" begann dann Graf Tito.
„In, Papa," sagte sein jüngster Sohn seufzend,
„das wäre allerdings fchon etwas Anderes als eine Ge-
schäftssache, und wenn ich sicher wäre, Dich bei guter
Laune, bei ganz guter Laune zu treffen —"
„Nun heraus damit! Was ist's? Brauchst Du Geld?"
Severo lachte. „Nein," antwortete er, „das ist es
heute ausnahmsweise nicht, was mich zu Dir führt.
Ich wollte vielmehr einmal mit Dir darüber reden,
wie Du Dir meine Zukunft denkst, Papa. Du weißt,
ich werde bald fünfundzwanzig Jahre. Das erste Viertel-
jahrhundert ist dann voll."
„Nun, und was weiter? Wie ich über Deine Zu-
kunft denke, darüber, sollte ich meinen, müßtest Du
längst im Klaren fein. Du wirst nach Beendigung
Deiner theoretischen Studien hier in Rom auf unsere
Güter in der Romagna gehen, um dort die Landwirth-
schaft auch praktisch zu erlernen, und ich kann nur
wünschen, daß Dein praktisches Studium gründlicher
und sorgfältiger ausfalle, als Dein theoretisches. So-
viel ich sehe, verlegst Du Deine Studien in Rom viel
zu sehr in Kaffeehäuser und Theater, als daß sie er-
sprießlich ausfallen könnten."
Auch jetzt lächelte Graf Severo. Er mar an solche
kleine Ausfälle feines Vaters längst gewöhnt. Er be-
trieb seine wissenschaftliche Ausbildung, wie fast alle
seine Standesgenossen, als Nebensache. Die Hauptsache
waren ihm die hauptstädtischen Vergnügungen.
„Ich war auf eine solche Standrede gefaßt," sagte
er endlich, „Du weißt, ich lasse solche immer geduldig
über mich ergehen. Aber heute handelt es sich wirklich
um etwas Anderes. Ich gebe Dir mein Wort, daß
ich mit der Zeit doch noch ein tüchtiger Landmirth
werden will, aber damit ich das kann, damit ich von
den Vergnügungen der jungen Leute abgezogen werde
und mich gesammelter, ernster und auch fröhlicher diesen
Studien widmen kann, erscheint es mir nothwendiger
denn je, daß ich mich — nun, daß ich mich glücklich
verheirathe."
„Verheirathe?" fragte sein Vater etwas überrascht
und erstaunt.
„Ja, Papa, und darüber möchte ich Deine Antwort
oder Deine Ansicht hören."
„Nun, Severo," sagte sein Vater nach einer kleinen,
nachdenklichen Pause, „ich habe gewiß nichts gegen
Deine Verheirathung einzuwenden und werde mit Freuden
bereit sein, Dich in die Lage zu setzen, eine standes-
gemäße Ehe einzugehen —"
„Ich sprach von einer glücklichen Verheirathung."
„Ganz recht, davon spreche ich auch. Eine glückliche
Ehe kann nur eine standesgemäße sein."
„Ich hätte nicht gedacht, daß Du in dieser Beziehung
eine so ausschließende Ansicht habest. Du selbst —"
„Gerade weil ich selbst in meinen jüngeren Jahren
so thöricht war, Severo, eine Mißheirath einzugehen,
eine Frau zu heirathen, die weder ihre noch meine
Stellung zu würdigen oder auch uur zu achten ver-
stand, gerade deshalb weiß ich von der Sache mehr
als irgend ein Anderer. — Severo," fuhr er mit einem
tiefen Seufzer fort, „sieh mich an! Diese Haare sind
vor der Zeit gebleicht, diese Glieder vor der Zeit hin-
fällig und krank geworden — durch Deine Mutter!"
(Fortsetzung folgt.)
Liebesorakel.
(Tiehe das Bild auf Teile 57 )
^keder macht sie durch, die süße Pein und die selige Qual
des Liebens und Verliebtseins. Kein Sterblicher ist so
gewappnet und gepanzert mit kühler Ueberlegung und Ver-
Das Vu ch f i'l r Alle.
mufft, daß nicht einmal ein Pfeil des Liebesgottes eine
schwache Stelle finden könnte, wo er eindringt. Die größten
Dichter und Denker, die berühmtesten Weisen lind dis klügsten
Menschen haben die Liebe für eine Thorheit, für nichtig, für
einen Rausch erklärt; das hilft aber gar nichts. Die Jugend
liebt und verliebt sich, und das Alter schützt am wenigsteil
vor dieser Thorheit. Was wäre auch schließlich das Leben
ohne diesen Zauberschimmer, der alles Finstere und Trübe,
alles Herbe und Nüchterne, die ganze harte Wirklichkeit unseres
Daseins mit seinem Rosenschein umkleidet und verschönert.
Unsere Illustration auf S. 57 — nach einem Gemälde
von E. Klinisch — stellt ein schönes junges Mädchen dar,
dem auch dieser Hoffnungs- und Glücksstern des Lebens auf-
gegangen ist. Es ist ihr so selig wohl und doch so weh um's
Herz. Bange Zweifel erfüllen ihre Brust, denn sie ist keines-
wegs sicher, ob ihre Liebe Erwiederung findet, und diese Frage
scheint ihr das Wichtigste jetzt auf der Welt. Zwar hat er
sich so galant und liebenswürdig ihr gegenüber benommen.
Er hat sie bei dem Gartenfest, wo ja viel schönere Mädchen
als sie zugegen waren, so sichtbar ausgezeichnet, daß es sogar
auffiel — aber ob das nicht nur eine vorübergehende Laune
mar, ob er nicht nur angeregte Unterhaltung und Zerstreuung
bei dieser Bevorzugung suchte? Das ist die schwerwiegende
Frage, dis Luisens Herz jetzt bedrückt. Da greift sie nach
dem volksthümlichen Liebesorakel. Der Grasentochter wie dem
ärmsten Bauernmädchen ist es bekannt, sie vertrauen ihm in
gleicher Weise, und in gleichen Zweifeln wenden Alle es an.
Sie zählt die Blätter der Hundskamille nicht mit Zahlen,
sondern nach der Formel: „Er liebt mich, er liebt mich
nicht" u. s. w. und zupft sie ab. Sie ist glücklich, wenn dies
Blumenorakel verkündet: „Er liebt dich!", und nur zu gern
glaubt sie diesem Orakelspruch.
Vor dem Schulgong.
Tka, die Schule, die Schule! Mit dieser beginnt der Ernst
des Lebens für die Kleinen. Vorbei ist es mit der
Unbegrenztheit der Zeit, mit der unbeschränkten Freiheit des
Spielens und Genießens, wenn der erste Gang zur Schule
angetreten wird. Da heißt es, zur bestimmten Zeit wach
sein und aus dem Bett steigen, und nun geht es nicht mehr
zum Spielen, zum Herumstreifen in Feld und Wald. Nein,
jetzt muß man sauber gewaschen und angezogen sein, die
Haare schön gekämmt haben, eine Jacke anziehen und ruhig in
die Schule gehen — das ist keine Kleinigkeit. Auf unserem
Bilde S. 00, nach einem Gemälde des berühmten Tiroler
Meisters F. Defregger, sehen wir ein derartiges ernstes Werk
sich bereiten. Der kleine Paul und sein Schwesterchen be-
suchen die Dorfschule. Zwar macht ihnen das Frühaufstehen
keine Mühe — aber das Ankleiden ist eine böse Sache.
Es soll Alles so ordentlich sitzen, die Knöpfe müssen zugemacht
sein, der Strumpf darf ohne Strumpfband nicht getragen
werden, und die Füße müssen in Schuhen stecken. Früher
war es doch viel bequemer: man ging barfuß — man sprang
aus dem Bett und war gleich fertig zum Lausen. Jetzt geht
das nicht mehr. Der Herr Lehrer läßt" keinen Barfüßigen zu,
sie müßten denn sehr arm sein — und das sind Paul und
Afra nicht, und deshalb heißt es Schuhe und Strümpfe an-
ziehen. Das können die Kleinen noch nicht selbst besorgen,
das muß die Mutter thun, und dabei muß still gesessen
werden. Das ist die erste Geduldsprobe. Entweder muß
Afra warten, bis Paul fertig ist, oder dieser sich gedulden, bis
sein kleines Schwesterlein in Schuh und Strümpfen steht,
und wie lange dauert das! Die Blutter beeilt sich zwar so
viel als möglich, aber sie macht doch Alles sorgfältig und gut.
Das Stillsitzen ist schon nicht erheiternd, aber das Schlimmste
ist doch der Gedanke an die Schule, wenn die Halisarbeiten
nicht recht gelungen sind, die Buchstaben gar zu schief und
! krumm stehen, oder die Rechnung nicht stimmt, oder der Vers
I nicht recht ordentlich im Kopf ist. Dem gegenüber ist das
längste Stiefelanziehen noch eine Wohlthat, und der kleine
Paul wünscht mitunter, daß es den ganzen Vormittag dauerte.
Ver Aekerfoll von Anogni.
(Siehe das Bild auf Seite 61.)
^m Jahre 1285 bestieg Philipp IV., von seinen Zeitgenossen
der Schöne genannt, den französischen Thron. Trotz seiner
Jugend — er war erst siebzehn Jahre alt — wußte er nicht
nur mit kühnem Unternehmungsgeist, sondern mit der Ueber-
legung und Klugheit des gereiften Mannes auf die Macht-
vergrößerung seiner Krone und die Befriedigung seines
Herrscherstolzes hinzuarbeiten. In der Beseitigung von Hinder-
nissen, die sich ihm bei diesem Beginne entgegenstellten,
kannte er keine Schonung, und außer seinem persönlichen
Ruhm war ihm nur die Wohlfahrt und Größe seines Reiches
und Volkes maßgebend. Da damals noch französische Ge-
biete unter fremder Hoheit waren, wenngleich diese fremden
Fürsten durch einen Huldigungsakt den französischen König
als Oberherrn anerkennen mußten, so war es Philipp's erste
Sorge, dieses Verhältniß des Scheins und der Täuschung,
sei es mit Waffengewalt, sei es auf dem Wege der List rind
des Vertrages, zu beseitigen. Es gelang ihm denn auch,
das Herzogthum Guienne, welches König Eduard I. von Eng-
land als Lehensmann Frankreichs besaß, trotz aller Gegen-
anstrengungen des englischen Monarchen binnen dreier Jahre
in die "Gewalt zu bekommen. Auf Grund der Weigerung
Eduard's, sich zur persönlichen Huldigung in Paris zu stellen,
besetzte Philipp das Herzogthum, und was Eduard auch aus-
bot, um wieder in den Besitz des Landes zu gelangen, es
war vergebens. Die Klugheit und Thatkraft Philipp's
triumphirle; es wurde ein Vertrag geschlossen, der durchaus
den französischen Wünschen entsprach. Nun richtete Philipp
sein Augenmerk ans Burgund, das deutsches Neichslehen war.
63
Er setzte es durch, daß im Jahre 1295 Graf Otto von Burgund
durch den Vertrag von Vincennes seine einzige Tochter mit
einem Sohne Philipp's verlobte. Daß die Verlobten noch
Kinder waren, that nach damaligen Anschauungen der Giltig-
keit des Vertrags keinen Eintrag. Burgund wurde der
Töchter Otto's als Mitgift verschrieben und kam so unter die
Verwaltung Philipp's IV. Der Graf von Bretagne wurde
gleichfalls bewogen, sich unter Philipp's Oberhoheit zu stellen,
als Letzterer sich bereit erklärte, die Bretagne zu einem Herzog-
thum zu erheben und des Grafen Enkel an eine Nichte des
französischen Königs zu verheirathen.. Jetzt griff England
zu den Waffen. Aber vergeblich suchte Eduard I. in Ver-
bindung mit dem Grafen Veit von Flandern dem zielbewußten
Franzosen die Beute wieder abzujagen. Philipp siegte in
den Treffen bei Comines und Furnes und eroberte Lille,
Kortryk und Brügge. Eduard I., dem die wilden Schotten
ohnehin genug zu schaffen machten, sah sich außer Stande,
den Krieg mit Frankreich fortzuführen, er kehrte nach Eng-
land zurück, worauf Philipp auch Flandern besetzte. Mit
dem deutschen König Albrecht endlich einigte er sich über
Burgund durch eine Heirath zwischen seiner Schwester Blanka
und dem Königssohne Rudolph. Großes war in kurzer Zeit
durch dis Klugheit und Tapferkeit des Königs gewonnen
worden, aber das Volk hatte natürlich schwere Opfer bringen
müssen, und auch die Geistlichkeit war zur Besteuerung
herangezogen worden. Dadurch kam Philipp IV. in heftigen
Zwist mit Papst Bonifazius VIII. Der Papst sprach gegen
Philipp den Bann aus und war im Begriff, das französische
Volk von dem geleisteten Treueid zu entbinden und Philipp
feierlich als des Thrones entsetzt zu erklären, als der französische
König ihm durch einen Gewaltstreich zuvorkam. Einer der
Staatsräthe von Paris, Wilhelm Nogaret, und der Kardinal
Colonna begaben sich nach Italien und brachten daselbst,
kein Geld sparend, einige hundert Verschworene zusammen,
um gegen Bonifazius, der in seiner Geburtsstadt Anagni
weilte, einen Handstreich auszuführen. In der Nacht vom
7. auf den 8. September 1303 drangen sie in Anagni ein
mit dem Rufe: „Tod dem Papste Bonifazius! Es lebe König
Philipp!", machten die Verwandten, Anhänger und Diener
des Kirchenfürsten, die im Dome und im Palaste des Papstes
tapferen Widerstand leisteten, nieder und stürzten dann mit
entblößten Schwertern durch die Zimmer und Gänge. Boni-
fazius erwartete, angethan mit den pontisikalen Gewändern,
sitzend auf seinem Throne, auf dem Haupte die Tiara, in den
Händen Schlüssel und Stab, die Wüthenden. Er war auf
den Tod gefaßt. Bald brachen die Thüren unter dem An-
sturm, und die Rotte stürmte in das Gemach. Man über-
häufte den Statthalter Christi mit Schmähungen, verhöhnte
^ihn und drohte, ihn in Ketten nach Lyon zu führen. Diesen
Vorgang gibt unser Bild auf S. 61 wieder. Die hoheits-
volle Ruhe des weißbärtigen Greises jedoch entwaffnete die
Feinde. Sie schonten sein Leben und schlossen ihn ein. Drei
Tage blieb er in der Gemalt der Verschworenen, bis ihn die
Bürger von Anagni befreiten. Bonifazius eilte nach Nom,
überlebte aber die Aufregungen dieses Vorfalls nicht lange.
Er starb bereits fünf Wochen später und ihm folgte Papst
Clemens V., der sich mit Philipp einigte. Letzterer starb
ebenfalls bereits 1314, nachdem er die französische Monarchie
mit List und Gewalt in einer bis dahin unerhörten Weise
gekräftigt und befestigt hatte.
Trappenjagd.
(Siehe das Bild auf Seite 65.)
"7>ie mit Ausnahme Amerikas in allen Erdtheilen vorkom-
menden Trappen sind große, schwerleibige Stelzvögel mit
starken Beinen und dreizehigen Füßen. Die Großtrappe,
zum Unterschied von der Zwergtrappe so geheißen, wird
über 1 Meter lang, während die Breite 2,2 bis 2,4 Meter,
die Fittichelänge bis 70 Centimeter, die Schwanzlänge 28 Centi-
meter, das Gewicht 15 bis 16 Kilogramm beträgt Die Trappe
ist unser größter Landvogel; das Männchen wird gekennzeichnet
durch einen Bart aus etwa 30 zarten grauweißen Federn,
der dem Weibchen fehlt, das auch merklich kleiner ist. Die
Trappe wird zur sogenannten hohen Jagd gezählt und überall
eifrig gejagt, läßt sich aber wegen ihres Mißtrauens und ihrer
Scheuheit nur schwer erlegen. Die vielbegehrten Vögel wittern
den Jäger, auch wenn er, um sie zu täuschen, Frauenkleider an-
legt, und fliehen ängstlich vor dem Reiter wie vor dem Fuß-
gänger. Ehedem suchte man sie mit einer sogenannten Karren-
büchse zu erlegen; es war das eine Art Höllenmaschine, die aus
neun verbundenen Büchsenrohren bestand und gleichzeitig neun
Kugeln abseuerte, sich aber ihrer Schwere wegen auch nur
von einem Wagen aus handhaben ließ. Später bediente man
sich zur Trappenjagd eines Bauernwagens, der rundum mit
Strohgarben bekleidet war, hinter denen sich die Jäger ver-
steckten. Ein Knecht in ländlicher Tracht mußte den Wagen
auf die weidenden Trappenheerden zusahren und in passender
Nähe plötzlich anhalten. Dann feuerte man so rasch wie
möglich auf die stärksten Hähne, doch glückte es keineswegs
in allen Füllen, das scheue Wild auf diese Art zu täuschen.
In Asien beizt man die Trappen mit Edelfalken oder ge-
zähmten Steinadlern, in den südrussischen Steppen werden sie
vielfach gehetzt. Namentlich die asow'schen Kosaken huldigen
diesem Sport mit Vorliebe, und zwar in der aus unserem
Bilde S- 65 dargestellten Weise. „Die eigentlichen Treib-
jagden beginnen," wie Masius berichtet, „erst im Spätherbst.
Dann ist der Vogel am fettesten, zugleich sammelt er sich
allmälig in größeren Heerden. Wenn dann nach zwei bis
drei Regentagen plötzlich Külte eintritt, schwingt sich der
Kosak auf's Pferd und eilt, mit seiner Nagaika — einem
Wurfstabe, in dem oben eine Bleikugel steckt — bewaffnet, in
die Steppe. Die Zeit ist gut gewählt, denn die regendurch-
näßten und dann im Froste mit einer Eiskruste überzogenen
Flügel versagen jetzt dem Vogel den Dienst, und er ist allein
auf seine Füße angewiesen. Vis zum Horizont dehnt sich
die Steppe, nur hier und da von gefrorenen Wasserspiegeln
unterbrochen; ein grauer, durchsichtiger Nebel schwebt darüber