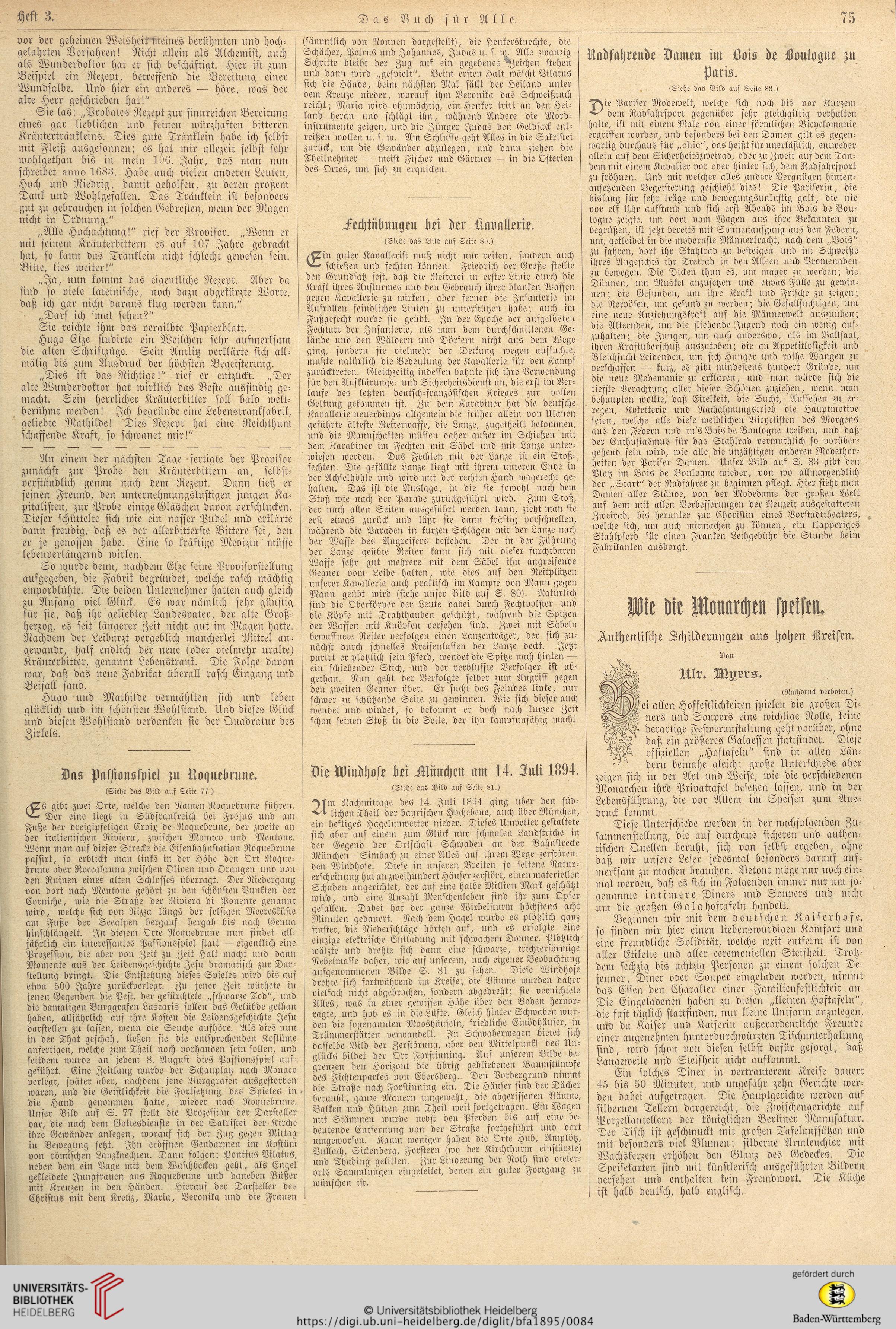Heft 3.
75
vor der geheimen Weisheit meines berühmten nnd hoch- ;
gelahrten Vorfahren! Nicht allein als Alchemist, auch
als Wunderdoktor hat er sich beschäftigt. Hier ist zum
Beispiel ein Rezept, betreffend die Bereitung einer
Wundsalbe. And hier ein anderes — höre, was der
alte Herr geschrieben hat!"
Sie las: „Probates Rezept zur sinnreichen Bereitung
eines gar lieblichen und feinen würzhaften bitteren
Kräutertrünkleins. Dies gute Tränklein habe ich selbst
mit Fleiß ausgesonnen; es hat mir allezeit selbst sehr
wohlgethan bis in mein 106. Jahr, das man nun
schreibet anno 1683. Habe auch vielen anderen Leuten,
Hoch und Niedrig, damit geholfen, zu deren großem
Dank und Wohlgefallen. Das Tränklein ist besonders
gut zu gebrauchen in solchen Gebresten, wenn der Magen
nicht in Ordnung."
„Alle Hochachtung!" rief der Provisor. „Wenn er
mit seinem Kräuterbittern es auf 107 Jahre gebracht
hat, so kann das Trünklein nicht schlecht gewesen sein.
Bitte, lies weiter!"
„Ja, nun kommt das eigentliche Rezept. Aber da
sind so viele lateinische, noch dazu abgekürzte Worte,
daß ich gar nicht daraus klug werden kann."
„Darf ich 'mal sehen?"
L>ie reichte ihm das vergilbte Papierblatt.
Hugo Elze studirte ein Weilchen sehr aufmerksam
die alten Schriftzüge. Sein Antlitz verklärte sich all-
mälig bis zum Ausdruck der höchsten Begeisterung.
„Dies ist das Richtige!" rief er entzückt. „Der
alte Wunderdoktor hat wirklich das Beste ausfindig ge-
macht. Sein herrlicher Krüuterbitter soll bald welt-
berühmt werden! Ich begründe eine Lebenstrankfabrik,
geliebte Mathilde! Dies Rezept hat eine Reichthum
schaffende Kraft, so schwnnet mir!"
An einem der nächsten Tage fertigte der Provisor
zunächst zur Probe den Kräuterbittern an, selbst-
verständlich genau nach dem Rezept. Dann ließ er
seinen Freund, den unternehmungslustigen jungen Ka-
pitalisten, zur Probe einige Gläschen davon verschlucken.
Dieser schüttelte sich wie ein nasser Pudel und erklärte
dann freudig, daß es der allerbitterste Bittere sei, den
er je genossen habe. Eine so kräftige Medizin müsse
lebenverlängernd wirken.
So wurde denn, nachdem Elze seine Provisorstellung
aufgegeben, die Fabrik begründet, welche rasch mächtig
emporblühte. Die beiden Unternehmer hatten auch gleich
zu Anfang viel Glück. Es war nämlich sehr günstig
für sie, daß ihr geliebter Landesvater, der alte Groß-
herzog, es seit längerer Zeit nicht gut im Magen hatte.
Nachdem der Leibarzt vergeblich mancherlei Mittel an-
gewandt, half endlich der neue (oder vielmehr uralte)
Kräuterbitter, genannt Lebenstrank. Die Folge davon
war, daß das neue Fabrikat überall rasch Eingang und
Beifall fand.
Hugo und Mathilde vermählten sich und leben
glücklich und im schönsten Wohlstand. Und dieses Glück
und diesen Wohlstand verdanken sie der Quadratur des
Zirkels.
Das Passllmsspie! zu ttoquebrune.
(Siehe das Bild auf Seite 77.)
/^s gibt zwei Orte, welche den Namen Roquebrune führen.
Der eine liegt in Südfrankreich bei Fröjus und am
Fuße der dreigipfeligen Croix de Roquebrune, der zweite an
der italienischen Riviera, zwischen Monaco und Mentone.
Wenn man aus dieser Strecke die Eisenbahnstation Roquebrune
passirt, so erblickt man links in der Höhe den Ort Roque-
brune oder Roccabruna zwischen Oliven und Orangen und von
den Ruinen eines alten Schlosses überragt. Der Niedergang
von dort nach Mentone gehört zu den schönsten Punkten der
Corniche, wie die Straße der Riviera di Ponente genannt
wird, welche sich von Nizza längs der felsigen Meeresküste
am Fuße der Seealpen bergauf bergab bis nach Genua
hinschlängelt. In diesem Orte Roquebrune nun findet all-
jährlich ein interessantes Passionsspiel statt — eigentlich eine
Prozession, die aber von Zeit zu Zeit Halt macht und dann
Momente aus der Leidensgeschichte Jesu dramatisch zur Dar-
stellung bringt. Die Entstehung dieses Spieles wird bis auf
etwa 500 Jahre zurückverlegt. Zu jener Zeit wüthete in
jenen Gegenden die Pest, der gefürchtete „schwarze Tod", und
die damaligen Burggrafen Lascaris sollen das Gelübde gethan
haben, alljährlich auf ihre Kosten die Leidensgeschichte Jesu
darstellen zu lassen, wenn die Seuche aufhöre. Als dies nun
in der That geschah, ließen sie die entsprechenden Kostüme
anfertigen, welche zum Theil noch vorhanden sein sollen, und
seitdem wurde an jedem 8. August dies Passionsspiel auf-
geführt. Eine Zeitlang wnrde der Schauplatz nach Monaco
verlegt, später aber, nachdem jene Burggrafen ausgestorben
waren, und die Geistlichkeit die Fortsetzung des Spieles in
die Hand genommen hatte, wieder nach Roquebrune.
Unser Bild aus S. 77 stellt die Prozession der Darsteller
dar, die nach dem Gottesdienste in der Sakristei der Kirche
ihre Gewänder anlegen, worauf sich der Zug gegen Mittag
in Bewegung fetzt. Ihn eröffnen Gendarmen im Kostüm
von römischen Lanzknechten. Dann folgen: Pontius Pilatus,
neben dem ein Page mit dem Waschbecken geht, als Engel
gekleidete Jungfrauen aus Roquebrune und daneben Büßer
mit Kreuzen in den Händen. Hierauf der Darsteller des
Christus mit dem Kreuz, Maria, Veronika und die Frauen
Dns Bu ch für All e.
(sümmtlich von Nonnen dargestellt), die Henkersknechte, die
Schächer, Petrus und Johannes, Judas u. s. w.. Alle zwanzig
Schritte bleibt der Zug auf ein gegebenes ^Zeichen stehen
und dann wird „gespielt". Beim ersten Halt wäscht Pilatus
sich die Hände, beim nächsten Mal fällt der Heiland unter
dem Kreuze nieder, worauf ihm Veronika das Schweißtuch
reicht; Marin wird ohnmächtig, ein Henker tritt an den Hei-
land heran und schlägt ihn, während Andere die Mord-
instrumente zeigen, und die Jünger Jndas den Geldsack ent-
reißen wollen u. s. w. Am Schlüsse geht Alles in die Sakristei
zurück, um die Gewänder abzulegen, und dann ziehen die
Theilnehmer — meist Fischer und Gärtner — in die Osterien
des Ortes, um sich zu erquicken.
Fechtübungell bei der Kavallerie.
(Siehe das Bild auf Seite 80.)
/<?in guter Kavallerist muß nicht nur reiten, sondern mich
schießen und fechten können. Friedrich der Große stellte
den Grundsatz fest, daß die Reiterei in erster Linie durch die
Kraft ihres Ansturmes und den Gebrauch ihrer blanken Waffen
gegen Kavallerie zu wirken, aber ferner die Infanterie in:
Aufrollen feindlicher Linien zu unterstützen habe; auch im
Fußgefecht wurde sie geübt. In der Epoche der aufgelösten
Fechtart der Infanterie, als man dem durchschnittenen Ge-
lände und den Wäldern und Dörfern nicht aus dem Wege
ging, sondern sie vielmehr der Deckung wegen aufsuchte,
mußte natürlich die Bedeutung der Kavallerie für den Kampf
zurücktreten. Gleichzeitig indessen bahnte sich ihre Verwendung
für den Aufklärungs- und Sicherheitsdienst an, die erst im Ver-
laufe des letzten deutsch-französischen Krieges zur vollen
Geltung gekommen ist. Zu dem Karabiner hat die deutsche
Kavallerie neuerdings allgemein die früher allein von Ulanen
geführte älteste Neiterwaffe, die Lanze, zugetheilt bekommen,
und die Mannschaften müssen daher außer im Schießen mit
dem Karabiner im Fechten mit Säbel und mit Lanze unter-
wiesen werden. Das Fechten mit der Lanze ist ein Stoß-
fechten. Die gefällte Lanze liegt mit ihrem unteren Ende in
der Achselhöhle und wird mit der rechten Hand wagerecht ge-
halten. Das ist die Auslage, in die sie sowohl nach dem
Stoß wie nach der Parade zurückgeführt wird. Zum Stoß,
der nach allen Seiten ausgeführt werden kann, zieht man sie
erst etwas zurück und läßt sie dann kräftig vorschnellen,
während die Paraden in kurzen Schlägen nut der Lanze nach
der Waffe des Angreifers bestehen. Der in der Führung
der Lanze geübte Reiter kann sich mit dieser furchtbaren
Waffe sehr gut mehrere mit dem Säbel ihn angreifende
Gegner vom Leibe halten, wie dies auf den Reitplätzen
unserer Kavallerie auch praktisch im Kampfe von Mann gegen
Mann geübt wird (siehe unser Bild auf S. 80). Natürlich
find die Oberkörper der Leute dabei durch Fechtpolfter und
die Köpfe mit Drahthauben geschützt, während die Spitzen
der Waffen mit Knöpfen versehen find. Zwei mit Säbeln
bewaffnete Reiter verfolgen einen Lanzentrüger, der sich zu-
nächst durch schnelles Kreisenlassen der Lanze deckt. Jetzt
parirt er plötzlich sein Pferd, wendet die Spitze nach hinten —
ein schiebender Stich, und der verblüffte Verfolger ist ab-
gethan. Nun geht der Verfolgte selber zum Angriff gegen
den zweiten Gegner über. Er sucht des Feindes linke, nur
schwer zu schützende Seite zu gewinnen. Wie sich dieser auch
wendet und windet, so bekommt er doch nach kurzer Zeit
schon seinen Stoß in die Seite, der ihn kampfunfähig macht.
Die Windhose bei München am 14. Juli 1894.
(Siehe das Bild auf Seite 81.)
^sm Nachmittage des 14. Juli 1894 ging über den süd-
lichen Theil der bayrischen Hochebene, auch über München,
ein heftiges Hagelunwetter nieder. Dieses Unwetter gestaltete
sich aber auf einem zum Glück nur schmalen Landstriche in
der Gegend der Ortschaft Schwaben an der Bahnstrecke
München—Simbach zu einer Alles auf ihrem Wege zerstören-
den Windhose. Diese in unseren Breiten so seltene Natur-
erscheinung hat an zweihundert Häuser zerstört, einen materiellen
Schaden angerichtet, der auf eine halbe Million Mark geschätzt
wird, und eine Anzahl Menschenleben sind ihr zum Opfer
gefallen. Dabei hat der ganze Wirbelsturm höchstens acht
Minuten gedauert. Nach dem Hagel wurde es plötzlich ganz
finster, die Niederschläge hörten auf, und es erfolgte eine
einzige elektrische Entladung mit schwachem Donner. Plötzlich
wälzte und drehte sich dann eine schwarze, trichterförmige
Nebelmafse daher, wie auf unserem, nach eigener Beobachtung
aufgenommenen Bilde S. 81 zu sehen. Diese Windhose
drehte sich fortwährend im Kreise; die Bäume wurden daher
vielfach nicht abgebrochen, sondern abgedreht; sie vernichtete
Alles, was in einer gewissen Höhe über den Boden hervor-
ragte, und hob es in die Lüfte. Gleich hinter Schwaben wur-
den die sogenannten Mooshäuseln, friedliche Einödhüuser, in
Trümmerstätten verwandelt. In Schwaberwegen bietet sich
dasselbe Bild der Zerstörung, aber den Mittelpunkt des Un-
glücks bildet der Ort Forstinning. Auf unserem Bilde be-
grenzen den Horizont die übrig gebliebenen Baumstümpfe
des Fichtenparkes von Ebersberg. Den Vordergrund nimmt
die Straße nach Forstinning ein. Die Häuser sind der Dächer
beraubt, ganze Mauern umgeweht, die abgerissenen Bäume,
Balken und Hütten zum Theil weit sortgetragen. Ein Wagen
mit Stämmen wurde nebst den Pferden bis auf eine be-
deutende Entfernung von der Straße fortgesührt und dort
umgeworfen. Kaum weniger haben die Orte Hub, Amplötz,
Pullach, Sickenberg, Forstern (wo der Kirchthurm einstürzte)
und Thading gelitten. Zur Linderung der Noth sind vieler-
orts Sammlungen eingeleitet, denen ein guter Fortgang zu
wünschen ist.
Nadfahrende Damen im Lois de Doulogne zu
Paris.
(Siehe diiS Bild auf Seite 83 )
"7>ie Pariser Modewelt, welche sich noch bis vor Kurzem
dem Radfahrsport gegenüber sehr gleichgiltig verhalten
hatte, ist mit einem Male von einer förmlichen Bicyclomanie
ergriffen worden, und besonders bei den Damen gilt es gegen-
wärtig durchaus für „oüio", das heißt für unerläßlich, entweder
allein auf dem Sicherheitszweirad, oder zu Zweit auf dem Tan-
dem mit einem Kavalier vor oder hinter sich, dem Radsahrsport
zu fröhnen. Und mit welcher alles andere Vergnügen hinten-
ansetzenden Begeisterung geschieht dies! Die Pariserin, die
bislang für sehr träge und bewegungsunlustig galt, die nie
vor elf Uhr aufstand und sich erst Abends im Bois de Bou-
logne zeigte, um dort vom Wagen aus ihre Bekannten zu
begrüßen, ist jetzt bereits mit Sonnenaufgang aus den Federn,
um, gekleidet in die modernste Männertracht, nach dem „Bois"
zu fahren, dort ihr Stahlrad zu besteigen und im Schweiße
ihres Angesichts ihr Tretrad in den Alleen und Promenaden
zu bewegen. Die Dicken thun es, um mager zu werden; die
Dünnen, um Muokel anzusetzen und etwas Fülle zu gewin-
nen; die Gesunden, um ihre Kraft und Frische zu zeigen;
die Nervösen, um gesund zn werden; die Gefallsüchtigen, um
eine neue Anziehungskraft auf die Männerwelt auszuüben;
die Alternden, um die fliehende Jugend noch ein wenig auf-
zuhalten; die Jungen, um auch anderswo, als im Ballsaal,
ihren Kraftüberschuß auszutoben; die an Appetitlosigkeit und
Bleichsucht Leidenden, um sich Hunger und rothe Wangen zu
verschaffen — kurz, es gibt mindestens hundert Gründe, um
die neue Modemanie zu erklären, und man würde sich die
tiefste Verachtung aller dieser Schönen zuziehen, wenn man
behaupten wollte, daß Eitelkeit, die Sucht, Aufsehen zu er-
regen, Koketterie und Nachahmungstrieb die Hauptmotive
seien, welche alle diese weiblichen Bicyclisten des Morgens
ans den Federn und in's Bois de Boulogne treiben, und daß
der Enthusiasmus für das Stahlrad vermuthlich so vorüber-
gehend sein wird, wie alle die unzähligen anderen Modethor-
heiten der Pariser Damen. Unser Bild auf S. 83 gibt den
Platz im Bois de Boulogne wieder, von wo allmorgendlich
der „Start" der Radfahrer zn beginnen pflegt. Hier sieht man
Damen aller Stände, von der Modedame der großen Welt
auf dem mit allen Verbesserungen der Neuzeit ausgestatteten
Zweirad, bis herunter znr Choristin eines Vorstadttheaters,
welche sich, um auch mitmachen zn können, ein klapperiges
Stahlpferd für einen Franken Leihgebühr die Stunde beim
Fabrikanten ansborgt.
Wie die Mmchen tzelsen.
Authentische Schilderungen aus hohen Kreisen.
Von
Mr. Myers.
(Nachdruck verboNn.)
ei allen Hosfestlichkeiten spielen die großen Di-
ners und Soupers eine wichtige Rolle, keine
derartige Festveranstaltung geht vorüber, ohne
daß ein größeres Galaessen stattfindet. Diese
offiziellen „Hostafeln" sind in allen Län-
dern beinahe gleich; große Unterschiede aber
zeigen sich in der Art und Weise, wie die verschiedenen
Monarchen ihre Privattasel besetzen lassen, nnd in der
Lebensführung, die vor Allem im Speisen zum Aus-
druck kommt.
Diese Unterschiede werden in der nachfolgenden Zu-
sammenstellung, die aus durchaus sicheren und authen-
tischen Quellen beruht, sich von selbst ergeben, ohne
daß wir unsere Leser jedesmal besonders darauf auf-
merksam zu machen brauchen. Betont möge nur noch ein-
mal werden, daß es sich im Folgenden immer nur um so-
genannte intimere Diners und Soupers und nicht
um die großen Galahoftafeln handelt.
Beginnen wir mit dem deutschen Kaiserhofe,
so finden nur hier einen liebenswürdigen Komfort und
eine freundliche Solidität, welche weit entfernt ist von
aller Etikette und aller ceremoniellen Steifheit. Trotz-
dem sechzig bis achtzig Personen zu einem solchen De-
jeuner, Diner oder Souper eingeladen werden, nimmt
das Essen den Charakter einer Familienfeftlichkeit an.
Die Eingeladenen haben zu diesen „kleinen Hoftafeln",
die fast täglich stattfinden, nur kleine Uniform anzulegen,
und da Kaiser und Kaiserin außerordentliche Freunde
einer angenehmen hnmordurchwürzten Tischunterhaltung
sind, wird schon von diesen selbst dafür gesorgt, daß
Langeweile und Steifheit nicht auskommt.
Ein solches Diner in vertrauterem Kreise dauert
45 bis 50 Minuten, und ungefähr zehn Gerichte wer-
den dabei aufgetragen. Die Hauptgerichte werden auf
silbernen Tellern dargereicht, die Zwischengerichte aus
Porzellantellern der königlichen Berliner Manufaktur.
Der Tisch ist geschmückt mit großen Tafelaufsätzen und
mit besonders viel Blumen; silberne Armleuchter mit
Wachskerzen erhöhen den Glanz des Gedeckes. Die
Speisekarten sind mit künstlerisch ausgeführten Bildern
versehen und enthalten kein Fremdwort. Die Küche
ist halb deutsch, halb englisch.
75
vor der geheimen Weisheit meines berühmten nnd hoch- ;
gelahrten Vorfahren! Nicht allein als Alchemist, auch
als Wunderdoktor hat er sich beschäftigt. Hier ist zum
Beispiel ein Rezept, betreffend die Bereitung einer
Wundsalbe. And hier ein anderes — höre, was der
alte Herr geschrieben hat!"
Sie las: „Probates Rezept zur sinnreichen Bereitung
eines gar lieblichen und feinen würzhaften bitteren
Kräutertrünkleins. Dies gute Tränklein habe ich selbst
mit Fleiß ausgesonnen; es hat mir allezeit selbst sehr
wohlgethan bis in mein 106. Jahr, das man nun
schreibet anno 1683. Habe auch vielen anderen Leuten,
Hoch und Niedrig, damit geholfen, zu deren großem
Dank und Wohlgefallen. Das Tränklein ist besonders
gut zu gebrauchen in solchen Gebresten, wenn der Magen
nicht in Ordnung."
„Alle Hochachtung!" rief der Provisor. „Wenn er
mit seinem Kräuterbittern es auf 107 Jahre gebracht
hat, so kann das Trünklein nicht schlecht gewesen sein.
Bitte, lies weiter!"
„Ja, nun kommt das eigentliche Rezept. Aber da
sind so viele lateinische, noch dazu abgekürzte Worte,
daß ich gar nicht daraus klug werden kann."
„Darf ich 'mal sehen?"
L>ie reichte ihm das vergilbte Papierblatt.
Hugo Elze studirte ein Weilchen sehr aufmerksam
die alten Schriftzüge. Sein Antlitz verklärte sich all-
mälig bis zum Ausdruck der höchsten Begeisterung.
„Dies ist das Richtige!" rief er entzückt. „Der
alte Wunderdoktor hat wirklich das Beste ausfindig ge-
macht. Sein herrlicher Krüuterbitter soll bald welt-
berühmt werden! Ich begründe eine Lebenstrankfabrik,
geliebte Mathilde! Dies Rezept hat eine Reichthum
schaffende Kraft, so schwnnet mir!"
An einem der nächsten Tage fertigte der Provisor
zunächst zur Probe den Kräuterbittern an, selbst-
verständlich genau nach dem Rezept. Dann ließ er
seinen Freund, den unternehmungslustigen jungen Ka-
pitalisten, zur Probe einige Gläschen davon verschlucken.
Dieser schüttelte sich wie ein nasser Pudel und erklärte
dann freudig, daß es der allerbitterste Bittere sei, den
er je genossen habe. Eine so kräftige Medizin müsse
lebenverlängernd wirken.
So wurde denn, nachdem Elze seine Provisorstellung
aufgegeben, die Fabrik begründet, welche rasch mächtig
emporblühte. Die beiden Unternehmer hatten auch gleich
zu Anfang viel Glück. Es war nämlich sehr günstig
für sie, daß ihr geliebter Landesvater, der alte Groß-
herzog, es seit längerer Zeit nicht gut im Magen hatte.
Nachdem der Leibarzt vergeblich mancherlei Mittel an-
gewandt, half endlich der neue (oder vielmehr uralte)
Kräuterbitter, genannt Lebenstrank. Die Folge davon
war, daß das neue Fabrikat überall rasch Eingang und
Beifall fand.
Hugo und Mathilde vermählten sich und leben
glücklich und im schönsten Wohlstand. Und dieses Glück
und diesen Wohlstand verdanken sie der Quadratur des
Zirkels.
Das Passllmsspie! zu ttoquebrune.
(Siehe das Bild auf Seite 77.)
/^s gibt zwei Orte, welche den Namen Roquebrune führen.
Der eine liegt in Südfrankreich bei Fröjus und am
Fuße der dreigipfeligen Croix de Roquebrune, der zweite an
der italienischen Riviera, zwischen Monaco und Mentone.
Wenn man aus dieser Strecke die Eisenbahnstation Roquebrune
passirt, so erblickt man links in der Höhe den Ort Roque-
brune oder Roccabruna zwischen Oliven und Orangen und von
den Ruinen eines alten Schlosses überragt. Der Niedergang
von dort nach Mentone gehört zu den schönsten Punkten der
Corniche, wie die Straße der Riviera di Ponente genannt
wird, welche sich von Nizza längs der felsigen Meeresküste
am Fuße der Seealpen bergauf bergab bis nach Genua
hinschlängelt. In diesem Orte Roquebrune nun findet all-
jährlich ein interessantes Passionsspiel statt — eigentlich eine
Prozession, die aber von Zeit zu Zeit Halt macht und dann
Momente aus der Leidensgeschichte Jesu dramatisch zur Dar-
stellung bringt. Die Entstehung dieses Spieles wird bis auf
etwa 500 Jahre zurückverlegt. Zu jener Zeit wüthete in
jenen Gegenden die Pest, der gefürchtete „schwarze Tod", und
die damaligen Burggrafen Lascaris sollen das Gelübde gethan
haben, alljährlich auf ihre Kosten die Leidensgeschichte Jesu
darstellen zu lassen, wenn die Seuche aufhöre. Als dies nun
in der That geschah, ließen sie die entsprechenden Kostüme
anfertigen, welche zum Theil noch vorhanden sein sollen, und
seitdem wurde an jedem 8. August dies Passionsspiel auf-
geführt. Eine Zeitlang wnrde der Schauplatz nach Monaco
verlegt, später aber, nachdem jene Burggrafen ausgestorben
waren, und die Geistlichkeit die Fortsetzung des Spieles in
die Hand genommen hatte, wieder nach Roquebrune.
Unser Bild aus S. 77 stellt die Prozession der Darsteller
dar, die nach dem Gottesdienste in der Sakristei der Kirche
ihre Gewänder anlegen, worauf sich der Zug gegen Mittag
in Bewegung fetzt. Ihn eröffnen Gendarmen im Kostüm
von römischen Lanzknechten. Dann folgen: Pontius Pilatus,
neben dem ein Page mit dem Waschbecken geht, als Engel
gekleidete Jungfrauen aus Roquebrune und daneben Büßer
mit Kreuzen in den Händen. Hierauf der Darsteller des
Christus mit dem Kreuz, Maria, Veronika und die Frauen
Dns Bu ch für All e.
(sümmtlich von Nonnen dargestellt), die Henkersknechte, die
Schächer, Petrus und Johannes, Judas u. s. w.. Alle zwanzig
Schritte bleibt der Zug auf ein gegebenes ^Zeichen stehen
und dann wird „gespielt". Beim ersten Halt wäscht Pilatus
sich die Hände, beim nächsten Mal fällt der Heiland unter
dem Kreuze nieder, worauf ihm Veronika das Schweißtuch
reicht; Marin wird ohnmächtig, ein Henker tritt an den Hei-
land heran und schlägt ihn, während Andere die Mord-
instrumente zeigen, und die Jünger Jndas den Geldsack ent-
reißen wollen u. s. w. Am Schlüsse geht Alles in die Sakristei
zurück, um die Gewänder abzulegen, und dann ziehen die
Theilnehmer — meist Fischer und Gärtner — in die Osterien
des Ortes, um sich zu erquicken.
Fechtübungell bei der Kavallerie.
(Siehe das Bild auf Seite 80.)
/<?in guter Kavallerist muß nicht nur reiten, sondern mich
schießen und fechten können. Friedrich der Große stellte
den Grundsatz fest, daß die Reiterei in erster Linie durch die
Kraft ihres Ansturmes und den Gebrauch ihrer blanken Waffen
gegen Kavallerie zu wirken, aber ferner die Infanterie in:
Aufrollen feindlicher Linien zu unterstützen habe; auch im
Fußgefecht wurde sie geübt. In der Epoche der aufgelösten
Fechtart der Infanterie, als man dem durchschnittenen Ge-
lände und den Wäldern und Dörfern nicht aus dem Wege
ging, sondern sie vielmehr der Deckung wegen aufsuchte,
mußte natürlich die Bedeutung der Kavallerie für den Kampf
zurücktreten. Gleichzeitig indessen bahnte sich ihre Verwendung
für den Aufklärungs- und Sicherheitsdienst an, die erst im Ver-
laufe des letzten deutsch-französischen Krieges zur vollen
Geltung gekommen ist. Zu dem Karabiner hat die deutsche
Kavallerie neuerdings allgemein die früher allein von Ulanen
geführte älteste Neiterwaffe, die Lanze, zugetheilt bekommen,
und die Mannschaften müssen daher außer im Schießen mit
dem Karabiner im Fechten mit Säbel und mit Lanze unter-
wiesen werden. Das Fechten mit der Lanze ist ein Stoß-
fechten. Die gefällte Lanze liegt mit ihrem unteren Ende in
der Achselhöhle und wird mit der rechten Hand wagerecht ge-
halten. Das ist die Auslage, in die sie sowohl nach dem
Stoß wie nach der Parade zurückgeführt wird. Zum Stoß,
der nach allen Seiten ausgeführt werden kann, zieht man sie
erst etwas zurück und läßt sie dann kräftig vorschnellen,
während die Paraden in kurzen Schlägen nut der Lanze nach
der Waffe des Angreifers bestehen. Der in der Führung
der Lanze geübte Reiter kann sich mit dieser furchtbaren
Waffe sehr gut mehrere mit dem Säbel ihn angreifende
Gegner vom Leibe halten, wie dies auf den Reitplätzen
unserer Kavallerie auch praktisch im Kampfe von Mann gegen
Mann geübt wird (siehe unser Bild auf S. 80). Natürlich
find die Oberkörper der Leute dabei durch Fechtpolfter und
die Köpfe mit Drahthauben geschützt, während die Spitzen
der Waffen mit Knöpfen versehen find. Zwei mit Säbeln
bewaffnete Reiter verfolgen einen Lanzentrüger, der sich zu-
nächst durch schnelles Kreisenlassen der Lanze deckt. Jetzt
parirt er plötzlich sein Pferd, wendet die Spitze nach hinten —
ein schiebender Stich, und der verblüffte Verfolger ist ab-
gethan. Nun geht der Verfolgte selber zum Angriff gegen
den zweiten Gegner über. Er sucht des Feindes linke, nur
schwer zu schützende Seite zu gewinnen. Wie sich dieser auch
wendet und windet, so bekommt er doch nach kurzer Zeit
schon seinen Stoß in die Seite, der ihn kampfunfähig macht.
Die Windhose bei München am 14. Juli 1894.
(Siehe das Bild auf Seite 81.)
^sm Nachmittage des 14. Juli 1894 ging über den süd-
lichen Theil der bayrischen Hochebene, auch über München,
ein heftiges Hagelunwetter nieder. Dieses Unwetter gestaltete
sich aber auf einem zum Glück nur schmalen Landstriche in
der Gegend der Ortschaft Schwaben an der Bahnstrecke
München—Simbach zu einer Alles auf ihrem Wege zerstören-
den Windhose. Diese in unseren Breiten so seltene Natur-
erscheinung hat an zweihundert Häuser zerstört, einen materiellen
Schaden angerichtet, der auf eine halbe Million Mark geschätzt
wird, und eine Anzahl Menschenleben sind ihr zum Opfer
gefallen. Dabei hat der ganze Wirbelsturm höchstens acht
Minuten gedauert. Nach dem Hagel wurde es plötzlich ganz
finster, die Niederschläge hörten auf, und es erfolgte eine
einzige elektrische Entladung mit schwachem Donner. Plötzlich
wälzte und drehte sich dann eine schwarze, trichterförmige
Nebelmafse daher, wie auf unserem, nach eigener Beobachtung
aufgenommenen Bilde S. 81 zu sehen. Diese Windhose
drehte sich fortwährend im Kreise; die Bäume wurden daher
vielfach nicht abgebrochen, sondern abgedreht; sie vernichtete
Alles, was in einer gewissen Höhe über den Boden hervor-
ragte, und hob es in die Lüfte. Gleich hinter Schwaben wur-
den die sogenannten Mooshäuseln, friedliche Einödhüuser, in
Trümmerstätten verwandelt. In Schwaberwegen bietet sich
dasselbe Bild der Zerstörung, aber den Mittelpunkt des Un-
glücks bildet der Ort Forstinning. Auf unserem Bilde be-
grenzen den Horizont die übrig gebliebenen Baumstümpfe
des Fichtenparkes von Ebersberg. Den Vordergrund nimmt
die Straße nach Forstinning ein. Die Häuser sind der Dächer
beraubt, ganze Mauern umgeweht, die abgerissenen Bäume,
Balken und Hütten zum Theil weit sortgetragen. Ein Wagen
mit Stämmen wurde nebst den Pferden bis auf eine be-
deutende Entfernung von der Straße fortgesührt und dort
umgeworfen. Kaum weniger haben die Orte Hub, Amplötz,
Pullach, Sickenberg, Forstern (wo der Kirchthurm einstürzte)
und Thading gelitten. Zur Linderung der Noth sind vieler-
orts Sammlungen eingeleitet, denen ein guter Fortgang zu
wünschen ist.
Nadfahrende Damen im Lois de Doulogne zu
Paris.
(Siehe diiS Bild auf Seite 83 )
"7>ie Pariser Modewelt, welche sich noch bis vor Kurzem
dem Radfahrsport gegenüber sehr gleichgiltig verhalten
hatte, ist mit einem Male von einer förmlichen Bicyclomanie
ergriffen worden, und besonders bei den Damen gilt es gegen-
wärtig durchaus für „oüio", das heißt für unerläßlich, entweder
allein auf dem Sicherheitszweirad, oder zu Zweit auf dem Tan-
dem mit einem Kavalier vor oder hinter sich, dem Radsahrsport
zu fröhnen. Und mit welcher alles andere Vergnügen hinten-
ansetzenden Begeisterung geschieht dies! Die Pariserin, die
bislang für sehr träge und bewegungsunlustig galt, die nie
vor elf Uhr aufstand und sich erst Abends im Bois de Bou-
logne zeigte, um dort vom Wagen aus ihre Bekannten zu
begrüßen, ist jetzt bereits mit Sonnenaufgang aus den Federn,
um, gekleidet in die modernste Männertracht, nach dem „Bois"
zu fahren, dort ihr Stahlrad zu besteigen und im Schweiße
ihres Angesichts ihr Tretrad in den Alleen und Promenaden
zu bewegen. Die Dicken thun es, um mager zu werden; die
Dünnen, um Muokel anzusetzen und etwas Fülle zu gewin-
nen; die Gesunden, um ihre Kraft und Frische zu zeigen;
die Nervösen, um gesund zn werden; die Gefallsüchtigen, um
eine neue Anziehungskraft auf die Männerwelt auszuüben;
die Alternden, um die fliehende Jugend noch ein wenig auf-
zuhalten; die Jungen, um auch anderswo, als im Ballsaal,
ihren Kraftüberschuß auszutoben; die an Appetitlosigkeit und
Bleichsucht Leidenden, um sich Hunger und rothe Wangen zu
verschaffen — kurz, es gibt mindestens hundert Gründe, um
die neue Modemanie zu erklären, und man würde sich die
tiefste Verachtung aller dieser Schönen zuziehen, wenn man
behaupten wollte, daß Eitelkeit, die Sucht, Aufsehen zu er-
regen, Koketterie und Nachahmungstrieb die Hauptmotive
seien, welche alle diese weiblichen Bicyclisten des Morgens
ans den Federn und in's Bois de Boulogne treiben, und daß
der Enthusiasmus für das Stahlrad vermuthlich so vorüber-
gehend sein wird, wie alle die unzähligen anderen Modethor-
heiten der Pariser Damen. Unser Bild auf S. 83 gibt den
Platz im Bois de Boulogne wieder, von wo allmorgendlich
der „Start" der Radfahrer zn beginnen pflegt. Hier sieht man
Damen aller Stände, von der Modedame der großen Welt
auf dem mit allen Verbesserungen der Neuzeit ausgestatteten
Zweirad, bis herunter znr Choristin eines Vorstadttheaters,
welche sich, um auch mitmachen zn können, ein klapperiges
Stahlpferd für einen Franken Leihgebühr die Stunde beim
Fabrikanten ansborgt.
Wie die Mmchen tzelsen.
Authentische Schilderungen aus hohen Kreisen.
Von
Mr. Myers.
(Nachdruck verboNn.)
ei allen Hosfestlichkeiten spielen die großen Di-
ners und Soupers eine wichtige Rolle, keine
derartige Festveranstaltung geht vorüber, ohne
daß ein größeres Galaessen stattfindet. Diese
offiziellen „Hostafeln" sind in allen Län-
dern beinahe gleich; große Unterschiede aber
zeigen sich in der Art und Weise, wie die verschiedenen
Monarchen ihre Privattasel besetzen lassen, nnd in der
Lebensführung, die vor Allem im Speisen zum Aus-
druck kommt.
Diese Unterschiede werden in der nachfolgenden Zu-
sammenstellung, die aus durchaus sicheren und authen-
tischen Quellen beruht, sich von selbst ergeben, ohne
daß wir unsere Leser jedesmal besonders darauf auf-
merksam zu machen brauchen. Betont möge nur noch ein-
mal werden, daß es sich im Folgenden immer nur um so-
genannte intimere Diners und Soupers und nicht
um die großen Galahoftafeln handelt.
Beginnen wir mit dem deutschen Kaiserhofe,
so finden nur hier einen liebenswürdigen Komfort und
eine freundliche Solidität, welche weit entfernt ist von
aller Etikette und aller ceremoniellen Steifheit. Trotz-
dem sechzig bis achtzig Personen zu einem solchen De-
jeuner, Diner oder Souper eingeladen werden, nimmt
das Essen den Charakter einer Familienfeftlichkeit an.
Die Eingeladenen haben zu diesen „kleinen Hoftafeln",
die fast täglich stattfinden, nur kleine Uniform anzulegen,
und da Kaiser und Kaiserin außerordentliche Freunde
einer angenehmen hnmordurchwürzten Tischunterhaltung
sind, wird schon von diesen selbst dafür gesorgt, daß
Langeweile und Steifheit nicht auskommt.
Ein solches Diner in vertrauterem Kreise dauert
45 bis 50 Minuten, und ungefähr zehn Gerichte wer-
den dabei aufgetragen. Die Hauptgerichte werden auf
silbernen Tellern dargereicht, die Zwischengerichte aus
Porzellantellern der königlichen Berliner Manufaktur.
Der Tisch ist geschmückt mit großen Tafelaufsätzen und
mit besonders viel Blumen; silberne Armleuchter mit
Wachskerzen erhöhen den Glanz des Gedeckes. Die
Speisekarten sind mit künstlerisch ausgeführten Bildern
versehen und enthalten kein Fremdwort. Die Küche
ist halb deutsch, halb englisch.