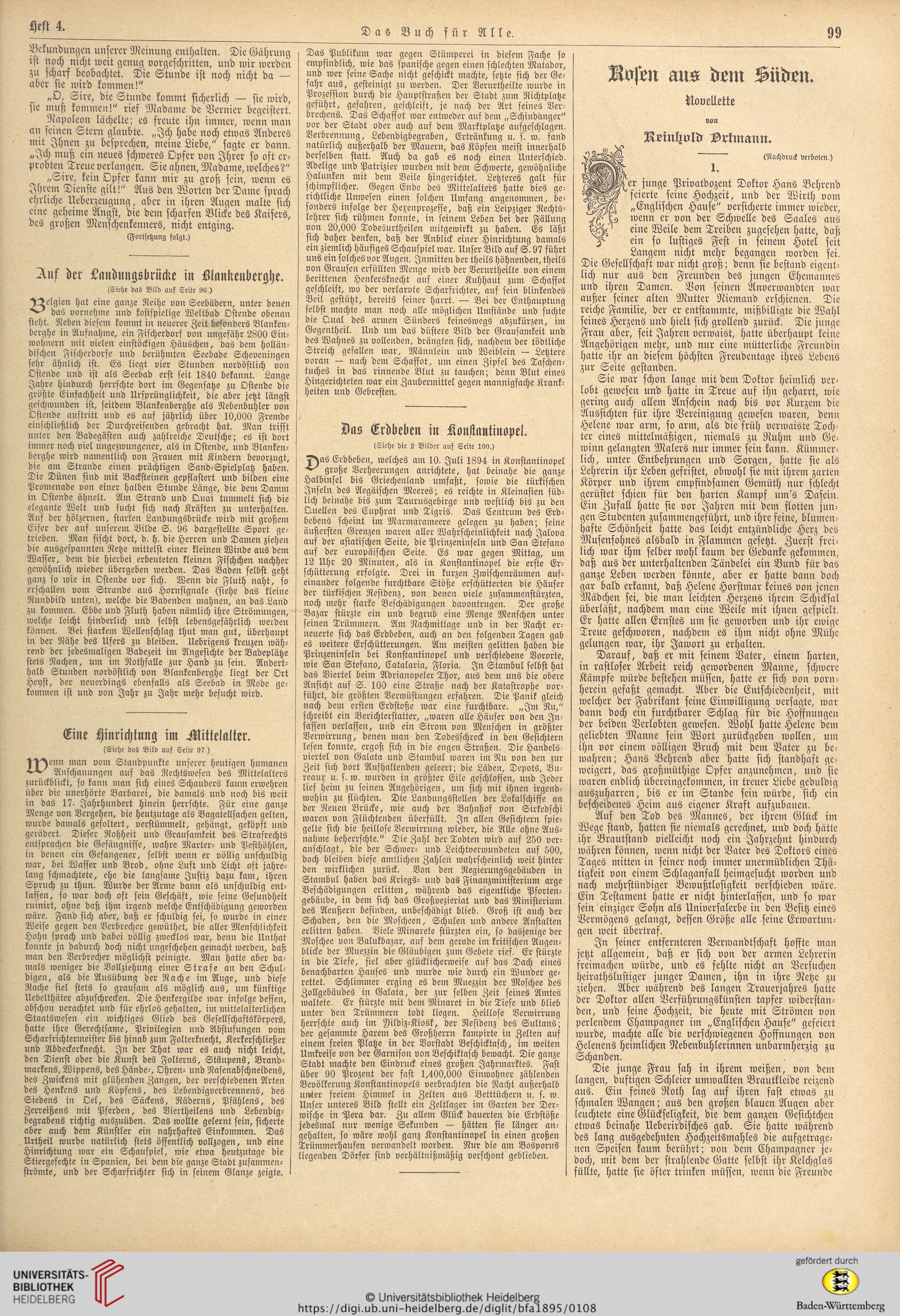99
Hcst 4.
Das Buch für All e.
Bekundungen unserer Meinung enthalten. Die Gährung
ist noch nicht weit genug vorgeschritten, und wir werden
zu scharf beobachtet. Die Stunde ist noch nicht da —
aber sie wird kommen!"
„O, Sire, die Stunde kommt sicherlich — sie wird,
sie muß kommen!" rief Madame de Vernier begeistert.
Napoleon lächelte; es freute ihn immer, wenn man
an seinen Stern glaubte. „Ich habe noch etwas Anderes
mit Ihnen zu besprechen, meine Liebe," sagte er dann.
„Ich muß ein neues schweres Opfer von Ihrer so oft er-
probten Treue verlangen. Sie ahnen, Madame, welches?"
„Sire, kein Opfer kann mir zu groß sein, wenn es
Ihrem Dienste gilt!" Aus den Worten der Dame sprach
ehrliche Ueberzeugung, aber in ihren Augen malte sich
eine geheime Angst, die den: scharfen Blicke des Kaisers,
des großen Menschenkenners, nicht entging.
(Fortsetzung folgt.)
der LMdmtgsbriicke in Mnnkeuberghe.
(Siche dos Bild auf Seite 90.)
^Zeigten hat eine ganze Reihe von Seebädern, unter denen
das vornehme und kostspielige Weltbad Ostende obenan
steht. Neben diesem kommt in neuerer Zeit besonders Blanken-
berghe iir Aufnahme, ein Fischerdorf von ungefähr 2800 Ein-
wohnern mit vielen einstöckigen Häuschen, das dem hollän-
dischen Fischerdorfe und berühmten Seebade Scheveningen
sehr ähnlich ist. Es liegt vier Stunden nordöstlich von
Ostende und ist als Seebad erst seit 1840 bekannt. Lange
Jahre hindurch herrschte dort im Gegensätze zu Ostende die
größte Einfachheit und Ursprünglichkeit, die aber jetzt längst
geschwunden ist, seitdem Blankenberghe als Nebenbuhler von
Ostende auftritt und es aus jährlich über 10,000 Fremde
einschließlich der Durchreisenden gebracht hat. Man trifft
unter den Badegästen auch zahlreiche Deutsche; es ist dort
immer noch viel ungezwungener, als in Ostende, und Vlanken-
berghe wird namentlich von Frauen mit Kindern bevorzugt,
die am Strande einen prächtigen Sand-Spielplatz haben.
Die Dünen sind mit Backsteinen gepflastert und bilden eine
Promenade von einer halben Stunde Länge, die dem Damm
in Ostende ähnelt. Am Strand und Quai tummelt sich die
elegante Welt und sucht sich nach Kräften zu unterhalten.
Auf der hölzernen, starken Landungsbrücke wird mit großem
Eifer der auf unserem Bilde S. 96 dargestellte Sport ge-
trieben. Man fischt dort, d. h. die Herren und Damen ziehen
die ausgespannten Netze mittelst einer kleinen Winde aus dem
Wasser, dem die hierbei erbeuteten kleinen Fischchen nachher
gewöhnlich wieder übergeben werden. Das Baden selbst geht
ganz so wie in Ostende vor sich. Wenn die Fluth naht, so
erschallen vom Strande aus Hmmsignale (stehe das kleine
Rundbild unten), welche die Badenden mahnen, an das Land
zu kommen. Ebbe und Fluth haben nämlich ihre Strömungen,
welche leicht hinderlich und selbst lebensgefährlich werden
können. Bei starkem Wellenschlag thut man gut, überhaupt
in der Nähe des Ufers zu bleiben. Uebrigens kreuzen wäh-
rend der jedesmaligen Badezeit im Angesichte der Badeplätze
stets Nachen, um im Nothfalle zur Hand zu sein. Andert-
halb Stunden nordöstlich von Blankenberghe liegt der Ort
Heyst, der neuerdings ebenfalls als Seebad in Mode ge-
kommen ist und von Jahr zu Jahr mehr besucht wird.
Eine Hinrichtung im Mittelalter.
(Siche das Bild auf Seite 97.)
enn man vom Standpunkte unserer heutigen humanen
Anschauungen auf das Nechtswesen des Mittelalters
zurückblickt, so kann man sich eines Schauders kaum erwehren
über die unerhörte Barbarei, die damals und noch bis weit
in das 17- Jahrhundert hinein herrschte. Für eine ganze
Menge von Vergehen, die heutzutage als Bagatellsachen gelten,
wurde damals gefoltert, verstümmelt, gehängt, geköpft und
gerädert. Dieser Rohheit und Grausamkeit des Strafrechts
entsprachen die Gefängnisse, wahre Marter- und Pesthöhlen,
in denen ein Gefangener, selbst wenn er völlig unschuldig
war, bei Wasser und Brod, ohne Luft und Licht oft jahre-
lang schmachtete, ehe die langsame Justiz dazu kam, ihren
Spruch zu thun. Wurde der Arme dann als unschuldig ent-
lassen, so war doch ost sein Geschäft, wie seine Gesundheit
ruinirt, ohne daß ihm irgend welche Entschädigung geworden
wäre. Fand sich aber, daß er schuldig sei, so wurde in einer
Weise gegen den Verbrecher gewüthet, die aller Menschlichkeit
Hohn sprach und dabei völlig zwecklos war, denn die Unthat
konnte ja dadurch doch nicht ungeschehen gemacht werden, daß
man den Verbrecher möglichst peinigte. Man hatte aber da-
mals weniger die Vollziehung einer Strafe an den Schul-
digen, als die Ausübung der Rache im Auge, und diese
Rache siel stets so grausam als möglich aus, um künftige
Uebelthäter abzuschrecken. Die Henkergilde war infolge dessen,
obschon verachtet und für ehrlos gehalten, im mittelalterlichen
Staatswesen ein wichtiges Glied des Gesellschaftskörpers,
hatte ihre Gerechtsame, Privilegien und Abstufungen vom
Scharsrichtermeister bis hinab zum Folterknecht, Kerkerschließer
und Abdeckerknecht. In der That war es auch nicht leicht,
den Dienst oder die Kunst des Folterns, Stäupens, Brand-
markens, Wippens, des Hände-, Ohren- und Nasenabschneidens,
des Zwickens mit glühenden Zangen, der verschiedenen Arten
des Henkens und Köpfens, des Lebendigverbrennens, des
Siedens in Oel, des Stickens, Räderns, Pfählens, des
Zerreißens mit Pferden, des Viertheilens und Lebendig-
begrabens richtig auszuüben. Das wollte gelernt sein, sicherte
aber auch dem Künstler ein nahrhaftes Einkommen. Das
Urtheil wurde natürlich stets öffentlich vollzogen, und eine
Hinrichtung war ein Schauspiel, wie etwa heutzutage die
Stiergefechte in Spanien, bei dem die ganze Stadt zusammen-
strömte, und der Scharfrichter sich in seinem Glanze zeigte, i
Das Publikum war gegen Stümperei in diesem Fache so
empfindlich, wie das spanische gegen einen schlechten Matador,
und wer seine Sache nicht geschickt machte, setzte sich der Ge-
fahr aus, gesteinigt zu werden. Der Verurtheilte wurde in
Prozession durch die Hauptstraßen der Stadt zum Richtplatze
geführt, gefahren, geschleift, je nach der Art seines Ver-
brechens. Das Schaffst war entweder auf dem „Schindanger"
vor der Stadt oder auch auf dem Marktplatze aufgeschlagen.
Verbrennung, Lebendigbegraben, Ertränkung u. s. w. fand
natürlich außerhalb der Mauern, das Köpfen meist innerhalb
derselben statt. Auch da gab es noch einen Unterschied.
Adelige und Patrizier wurden mit dem Schwerte, gewöhnliche
Halunken mit dem Beile hingerichtet. Letzteres galt für
schimpflicher. Gegen Ende des Mittelalters hatte dies ge-
richtliche Unwesen einen solchen Umfang angenommen, be-
sonders infolge der Hexenprozesse, daß ein Leipziger Rechts-
lehrer sich rühmen konnte, in seinem Leben bei der Fällung
von 20,000 Todesurtheilen mitgewirkt zu haben. Es läßt
sich daher denken, daß der Anblick einer Hinrichtung damals
ein ziemlich häufiges Schauspiel war. Unser Bild auf S. 97 führt
uns ein solches vor Augen. Inmitten der theils höhnenden, theils
von Grausen erfüllten Menge wird der Verurtheilte von einem
berittenen Henkersknecht aus einer Kuhhaut zum Schasfot
geschleift, wo der verlarvte Scharfrichter, auf sein blinkendes
Beil gestützt, bereits seiner harrt. — Bei der Enthauptung
selbst machte man noch alle möglichen Umstände und suchte
die Qual des armen Sünders keineswegs abzukürzen, im
Gegentheil. Und um das düstere Bild der Grausamkeit und
des Wahnes zu vollenden, drängten sich, nachdem der tödtliche
Streich gefallen war, Männlein und Weiblein — Letztere
voran — nach dem Schasfot, um einen Zipfel des Taschen-
tuches in das rinnende Blut zu tauchen; denn Blut eines
Hingerichteten war ein Zaubermittel gegen mannigfache Krank-
heiten und Gebresten.
Das Erdbeben in Konstantinopel.
(Siehe die 2 Bilder auf Seite 100.)
7>as Erdbeben, welches am 10. Juli 1894 in Konstantinopel
große Verheerungen anrichtete, hat beinahe die ganze
Halbinsel bis Griechenland umfaßt, sowie die türkischen
Inseln des Aegäischen Meeres; es reichte in Kleinasien süd-
lich beinahe bis zum Taurusgebirge und westlich bis zu den
Quellen des Euphrat und Tigris. Das Centrum des Erd-
bebens scheint im Marmarameers gelegen zu haben; seine
äußersten Grenzen waren aller Wahrscheinlichkeit nach Jalova
auf der asiatischen Seite, die Prinzeninseln und San Stefano
auf der europäischen Seite. Es war gegen Mittag, um
12 Uhr 20 Minuten, als in Konstantinopel die erste Er-
schütterung erfolgte. Drei in kurzen Zwischenräumen auf-
einander folgende furchtbare Stöße erschütterten die Häuser
der türkischen Residenz, von denen viele zusammenstürzten,
noch mehr starke Beschädigungen davontrugen. Der große
Bazar stürzte ein und begrub eine Menge Menschen unter
seinen Trümmern. Nm Nachmittage und in der Nacht er-
neuerte sich das Erdbeben, auch an den folgenden Tagen gab
es weitere Erschütterungen. Am meisten gelitten haben die
Prinzeninseln bei Konstantinopel und verschiedene Vororte,
wie San Stefano, Catalaria, Floria. In Stambul selbst hat
das Viertel beim Adrianopeler Thor, aus dem uns die obere
Ansicht auf S. 100 eine Straße nach der Katastrophe vor-
führt, die größten Verwüstungen erfahren. Die Panik gleich
nach dem ersten Erdstoße war eine furchtbare. „Im Nu,"
schreibt ein Berichterstatter, „waren alle Häuser von den In-
sassen verlassen, und ein Strom von Menschen in größter
Verwirrung, denen man den Todesschreck in den Gesichtern
lesen konnte, ergoß sich in die engen Straßen. Die Handels-
viertel von Galata und Stambul waren im Nu von den zur
Zeit sich dort Aufhaltenden geleert; die Läden, Depots, Bu-
reaux u. s. w. wurden in größter Eile geschlossen, und Jeder
lief heim zu seinen Angehörigen, um sich mit ihnen irgend-
wohin zu flüchten. Die Landungsstellen der Lokalschiffe an
der Neuen Brücke, wie auch der Bahnhof von Sirkedschi
waren von Flüchtenden überfüllt. In allen Gesichtern spie-
gelte sich die heillose Verwirrung wieder, die Alle ohne Aus-
nahme beherrschte." Die Zahl der Todten wird auf 250 ver-
anschlagt, die der Schwer- und Leichtverwundeten auf 500,
doch bleiben diese amtlichen Zahlen wahrscheinlich weit hinter
den wirklichen zurück. Von den Regierungsgebäuden in
Stambul haben das Kriegs- und das Finanzministerium arge
Beschädigungen erlitten, während das eigentliche Pforten-
gebäude, in dem sich das Großvezieriat und das Ministerium
des Aeußern befinden, unbeschädigt blieb. Groß ist auch der
Schaden, den die Moscheen, Schulen und andere Anstalten
erlitten haben. Viele Minarete stürzten ein, so dasjenige der
Moschee von Balukbazar, auf dem gerade im kritischen Augen-
blicke der Muezzin die Gläubigen zum Gebete rief. Er stürzte
in die Tiefe, fiel aber glücklicherweise auf das Dach eines
benachbarten Hauses und wurde wie durch ein Wunder ge-
rettet. Schlimmer erging es dem Muezzin der Moschee des
Zollgebäudes in Galata, der zur selben Zeit seines Amtes
waltete. Er stürzte mit dem Minaret in die Tiefe und blieb
unter den Trümmern todt liegen. Heillose Verwirrung
herrschte auch im Mldiz-Kiosk, der Residenz des Sultans;
der gesammte Harem des Großherrn kampirts in Zelten auf
einem freien Platze in der Vorstadt Beschicktasch, im weiten
Umkreise von der Garnison von Beschiktasch bewacht. Die ganze
Stadt machte den Eindruck eines großen Jahrmarktes. Fast
über 90 Prozent der fast 1,400,000 Einwohner zählenden
Bevölkerung Konstantinopels verbrachten die Nacht außerhalb
unter freiem Himmel in Zelten aus Betttüchern u. s. w.
Unser unteres Bild stellt ein Zeltlager im Garten der Der-
wische in Pera dar. Zu allem Glück dauerten die Erdstöße
jedesmal nur wenige Sekunden — hätten sie länger an-
gehalten, so wäre wohl ganz Konstantinopel in einen großen
Trümmerhaufen verwandelt worden. Nur die am Bosporus
liegenden Dörfer find verhältnißmäßig verschont geblieben.
Kosen aus dem Süden.
Novellette
von
Reinhold Orkmann.
(Nachdruck verboicn.)
1.
er junge Privatdozent Doktor Hans Behrend
feierte seine Hochzeit, und der Wirth vom
„Englischen Hause" versicherte immer wieder,
wenn er von der Schwelle des Saales aus
eine Weile dem Treiben zugesehen hatte, daß
ein so lustiges Fest in seinem Hotel seit
Langem nicht mehr begangen worden sei.
Die Gesellschaft war nicht groß; denn sie bestand eigent-
lich nur aus den Freunden des jungen Ehemannes
und ihren Damen. Von seinen Anverwandten war
außer seiner alten Mutter Niemand erschienen. Die
reiche Familie, der er entstammte, mißbilligte die Wahl
seines Herzens und hielt sich grollend zurück. Die junge
Frau aber, seit Jahren verwaist, hatte überhaupt keine
Angehörigen mehr, und nur eine mütterliche Freundin
hatte ihr an diesem höchsten Freudentage ihres Lebens
zur Seite gestanden.
Sie war schon lange mit dem Doktor heimlich ver-
lobt gewesen und hatte in Treue auf ihn geharrt, wie
gering auch allem Anschein nach bis vor Kurzen: die
Aussichten für ihre Vereinigung gewesen waren, denn
Helene war arm, so arm, als die früh verwaiste Toch-
ter eines mittelmäßigen, niemals zu Nuhn: und Ge-
winn gelangten Malers nur immer sein kann. Kümmer-
lich, unter Entbehrungen und Sorgen, hatte sie als
Lehrerin ihr Leben gefristet, obwohl sie mit ihren: zarten
Körper und ihrem empfindsamen Gemüth nur schlecht
gerüstet schien für den harten Kampf um's Dasein.
Ein Zufall hatte sie vor Jahren mit den: flotten jun-
gen Studenten zusammengeführt, und ihre feine, blumen-
hafte Schönheit hatte das leicht entzündliche Herz des
Musensohnes alsbald in Flammen gesetzt. Zuerst frei-
lich war ihm selber wohl kaum der Gedanke gekommen,
daß aus der unterhaltenden Tändelei ein Bund für das
ganze Leben werden könnte, aber er hatte dann doch
gar bald erkannt, daß Helene Horstmar keines von jenen
Mädchen sei, die man leichten Herzens ihrem Schicksal
überläßt, nachdem man eine Weile mit ihnen gespielt.
Er hatte allen Ernstes um sie geworben und ihr ewige
Treue geschworen, nachdem es ihm nicht ohne Mühe
gelungen war, ihr Jawort zu erhalten.
Darauf, daß er mit seinem Vater, einem harten,
in rastloser Arbeit reich gewordenen Manne, schwere
Kämpfe würde bestehen müssen, hatte er sich von vorn-
herein gefaßt gemacht. Aber die Entschiedenheit, nut
welcher der Fabrikant seine Einwilligung versagte, war
dann doch ein furchtbarer Schlag für die Hoffnungen
der beiden Verlobten gewesen. Wohl hatte Helene den:
geliebten Manne sein Wort zurückgeben wollen, um
ihn vor einem völligen Bruch mit dem Vater zu be-
wahren; Hans Behrend aber hatte sich standhaft ge-
weigert, das großmüthige Opfer anzunehmen, und sie
waren endlich übereingekommen, in treuer Liebe geduldig
auszuharren, bis er im Stande sein würde, sich ein
bescheidenes Heim aus eigener Kraft aufzubauen.
Auf den Tod des Mannes, der ihrem Glück im
Wege stand, hatten sie niemals gerechnet, und doch hätte
ihr Brautstand vielleicht noch ein Jahrzehnt hindurch
währen können, wenn nicht der Vater des Doktors eines
Tages mitten in seiner noch immer unermüdlichen Thü-
tigkeit von einem Schlaganfall heimgesucht worden und
nach mehrstündiger Bewußtlosigkeit verschieden wäre.
Ein Testament hatte er nicht hinterlassen, und so war
sein einziger Sohn als Universalerbe in den Besitz eines
Vermögens gelangt, dessen Größe alle seine Erwartun-
gen weit übertraf.
In seiner entfernteren Verwandtschaft hoffte man
jetzt allgemein, daß er sich von der armen Lehrerin
freimnchen würde, und es fehlte nicht an Versuchen
heirathslustiger junger Damen, ihn in ihre Netze zu
ziehen. Aber während des langen Trauerjahres hatte
der Doktor allen Verführungskünsten tapfer widerstan-
den, und seine Hochzeit, die heute mit Strömen von
perlendem Champagner im „Englischen Hause" gefeiert
wurde, machte alle die verschwiegenen Hoffnungen von
Helenens heimlichen Nebenbuhlerinnen unbarmherzig zu
Schanden.
Die junge Frau sah in ihrem weißen, von dem
langen, duftigen Schleier umwallten Brautkleide reizend
aus. Ein feines Roth lag auf ihren fast etwas zu
schmalen Wangen; aus den großen blauen Augen aber
leuchtete eine Glückseligkeit, die dem ganzen Gesichtchen
etwas beinahe Ueberirdisches gab. Sie hatte während
des lang ausgedehnten Hochzeitsmahles die aufgetrage-
nen Speisen kaum berührt; von dem Champagner je-
doch, mit dem der strahlende Gatte selbst ihr Kelchglas
füllte, hatte sie öfter trinken müssen, wenn die Freunde
Hcst 4.
Das Buch für All e.
Bekundungen unserer Meinung enthalten. Die Gährung
ist noch nicht weit genug vorgeschritten, und wir werden
zu scharf beobachtet. Die Stunde ist noch nicht da —
aber sie wird kommen!"
„O, Sire, die Stunde kommt sicherlich — sie wird,
sie muß kommen!" rief Madame de Vernier begeistert.
Napoleon lächelte; es freute ihn immer, wenn man
an seinen Stern glaubte. „Ich habe noch etwas Anderes
mit Ihnen zu besprechen, meine Liebe," sagte er dann.
„Ich muß ein neues schweres Opfer von Ihrer so oft er-
probten Treue verlangen. Sie ahnen, Madame, welches?"
„Sire, kein Opfer kann mir zu groß sein, wenn es
Ihrem Dienste gilt!" Aus den Worten der Dame sprach
ehrliche Ueberzeugung, aber in ihren Augen malte sich
eine geheime Angst, die den: scharfen Blicke des Kaisers,
des großen Menschenkenners, nicht entging.
(Fortsetzung folgt.)
der LMdmtgsbriicke in Mnnkeuberghe.
(Siche dos Bild auf Seite 90.)
^Zeigten hat eine ganze Reihe von Seebädern, unter denen
das vornehme und kostspielige Weltbad Ostende obenan
steht. Neben diesem kommt in neuerer Zeit besonders Blanken-
berghe iir Aufnahme, ein Fischerdorf von ungefähr 2800 Ein-
wohnern mit vielen einstöckigen Häuschen, das dem hollän-
dischen Fischerdorfe und berühmten Seebade Scheveningen
sehr ähnlich ist. Es liegt vier Stunden nordöstlich von
Ostende und ist als Seebad erst seit 1840 bekannt. Lange
Jahre hindurch herrschte dort im Gegensätze zu Ostende die
größte Einfachheit und Ursprünglichkeit, die aber jetzt längst
geschwunden ist, seitdem Blankenberghe als Nebenbuhler von
Ostende auftritt und es aus jährlich über 10,000 Fremde
einschließlich der Durchreisenden gebracht hat. Man trifft
unter den Badegästen auch zahlreiche Deutsche; es ist dort
immer noch viel ungezwungener, als in Ostende, und Vlanken-
berghe wird namentlich von Frauen mit Kindern bevorzugt,
die am Strande einen prächtigen Sand-Spielplatz haben.
Die Dünen sind mit Backsteinen gepflastert und bilden eine
Promenade von einer halben Stunde Länge, die dem Damm
in Ostende ähnelt. Am Strand und Quai tummelt sich die
elegante Welt und sucht sich nach Kräften zu unterhalten.
Auf der hölzernen, starken Landungsbrücke wird mit großem
Eifer der auf unserem Bilde S. 96 dargestellte Sport ge-
trieben. Man fischt dort, d. h. die Herren und Damen ziehen
die ausgespannten Netze mittelst einer kleinen Winde aus dem
Wasser, dem die hierbei erbeuteten kleinen Fischchen nachher
gewöhnlich wieder übergeben werden. Das Baden selbst geht
ganz so wie in Ostende vor sich. Wenn die Fluth naht, so
erschallen vom Strande aus Hmmsignale (stehe das kleine
Rundbild unten), welche die Badenden mahnen, an das Land
zu kommen. Ebbe und Fluth haben nämlich ihre Strömungen,
welche leicht hinderlich und selbst lebensgefährlich werden
können. Bei starkem Wellenschlag thut man gut, überhaupt
in der Nähe des Ufers zu bleiben. Uebrigens kreuzen wäh-
rend der jedesmaligen Badezeit im Angesichte der Badeplätze
stets Nachen, um im Nothfalle zur Hand zu sein. Andert-
halb Stunden nordöstlich von Blankenberghe liegt der Ort
Heyst, der neuerdings ebenfalls als Seebad in Mode ge-
kommen ist und von Jahr zu Jahr mehr besucht wird.
Eine Hinrichtung im Mittelalter.
(Siche das Bild auf Seite 97.)
enn man vom Standpunkte unserer heutigen humanen
Anschauungen auf das Nechtswesen des Mittelalters
zurückblickt, so kann man sich eines Schauders kaum erwehren
über die unerhörte Barbarei, die damals und noch bis weit
in das 17- Jahrhundert hinein herrschte. Für eine ganze
Menge von Vergehen, die heutzutage als Bagatellsachen gelten,
wurde damals gefoltert, verstümmelt, gehängt, geköpft und
gerädert. Dieser Rohheit und Grausamkeit des Strafrechts
entsprachen die Gefängnisse, wahre Marter- und Pesthöhlen,
in denen ein Gefangener, selbst wenn er völlig unschuldig
war, bei Wasser und Brod, ohne Luft und Licht oft jahre-
lang schmachtete, ehe die langsame Justiz dazu kam, ihren
Spruch zu thun. Wurde der Arme dann als unschuldig ent-
lassen, so war doch ost sein Geschäft, wie seine Gesundheit
ruinirt, ohne daß ihm irgend welche Entschädigung geworden
wäre. Fand sich aber, daß er schuldig sei, so wurde in einer
Weise gegen den Verbrecher gewüthet, die aller Menschlichkeit
Hohn sprach und dabei völlig zwecklos war, denn die Unthat
konnte ja dadurch doch nicht ungeschehen gemacht werden, daß
man den Verbrecher möglichst peinigte. Man hatte aber da-
mals weniger die Vollziehung einer Strafe an den Schul-
digen, als die Ausübung der Rache im Auge, und diese
Rache siel stets so grausam als möglich aus, um künftige
Uebelthäter abzuschrecken. Die Henkergilde war infolge dessen,
obschon verachtet und für ehrlos gehalten, im mittelalterlichen
Staatswesen ein wichtiges Glied des Gesellschaftskörpers,
hatte ihre Gerechtsame, Privilegien und Abstufungen vom
Scharsrichtermeister bis hinab zum Folterknecht, Kerkerschließer
und Abdeckerknecht. In der That war es auch nicht leicht,
den Dienst oder die Kunst des Folterns, Stäupens, Brand-
markens, Wippens, des Hände-, Ohren- und Nasenabschneidens,
des Zwickens mit glühenden Zangen, der verschiedenen Arten
des Henkens und Köpfens, des Lebendigverbrennens, des
Siedens in Oel, des Stickens, Räderns, Pfählens, des
Zerreißens mit Pferden, des Viertheilens und Lebendig-
begrabens richtig auszuüben. Das wollte gelernt sein, sicherte
aber auch dem Künstler ein nahrhaftes Einkommen. Das
Urtheil wurde natürlich stets öffentlich vollzogen, und eine
Hinrichtung war ein Schauspiel, wie etwa heutzutage die
Stiergefechte in Spanien, bei dem die ganze Stadt zusammen-
strömte, und der Scharfrichter sich in seinem Glanze zeigte, i
Das Publikum war gegen Stümperei in diesem Fache so
empfindlich, wie das spanische gegen einen schlechten Matador,
und wer seine Sache nicht geschickt machte, setzte sich der Ge-
fahr aus, gesteinigt zu werden. Der Verurtheilte wurde in
Prozession durch die Hauptstraßen der Stadt zum Richtplatze
geführt, gefahren, geschleift, je nach der Art seines Ver-
brechens. Das Schaffst war entweder auf dem „Schindanger"
vor der Stadt oder auch auf dem Marktplatze aufgeschlagen.
Verbrennung, Lebendigbegraben, Ertränkung u. s. w. fand
natürlich außerhalb der Mauern, das Köpfen meist innerhalb
derselben statt. Auch da gab es noch einen Unterschied.
Adelige und Patrizier wurden mit dem Schwerte, gewöhnliche
Halunken mit dem Beile hingerichtet. Letzteres galt für
schimpflicher. Gegen Ende des Mittelalters hatte dies ge-
richtliche Unwesen einen solchen Umfang angenommen, be-
sonders infolge der Hexenprozesse, daß ein Leipziger Rechts-
lehrer sich rühmen konnte, in seinem Leben bei der Fällung
von 20,000 Todesurtheilen mitgewirkt zu haben. Es läßt
sich daher denken, daß der Anblick einer Hinrichtung damals
ein ziemlich häufiges Schauspiel war. Unser Bild auf S. 97 führt
uns ein solches vor Augen. Inmitten der theils höhnenden, theils
von Grausen erfüllten Menge wird der Verurtheilte von einem
berittenen Henkersknecht aus einer Kuhhaut zum Schasfot
geschleift, wo der verlarvte Scharfrichter, auf sein blinkendes
Beil gestützt, bereits seiner harrt. — Bei der Enthauptung
selbst machte man noch alle möglichen Umstände und suchte
die Qual des armen Sünders keineswegs abzukürzen, im
Gegentheil. Und um das düstere Bild der Grausamkeit und
des Wahnes zu vollenden, drängten sich, nachdem der tödtliche
Streich gefallen war, Männlein und Weiblein — Letztere
voran — nach dem Schasfot, um einen Zipfel des Taschen-
tuches in das rinnende Blut zu tauchen; denn Blut eines
Hingerichteten war ein Zaubermittel gegen mannigfache Krank-
heiten und Gebresten.
Das Erdbeben in Konstantinopel.
(Siehe die 2 Bilder auf Seite 100.)
7>as Erdbeben, welches am 10. Juli 1894 in Konstantinopel
große Verheerungen anrichtete, hat beinahe die ganze
Halbinsel bis Griechenland umfaßt, sowie die türkischen
Inseln des Aegäischen Meeres; es reichte in Kleinasien süd-
lich beinahe bis zum Taurusgebirge und westlich bis zu den
Quellen des Euphrat und Tigris. Das Centrum des Erd-
bebens scheint im Marmarameers gelegen zu haben; seine
äußersten Grenzen waren aller Wahrscheinlichkeit nach Jalova
auf der asiatischen Seite, die Prinzeninseln und San Stefano
auf der europäischen Seite. Es war gegen Mittag, um
12 Uhr 20 Minuten, als in Konstantinopel die erste Er-
schütterung erfolgte. Drei in kurzen Zwischenräumen auf-
einander folgende furchtbare Stöße erschütterten die Häuser
der türkischen Residenz, von denen viele zusammenstürzten,
noch mehr starke Beschädigungen davontrugen. Der große
Bazar stürzte ein und begrub eine Menge Menschen unter
seinen Trümmern. Nm Nachmittage und in der Nacht er-
neuerte sich das Erdbeben, auch an den folgenden Tagen gab
es weitere Erschütterungen. Am meisten gelitten haben die
Prinzeninseln bei Konstantinopel und verschiedene Vororte,
wie San Stefano, Catalaria, Floria. In Stambul selbst hat
das Viertel beim Adrianopeler Thor, aus dem uns die obere
Ansicht auf S. 100 eine Straße nach der Katastrophe vor-
führt, die größten Verwüstungen erfahren. Die Panik gleich
nach dem ersten Erdstoße war eine furchtbare. „Im Nu,"
schreibt ein Berichterstatter, „waren alle Häuser von den In-
sassen verlassen, und ein Strom von Menschen in größter
Verwirrung, denen man den Todesschreck in den Gesichtern
lesen konnte, ergoß sich in die engen Straßen. Die Handels-
viertel von Galata und Stambul waren im Nu von den zur
Zeit sich dort Aufhaltenden geleert; die Läden, Depots, Bu-
reaux u. s. w. wurden in größter Eile geschlossen, und Jeder
lief heim zu seinen Angehörigen, um sich mit ihnen irgend-
wohin zu flüchten. Die Landungsstellen der Lokalschiffe an
der Neuen Brücke, wie auch der Bahnhof von Sirkedschi
waren von Flüchtenden überfüllt. In allen Gesichtern spie-
gelte sich die heillose Verwirrung wieder, die Alle ohne Aus-
nahme beherrschte." Die Zahl der Todten wird auf 250 ver-
anschlagt, die der Schwer- und Leichtverwundeten auf 500,
doch bleiben diese amtlichen Zahlen wahrscheinlich weit hinter
den wirklichen zurück. Von den Regierungsgebäuden in
Stambul haben das Kriegs- und das Finanzministerium arge
Beschädigungen erlitten, während das eigentliche Pforten-
gebäude, in dem sich das Großvezieriat und das Ministerium
des Aeußern befinden, unbeschädigt blieb. Groß ist auch der
Schaden, den die Moscheen, Schulen und andere Anstalten
erlitten haben. Viele Minarete stürzten ein, so dasjenige der
Moschee von Balukbazar, auf dem gerade im kritischen Augen-
blicke der Muezzin die Gläubigen zum Gebete rief. Er stürzte
in die Tiefe, fiel aber glücklicherweise auf das Dach eines
benachbarten Hauses und wurde wie durch ein Wunder ge-
rettet. Schlimmer erging es dem Muezzin der Moschee des
Zollgebäudes in Galata, der zur selben Zeit seines Amtes
waltete. Er stürzte mit dem Minaret in die Tiefe und blieb
unter den Trümmern todt liegen. Heillose Verwirrung
herrschte auch im Mldiz-Kiosk, der Residenz des Sultans;
der gesammte Harem des Großherrn kampirts in Zelten auf
einem freien Platze in der Vorstadt Beschicktasch, im weiten
Umkreise von der Garnison von Beschiktasch bewacht. Die ganze
Stadt machte den Eindruck eines großen Jahrmarktes. Fast
über 90 Prozent der fast 1,400,000 Einwohner zählenden
Bevölkerung Konstantinopels verbrachten die Nacht außerhalb
unter freiem Himmel in Zelten aus Betttüchern u. s. w.
Unser unteres Bild stellt ein Zeltlager im Garten der Der-
wische in Pera dar. Zu allem Glück dauerten die Erdstöße
jedesmal nur wenige Sekunden — hätten sie länger an-
gehalten, so wäre wohl ganz Konstantinopel in einen großen
Trümmerhaufen verwandelt worden. Nur die am Bosporus
liegenden Dörfer find verhältnißmäßig verschont geblieben.
Kosen aus dem Süden.
Novellette
von
Reinhold Orkmann.
(Nachdruck verboicn.)
1.
er junge Privatdozent Doktor Hans Behrend
feierte seine Hochzeit, und der Wirth vom
„Englischen Hause" versicherte immer wieder,
wenn er von der Schwelle des Saales aus
eine Weile dem Treiben zugesehen hatte, daß
ein so lustiges Fest in seinem Hotel seit
Langem nicht mehr begangen worden sei.
Die Gesellschaft war nicht groß; denn sie bestand eigent-
lich nur aus den Freunden des jungen Ehemannes
und ihren Damen. Von seinen Anverwandten war
außer seiner alten Mutter Niemand erschienen. Die
reiche Familie, der er entstammte, mißbilligte die Wahl
seines Herzens und hielt sich grollend zurück. Die junge
Frau aber, seit Jahren verwaist, hatte überhaupt keine
Angehörigen mehr, und nur eine mütterliche Freundin
hatte ihr an diesem höchsten Freudentage ihres Lebens
zur Seite gestanden.
Sie war schon lange mit dem Doktor heimlich ver-
lobt gewesen und hatte in Treue auf ihn geharrt, wie
gering auch allem Anschein nach bis vor Kurzen: die
Aussichten für ihre Vereinigung gewesen waren, denn
Helene war arm, so arm, als die früh verwaiste Toch-
ter eines mittelmäßigen, niemals zu Nuhn: und Ge-
winn gelangten Malers nur immer sein kann. Kümmer-
lich, unter Entbehrungen und Sorgen, hatte sie als
Lehrerin ihr Leben gefristet, obwohl sie mit ihren: zarten
Körper und ihrem empfindsamen Gemüth nur schlecht
gerüstet schien für den harten Kampf um's Dasein.
Ein Zufall hatte sie vor Jahren mit den: flotten jun-
gen Studenten zusammengeführt, und ihre feine, blumen-
hafte Schönheit hatte das leicht entzündliche Herz des
Musensohnes alsbald in Flammen gesetzt. Zuerst frei-
lich war ihm selber wohl kaum der Gedanke gekommen,
daß aus der unterhaltenden Tändelei ein Bund für das
ganze Leben werden könnte, aber er hatte dann doch
gar bald erkannt, daß Helene Horstmar keines von jenen
Mädchen sei, die man leichten Herzens ihrem Schicksal
überläßt, nachdem man eine Weile mit ihnen gespielt.
Er hatte allen Ernstes um sie geworben und ihr ewige
Treue geschworen, nachdem es ihm nicht ohne Mühe
gelungen war, ihr Jawort zu erhalten.
Darauf, daß er mit seinem Vater, einem harten,
in rastloser Arbeit reich gewordenen Manne, schwere
Kämpfe würde bestehen müssen, hatte er sich von vorn-
herein gefaßt gemacht. Aber die Entschiedenheit, nut
welcher der Fabrikant seine Einwilligung versagte, war
dann doch ein furchtbarer Schlag für die Hoffnungen
der beiden Verlobten gewesen. Wohl hatte Helene den:
geliebten Manne sein Wort zurückgeben wollen, um
ihn vor einem völligen Bruch mit dem Vater zu be-
wahren; Hans Behrend aber hatte sich standhaft ge-
weigert, das großmüthige Opfer anzunehmen, und sie
waren endlich übereingekommen, in treuer Liebe geduldig
auszuharren, bis er im Stande sein würde, sich ein
bescheidenes Heim aus eigener Kraft aufzubauen.
Auf den Tod des Mannes, der ihrem Glück im
Wege stand, hatten sie niemals gerechnet, und doch hätte
ihr Brautstand vielleicht noch ein Jahrzehnt hindurch
währen können, wenn nicht der Vater des Doktors eines
Tages mitten in seiner noch immer unermüdlichen Thü-
tigkeit von einem Schlaganfall heimgesucht worden und
nach mehrstündiger Bewußtlosigkeit verschieden wäre.
Ein Testament hatte er nicht hinterlassen, und so war
sein einziger Sohn als Universalerbe in den Besitz eines
Vermögens gelangt, dessen Größe alle seine Erwartun-
gen weit übertraf.
In seiner entfernteren Verwandtschaft hoffte man
jetzt allgemein, daß er sich von der armen Lehrerin
freimnchen würde, und es fehlte nicht an Versuchen
heirathslustiger junger Damen, ihn in ihre Netze zu
ziehen. Aber während des langen Trauerjahres hatte
der Doktor allen Verführungskünsten tapfer widerstan-
den, und seine Hochzeit, die heute mit Strömen von
perlendem Champagner im „Englischen Hause" gefeiert
wurde, machte alle die verschwiegenen Hoffnungen von
Helenens heimlichen Nebenbuhlerinnen unbarmherzig zu
Schanden.
Die junge Frau sah in ihrem weißen, von dem
langen, duftigen Schleier umwallten Brautkleide reizend
aus. Ein feines Roth lag auf ihren fast etwas zu
schmalen Wangen; aus den großen blauen Augen aber
leuchtete eine Glückseligkeit, die dem ganzen Gesichtchen
etwas beinahe Ueberirdisches gab. Sie hatte während
des lang ausgedehnten Hochzeitsmahles die aufgetrage-
nen Speisen kaum berührt; von dem Champagner je-
doch, mit dem der strahlende Gatte selbst ihr Kelchglas
füllte, hatte sie öfter trinken müssen, wenn die Freunde