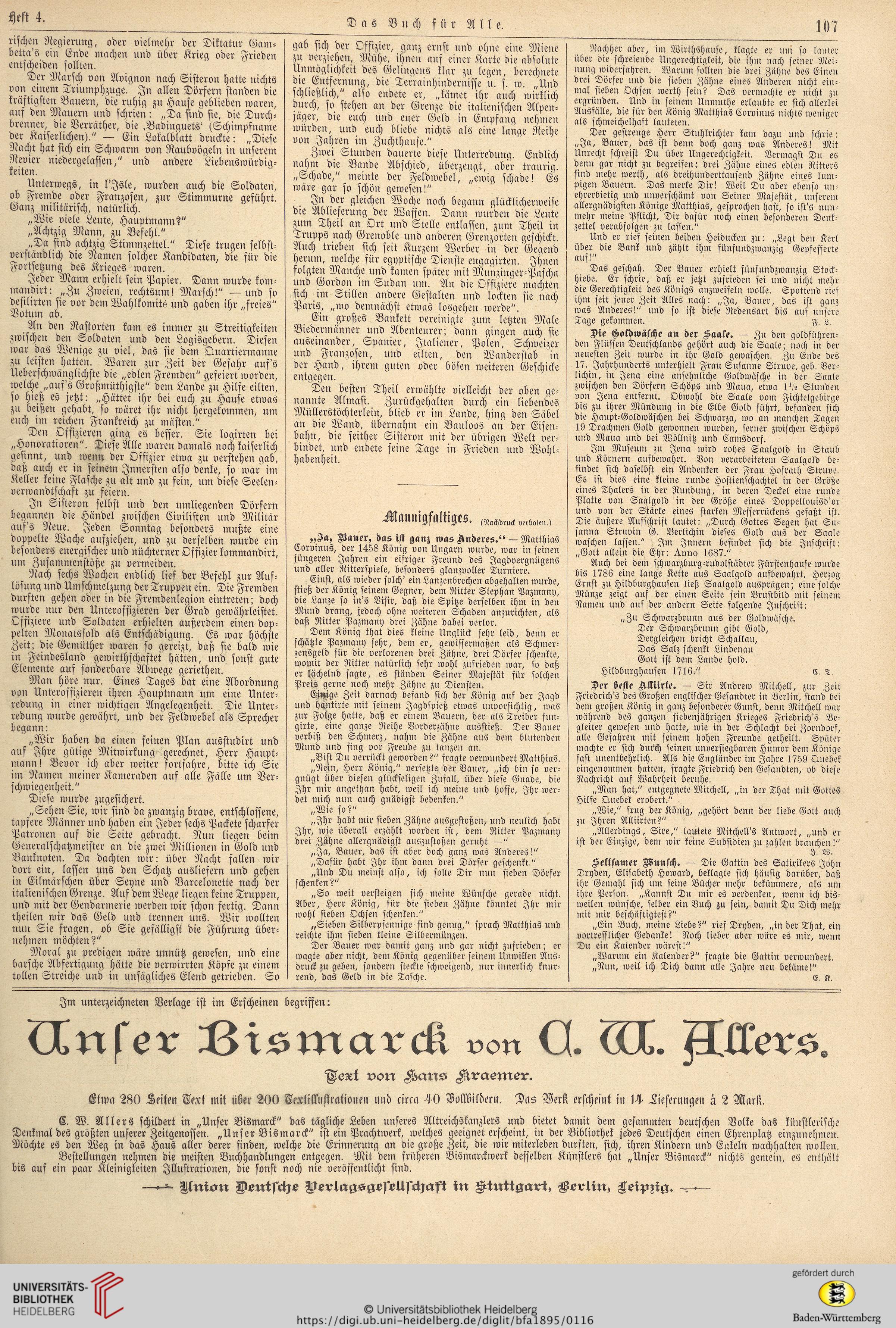Heft 4.
rischen Regierung, oder vielmehr der Diktatur Gam- !
betta's ein Ende machen und über Krieg oder Frieden
entscheiden sollten.
Der Marsch von Avignon nach Sisteron hatte nichts
von einem Triumphzuge. In allen Dörfern standen die
kräftigsten Bauern, die ruhig zu Hause geblieben waren,
auf den Mauern und schrien: „Da sind sie, die Durch-
brenner, die Verräther, die ,Badinguets' (Schimpfname
der Kaiserlichen)." — Ein Lokalblatt druckte: „Diese
Nacht hat sich ein Schwarm von Raubvögeln in unserem
Revier niedergelassen," und andere Liebenswürdig-
keiten.
Unterwegs, in l'Jsle, wurden auch die Soldaten,
ob Fremde oder Franzosen, zur Stimmurne geführt.
Ganz militärisch, natürlich.
„Wie viele Leute, Hauptmann?"
„Achtzig Mann, zu Befehl."
„Da sind achtzig Stimmzettel." Diese trugen selbst-
verständlich die Namen solcher Kandidaten, die für die
Fortsetzung des Krieges waren.
Jeder Mann erhielt sein Papier. Dann wurde kom-
mandirt: „Zu Zweien, rechtsum! Marsch!" — und so
defilirten sie vor dem Wahlkomitö und gaben ihr „freies"
Votum ab.
An den Rastorten kam es immer zu Streitigkeiten
zwischen den Soldaten und den Logisgebern. Diesen
war das Wenige zu viel, das sie dem Quartiermanne
zu leisten hatten. Waren zur Zeit der Gefahr auf's
Ueberschwänglichste die „edlen Fremden" gefeiert worden,
welche „auf's Großmüthigfte" dem Lande zu Hilfe eilten,
so hieß es jetzt: „Hättet ihr bei euch zu Hause etwas
zu beißen gehabt, so wäret ihr nicht hergekommen, um
euch im reichen Frankreich zu mästen."
Den Offizieren ging es besser. Sie logirten bei
„Honoratioren". Diese Alle waren damals noch kaiserlich
gesinnt, und wenn der Offizier etwa zu verstehen gab,
daß auch er in seinem Innersten also denke, so war im
Keller keine Flasche zu alt und zu fein, um diese Seelen-
verwandtschaft zu feiern.
In Sisteron selbst und den umliegenden Dörfern
begannen die Händel zwischen Civilisten und Militär
auf's Neue. Jeden Sonntag besonders mußte eine
doppelte Wache aufziehen, und zu derselben wurde ein
besonders energischer und nüchterner Offizier kommandirt,
um Zusammenstöße zu vermeiden.
Nach sechs Wochen endlich lief der Befehl zur Auf-
lösung und Umschmelzung der Truppen ein. Die Fremden
durften gehen oder in die Fremdenlegion eintreten; doch
wurde nur den Unteroffizieren der Grad gewährleistet.
Offiziere und Soldaten erhielten außerdem einen dop-
pelten Monatsfold als Entschädigung. Es war höchste
Zeit; die Gemüther waren so gereizt, daß sie bald wie
in Feindesland gewirthschaftet hätten, und sonst gute
Elemente auf sonderbare Abwege geriethen.
Man höre nur. Eines Tages bat eine Abordnung
von Unteroffizieren ihren Hauptmann um eine Unter-
redung in einer wichtigen Angelegenheit. Die Unter-
redung wurde gewährt, und der Feldwebel als Sprecher
begann:
„Wir haben da einen feinen Plan ausstudirt und
auf Ihre gütige Mitwirkung gerechnet, Herr Haupt-
mann! Bevor ich aber weiter fortfahre, bitte ich Sie
im Namen meiner Kameraden auf alle Fälle um Ver-
schwiegenheit."
Diese wurde zugesichert.
„Sehen Sie, wir sind da zwanzig brave, entschlossene,
tapfere Männer und haben ein Jeder sechs Pallete scharfer
Patronen auf die Seite gebracht. Nun liegen beim
Generalschatzmeister an die zwei Millionen in Gold und
Banknoten. Da dachten wir: über Nacht fallen wir
dort ein, lassen uns den Schatz ausliefern und gehen
in Eilmärschen über Seyne und Barcelonette nach der
italienischen Grenze. Auf dem Wege liegen keine Truppen,
und mit der Gendarmerie werden wir schon fertig. Dann
theilen wir das Geld und trennen uns. Wir wollten
nun Sie fragen, ob Sie gefälligst die Führung über-
nehmen möchten?"
Moral zu predigen wäre unnütz gewesen, und eine
barsche Abfertigung hätte die verwirrten Köpfe zu einem
tollen Streiche und in unsägliches Elend getrieben. So
Das Buch f ü r All e.
gab sich der Offizier, ganz ernst und ohne eine Miene
zu verziehen, Blühe, ihnen auf einer Karte die absolute
Unmöglichkeit des Gelingens klar zu legen, berechnete
die Entfernung, die Terrainhindernisse u. s. w. „Und
schließlich," also endete er, „kämet ihr auch wirklich
durch, so stehen an der Grenze die italienischen Alpen-
jäger, die euch und euer Geld in Empfang nehmen
würden, und euch bliebe nichts als eine lange Reihe
von Jahren im Zuchthause."
Zwei Stunden dauerte diese Unterredung. Endlich
nahm die Bande Abschied, überzeugt, aber traurig.
„Schade," meinte der Feldwebel, „'ewig schade! Es
wäre gar so schön gewesen!"
In der gleichen Woche noch begann glücklicherweise
die Ablieferung der Waffen. Dann wurden die Leute
zum Theil an Ort und Stelle entlassen, zum Theil in
Trupps nach Grenoble und anderen Grenzorten geschickt.
Auch trieben sich seit Kurzem Werber in der Gegend
herum, welche für egyptische Dienste engagirten. Ihnen
folgten Manche und kamen später mit Munzinger-Pascha
und Gordon im Sudan um. An die Offiziere machten
sich im Stillen andere Gestalten und lockten sie nach
Paris, „wo demnächst etwas losgehen werde".
Ein großes Bankett vereinigte zum letzten Male
Biedermänner und Abenteurer; dann gingen auch sie
auseinander, Spanier, Italiener, Polen, Schweizer
und Franzosen, und eilten, den Wanderstab in
der Hand, ihrem guten oder bösen weiteren Geschicke
entgegen.
Den besten Theil erwählte vielleicht der oben ge-
nannte Almafi. Zurückgehalten durch ein liebendes
Müllerstöchterlein, blieb er im Lande, hing den Säbel
an die Wand, übernahm ein Bauloos an der Eisen-
bahn, die seither Sisteron mit der übrigen Welt ver-
bindet, und endete seine Tage in Frieden und Wohl-
habenheit.
(Nachdruck verboten.)
„Aa, ILauer, das ist ganz was Anderes." — Matthias
Corvinus, der 1458 König von Ungarn wurde, war in seinen
jüngeren Jahren ein eifriger Freund des Jagdvergnügens
und aller Ritterspiele, besonders glanzvoller Turniere.
Einst, als wieder solch' ein Lanzenbrechen abgehalten wurde,
stieß der König seinem Gegner, dem Ritter Stephan Pazmany,
die Lanze so in's Visir, daß die Spitze derselben ihm in den
Mund drang, jedoch ohne weiteren Schaden anzurichten, als
daß Ritter Pazmany drei Zähne dabei verlor.
Dem König that dies kleine Unglück sehr leid, denn er
schätzte Pazmany sehr, dem er, gewissermaßen als Schmer-
zensgeld für die verlorenen drei Zähne, drei Dörfer schenkte,
womit der Ritter natürlich sehr wohl zufrieden war, so daß
er lächelnd sagte, es stünden Seiner Majestät für solchen
Preis gerne noch mehr Zähne zu Diensten.
Einige Zeit darnach befand sich der König auf der Jagd
und hantirte mit seinem Jagdspieß etwas unvorsichtig, was
zur Folge hatte, daß er einem Bauern, der als Treiber fun-
girte, eine ganze Reihe Vorderzähne ausstieß. Der Bauer
verbiß den Schmerz, nahm die Zähne aus dem blutenden
Mund und fing vor Freude zu tanzen an.
„Bist Du verrückt geworden?" fragte verwundert Matthias.
„Nein, Herr König," versetzte der Bauer, „ich bin so ver-
gnügt über diesen glückseligen Zufall, über diese Gnade, die
Ihr mir angethan habt, weil ich meine und hoffe, Ihr wer-
det mich nun auch gnädigst bedenken."
„Wie so?"
„Ihr habt mir sieben Zähne ausgestoßen, und neulich habt
Ihr, wie überall erzählt worden ist, dem Ritter Pazmany
drei Zähne allergnüdigst auszustoßen geruht —"
„Ja, Bauer, das ist aber doch ganz was Anderes!"
„Dafür habt Ihr ihm dann drei Dörfer geschenkt."
„Und Du meinst also, ich solle Dir nun sieben Dörfer
schenken?"
„So weit versteigen sich meine Wünsche gerade nicht.
Aber, Herr König, für die sieben Zähne könntet Ihr mir
wohl sieben Ochsen schenken."
„Sieben Silberpfennige sind genug," sprach Matthias und
reichte ihm sieben kleine Silbermünzen.
Der Bauer war damit ganz und gar nicht zufrieden; er
wagte aber nicht, dem König gegenüber seinem Unwillen Aus-
druck zu geben, sondern steckte schweigend, nur innerlich knur-
rend, das Geld in die Tasche.
107
Nachher aber, im Wirthshause, klagte er um so lauter
über die schreiende Ungerechtigkeit, die ihn: nach seiner Mei-
nung widerfahren. Warum sollten die drei Zähne des Einen
drei Dörfer und die sieben Zähne eines Anderen nicht ein-
mal sieben Ochsen werth sein? Das vermochte er nicht zu
ergründen. Und in seinem Unmuthe erlaubte er sich allerlei
Ausfälle, die für den König Matthias Corvinus nichts weniger
als schmeichelhaft lauteten.
Der gestrenge Herr Stuhlrichter kam dazu und schrie:
„Ja, Bauer, das ist denn doch ganz was Anderes! Mit
Unrecht schreist Du über Ungerechtigkeit. Vermagst Du es
denn gar nicht zu begreifen: drei Zähne eines edlen Ritters
sind mehr werth, als dreihunderttausend Zähne eines lum-
pigen Bauern. Das merke Dir! Weil Du aber ebenso un-
ehrerbietig und unverschämt von Seiner Majestät, unserem
alter-gnädigsten Könige Matthias, gesprochen hast, so ist's nun-
mehr meine Pflicht, Dir dafür noch einen besonderen Denk-
zettel verabfolgen zu lassen."
Und er rief seinen beiden Heiducken zu: „Legt den Kerl
über die Bank und zählt ihm fünfundzwanzig Gepfefferte
auf!"
Das geschah. Der Bauer erhielt fünfundzwanzig Stock-
hiebe. Er schrie, daß er jetzt zufrieden sei und nicht mehr
die Gerechtigkeit des Königs anzweifeln wolle. Spottend rief
ihm seit jener Zeit Alles nach: „Ja, Bauer, das ist ganz
was Anderes!" und so ist diese Redensart bis auf unsere
Tage gekommen. F. L.
Die Goldwäsche an der Sänke. — Zu den goldführen-
den Flüssen Deutschlands gehört auch die Saale; noch in der
neuesten Zeit wurde in ihr Gold gewaschen. Zu Ende des
17. Jahrhunderts unterhielt Frau Susanne Struve, geb. Ber-
lichin, in Jena eine ansehnliche Goldwäsche in der Saale
zwischen den Dörfern Schöps und Maua, etwa l'/s Stunden
von Jena entfernt. Obwohl die Saale vom Fichtelgebirge
bis zu ihrer Mündung in die Elbe Gold führt, befanden sich
die Haupt-Goldwäschen bei Schwarza, wo an manchen Tagen
19 Drachmen Gold gewonnen wurden, ferner zwischen Schöps
und Maua und bei Wöllnitz und Cainsdorf.
Im Museum zu Jena wird rohes Saalgold in Staub
und Körnern aufbewahrt. Von verarbeitetem Saalgold be-
findet sich daselbst ein Andenken der Frau Hofrath Struve.
Es ist dies eine kleine runde Hostienschachtel in der Größe
eines Thalers in der Rundung, in deren Deckel eine runde
Platte von Saalgold in der Größe eines Doppellouisd'or
und von der Stärke eines starken Messerrückens gefaßt ist.
Die äußere Aufschrift lautet: „Durch Gottes Segen hat Su-
sann« Struvin G. Berlichin dieses Gold aus der Saale
waschen lassen." Im Innern befindet sich die Inschrift:
„Gott allein die Ehr: ^miro 1687."
Auch bei dem schwarzburg-rudolstädter Fürstenhause wurde
bis 1786 eine lange Kette aus Saalgold aufbewahrt. Herzog
Ernst zu Hildburghausen ließ Snalgoid ausprügen; eine solche
Münze zeigt auf der einen Seite sein Brustbild mit seinem
Namen und auf der andern Seite folgende Inschrift:
„Zu Schwarzbrunn aus der Goldwäsche.
Der Schwarzbrunn gibt Gold,
Dergleichen bricht Schalkau,
Das Salz schenkt Lindenau
Gott ist dem Lande hold.
Hildburghausen 1716." b. T.
Jer beste ANirte. — Sir Andrew Mitchell, zur Zeit
Friedrich's des Großen englischer Gesandter in Berlin, stand bei
dem großen König in ganz besonderer Gunst, denn Mitchell war
während des ganzen siebenjährigen Krieges Friedrich's Be-
gleiter gewesen und hatte, wie in der Schlacht bei Zorndorf,
alle Gefahren mit seinem hohen Freunde getheilt. Später-
machte er sich durch seinen unversiegbaren Humor dem Könige
fast unentbehrlich. Als die Engländer im Jahre 1759 Quebek
eingenommen hatten, fragte Friedrich den Gesandten, ob diese
Nachricht auf Wahrheit beruhe.
„Man hat," entgegnete Mitchell, „in der That mit Gottes
Hilfe Quebek erobert."
„Wie," fruq der König, „gehört denn der liebe Gott auch
zu Ihren Alliirten?"
„Allerdings, Sire," lautete Mitchell's Antwort, „und er
ist der Einzige, dem wir keine Subsidien zu zahlen brauchen!"
I. W.
Seltsamer Wunsch. — Die Gattin des Satirikers John
Dryden, Elisabeth Howard, beklagte sich häufig darüber, daß
ihr Gemahl sich um seine Bücher mehr bekümmere, als um
ihre Person. „Kannst Du mir es verdenken, wenn ich bis-
weilen wünsche, selber ein Buch zu sein, damit Du Dich mehr
mit mir beschäftigtest?"
„Ein Buch, meine Liebe?" rief Dryden, „in der That, ein
vortrefflicher Gedanke! Noch lieber aber wäre es mir, wenn
Du ein Kalender wärest!"
„Warum ein Kalender?" fragte die Gattin verwundert.
„Nun, weil ich Dich dann alle Jahre neu bekäme!"
E. K.
Im unterzeichneten Verlage ist im Erscheinen begriffen:
Ajnser Visrncr^ck von El. Dellers.
GeXt von Kerns Kroenrer.
Etwa 280 Seiten Sext mit über 200 Sextillullralioueu und circa 40 Vollbildern. Das Werk erscheint in 14 Lieferungen L 2 Mark.
C W Allers schildert in „Unser Bismarck" das tägliche Leben unseres Altreichskanzlers und bietet damit dem gesammten deutschen Volke das künstlerische
Denkmal des größten unserer Zeitgenossen. „Unser Bismarck" ist ein Prachtwerk, welches geeigneterscheint, in der Bibliothek jedes Deutschen einen Ehrenplatz einzunehmen.
Möchte es den Weg in das Haus aller derer finden, welche die Erinnerung an die große Zert, die wir nnterleben durften, sich, ihren Kmdern und Enkeln wachhalten wollen.
Bestellungen nehmen die meisten Buchhandlungen entgegen. Mit dem früheren Bismarckwerk desselben Künstlers hat „Unser Bismarck" nichts gemein, es enthält
bis auf ein paar Kleinigkeiten Illustrationen, die sonst noch nie veröffentlicht sind.
—Union Deutsche UerlugsgeseUschust in Stuttgart» Berlin» Seipxig.
rischen Regierung, oder vielmehr der Diktatur Gam- !
betta's ein Ende machen und über Krieg oder Frieden
entscheiden sollten.
Der Marsch von Avignon nach Sisteron hatte nichts
von einem Triumphzuge. In allen Dörfern standen die
kräftigsten Bauern, die ruhig zu Hause geblieben waren,
auf den Mauern und schrien: „Da sind sie, die Durch-
brenner, die Verräther, die ,Badinguets' (Schimpfname
der Kaiserlichen)." — Ein Lokalblatt druckte: „Diese
Nacht hat sich ein Schwarm von Raubvögeln in unserem
Revier niedergelassen," und andere Liebenswürdig-
keiten.
Unterwegs, in l'Jsle, wurden auch die Soldaten,
ob Fremde oder Franzosen, zur Stimmurne geführt.
Ganz militärisch, natürlich.
„Wie viele Leute, Hauptmann?"
„Achtzig Mann, zu Befehl."
„Da sind achtzig Stimmzettel." Diese trugen selbst-
verständlich die Namen solcher Kandidaten, die für die
Fortsetzung des Krieges waren.
Jeder Mann erhielt sein Papier. Dann wurde kom-
mandirt: „Zu Zweien, rechtsum! Marsch!" — und so
defilirten sie vor dem Wahlkomitö und gaben ihr „freies"
Votum ab.
An den Rastorten kam es immer zu Streitigkeiten
zwischen den Soldaten und den Logisgebern. Diesen
war das Wenige zu viel, das sie dem Quartiermanne
zu leisten hatten. Waren zur Zeit der Gefahr auf's
Ueberschwänglichste die „edlen Fremden" gefeiert worden,
welche „auf's Großmüthigfte" dem Lande zu Hilfe eilten,
so hieß es jetzt: „Hättet ihr bei euch zu Hause etwas
zu beißen gehabt, so wäret ihr nicht hergekommen, um
euch im reichen Frankreich zu mästen."
Den Offizieren ging es besser. Sie logirten bei
„Honoratioren". Diese Alle waren damals noch kaiserlich
gesinnt, und wenn der Offizier etwa zu verstehen gab,
daß auch er in seinem Innersten also denke, so war im
Keller keine Flasche zu alt und zu fein, um diese Seelen-
verwandtschaft zu feiern.
In Sisteron selbst und den umliegenden Dörfern
begannen die Händel zwischen Civilisten und Militär
auf's Neue. Jeden Sonntag besonders mußte eine
doppelte Wache aufziehen, und zu derselben wurde ein
besonders energischer und nüchterner Offizier kommandirt,
um Zusammenstöße zu vermeiden.
Nach sechs Wochen endlich lief der Befehl zur Auf-
lösung und Umschmelzung der Truppen ein. Die Fremden
durften gehen oder in die Fremdenlegion eintreten; doch
wurde nur den Unteroffizieren der Grad gewährleistet.
Offiziere und Soldaten erhielten außerdem einen dop-
pelten Monatsfold als Entschädigung. Es war höchste
Zeit; die Gemüther waren so gereizt, daß sie bald wie
in Feindesland gewirthschaftet hätten, und sonst gute
Elemente auf sonderbare Abwege geriethen.
Man höre nur. Eines Tages bat eine Abordnung
von Unteroffizieren ihren Hauptmann um eine Unter-
redung in einer wichtigen Angelegenheit. Die Unter-
redung wurde gewährt, und der Feldwebel als Sprecher
begann:
„Wir haben da einen feinen Plan ausstudirt und
auf Ihre gütige Mitwirkung gerechnet, Herr Haupt-
mann! Bevor ich aber weiter fortfahre, bitte ich Sie
im Namen meiner Kameraden auf alle Fälle um Ver-
schwiegenheit."
Diese wurde zugesichert.
„Sehen Sie, wir sind da zwanzig brave, entschlossene,
tapfere Männer und haben ein Jeder sechs Pallete scharfer
Patronen auf die Seite gebracht. Nun liegen beim
Generalschatzmeister an die zwei Millionen in Gold und
Banknoten. Da dachten wir: über Nacht fallen wir
dort ein, lassen uns den Schatz ausliefern und gehen
in Eilmärschen über Seyne und Barcelonette nach der
italienischen Grenze. Auf dem Wege liegen keine Truppen,
und mit der Gendarmerie werden wir schon fertig. Dann
theilen wir das Geld und trennen uns. Wir wollten
nun Sie fragen, ob Sie gefälligst die Führung über-
nehmen möchten?"
Moral zu predigen wäre unnütz gewesen, und eine
barsche Abfertigung hätte die verwirrten Köpfe zu einem
tollen Streiche und in unsägliches Elend getrieben. So
Das Buch f ü r All e.
gab sich der Offizier, ganz ernst und ohne eine Miene
zu verziehen, Blühe, ihnen auf einer Karte die absolute
Unmöglichkeit des Gelingens klar zu legen, berechnete
die Entfernung, die Terrainhindernisse u. s. w. „Und
schließlich," also endete er, „kämet ihr auch wirklich
durch, so stehen an der Grenze die italienischen Alpen-
jäger, die euch und euer Geld in Empfang nehmen
würden, und euch bliebe nichts als eine lange Reihe
von Jahren im Zuchthause."
Zwei Stunden dauerte diese Unterredung. Endlich
nahm die Bande Abschied, überzeugt, aber traurig.
„Schade," meinte der Feldwebel, „'ewig schade! Es
wäre gar so schön gewesen!"
In der gleichen Woche noch begann glücklicherweise
die Ablieferung der Waffen. Dann wurden die Leute
zum Theil an Ort und Stelle entlassen, zum Theil in
Trupps nach Grenoble und anderen Grenzorten geschickt.
Auch trieben sich seit Kurzem Werber in der Gegend
herum, welche für egyptische Dienste engagirten. Ihnen
folgten Manche und kamen später mit Munzinger-Pascha
und Gordon im Sudan um. An die Offiziere machten
sich im Stillen andere Gestalten und lockten sie nach
Paris, „wo demnächst etwas losgehen werde".
Ein großes Bankett vereinigte zum letzten Male
Biedermänner und Abenteurer; dann gingen auch sie
auseinander, Spanier, Italiener, Polen, Schweizer
und Franzosen, und eilten, den Wanderstab in
der Hand, ihrem guten oder bösen weiteren Geschicke
entgegen.
Den besten Theil erwählte vielleicht der oben ge-
nannte Almafi. Zurückgehalten durch ein liebendes
Müllerstöchterlein, blieb er im Lande, hing den Säbel
an die Wand, übernahm ein Bauloos an der Eisen-
bahn, die seither Sisteron mit der übrigen Welt ver-
bindet, und endete seine Tage in Frieden und Wohl-
habenheit.
(Nachdruck verboten.)
„Aa, ILauer, das ist ganz was Anderes." — Matthias
Corvinus, der 1458 König von Ungarn wurde, war in seinen
jüngeren Jahren ein eifriger Freund des Jagdvergnügens
und aller Ritterspiele, besonders glanzvoller Turniere.
Einst, als wieder solch' ein Lanzenbrechen abgehalten wurde,
stieß der König seinem Gegner, dem Ritter Stephan Pazmany,
die Lanze so in's Visir, daß die Spitze derselben ihm in den
Mund drang, jedoch ohne weiteren Schaden anzurichten, als
daß Ritter Pazmany drei Zähne dabei verlor.
Dem König that dies kleine Unglück sehr leid, denn er
schätzte Pazmany sehr, dem er, gewissermaßen als Schmer-
zensgeld für die verlorenen drei Zähne, drei Dörfer schenkte,
womit der Ritter natürlich sehr wohl zufrieden war, so daß
er lächelnd sagte, es stünden Seiner Majestät für solchen
Preis gerne noch mehr Zähne zu Diensten.
Einige Zeit darnach befand sich der König auf der Jagd
und hantirte mit seinem Jagdspieß etwas unvorsichtig, was
zur Folge hatte, daß er einem Bauern, der als Treiber fun-
girte, eine ganze Reihe Vorderzähne ausstieß. Der Bauer
verbiß den Schmerz, nahm die Zähne aus dem blutenden
Mund und fing vor Freude zu tanzen an.
„Bist Du verrückt geworden?" fragte verwundert Matthias.
„Nein, Herr König," versetzte der Bauer, „ich bin so ver-
gnügt über diesen glückseligen Zufall, über diese Gnade, die
Ihr mir angethan habt, weil ich meine und hoffe, Ihr wer-
det mich nun auch gnädigst bedenken."
„Wie so?"
„Ihr habt mir sieben Zähne ausgestoßen, und neulich habt
Ihr, wie überall erzählt worden ist, dem Ritter Pazmany
drei Zähne allergnüdigst auszustoßen geruht —"
„Ja, Bauer, das ist aber doch ganz was Anderes!"
„Dafür habt Ihr ihm dann drei Dörfer geschenkt."
„Und Du meinst also, ich solle Dir nun sieben Dörfer
schenken?"
„So weit versteigen sich meine Wünsche gerade nicht.
Aber, Herr König, für die sieben Zähne könntet Ihr mir
wohl sieben Ochsen schenken."
„Sieben Silberpfennige sind genug," sprach Matthias und
reichte ihm sieben kleine Silbermünzen.
Der Bauer war damit ganz und gar nicht zufrieden; er
wagte aber nicht, dem König gegenüber seinem Unwillen Aus-
druck zu geben, sondern steckte schweigend, nur innerlich knur-
rend, das Geld in die Tasche.
107
Nachher aber, im Wirthshause, klagte er um so lauter
über die schreiende Ungerechtigkeit, die ihn: nach seiner Mei-
nung widerfahren. Warum sollten die drei Zähne des Einen
drei Dörfer und die sieben Zähne eines Anderen nicht ein-
mal sieben Ochsen werth sein? Das vermochte er nicht zu
ergründen. Und in seinem Unmuthe erlaubte er sich allerlei
Ausfälle, die für den König Matthias Corvinus nichts weniger
als schmeichelhaft lauteten.
Der gestrenge Herr Stuhlrichter kam dazu und schrie:
„Ja, Bauer, das ist denn doch ganz was Anderes! Mit
Unrecht schreist Du über Ungerechtigkeit. Vermagst Du es
denn gar nicht zu begreifen: drei Zähne eines edlen Ritters
sind mehr werth, als dreihunderttausend Zähne eines lum-
pigen Bauern. Das merke Dir! Weil Du aber ebenso un-
ehrerbietig und unverschämt von Seiner Majestät, unserem
alter-gnädigsten Könige Matthias, gesprochen hast, so ist's nun-
mehr meine Pflicht, Dir dafür noch einen besonderen Denk-
zettel verabfolgen zu lassen."
Und er rief seinen beiden Heiducken zu: „Legt den Kerl
über die Bank und zählt ihm fünfundzwanzig Gepfefferte
auf!"
Das geschah. Der Bauer erhielt fünfundzwanzig Stock-
hiebe. Er schrie, daß er jetzt zufrieden sei und nicht mehr
die Gerechtigkeit des Königs anzweifeln wolle. Spottend rief
ihm seit jener Zeit Alles nach: „Ja, Bauer, das ist ganz
was Anderes!" und so ist diese Redensart bis auf unsere
Tage gekommen. F. L.
Die Goldwäsche an der Sänke. — Zu den goldführen-
den Flüssen Deutschlands gehört auch die Saale; noch in der
neuesten Zeit wurde in ihr Gold gewaschen. Zu Ende des
17. Jahrhunderts unterhielt Frau Susanne Struve, geb. Ber-
lichin, in Jena eine ansehnliche Goldwäsche in der Saale
zwischen den Dörfern Schöps und Maua, etwa l'/s Stunden
von Jena entfernt. Obwohl die Saale vom Fichtelgebirge
bis zu ihrer Mündung in die Elbe Gold führt, befanden sich
die Haupt-Goldwäschen bei Schwarza, wo an manchen Tagen
19 Drachmen Gold gewonnen wurden, ferner zwischen Schöps
und Maua und bei Wöllnitz und Cainsdorf.
Im Museum zu Jena wird rohes Saalgold in Staub
und Körnern aufbewahrt. Von verarbeitetem Saalgold be-
findet sich daselbst ein Andenken der Frau Hofrath Struve.
Es ist dies eine kleine runde Hostienschachtel in der Größe
eines Thalers in der Rundung, in deren Deckel eine runde
Platte von Saalgold in der Größe eines Doppellouisd'or
und von der Stärke eines starken Messerrückens gefaßt ist.
Die äußere Aufschrift lautet: „Durch Gottes Segen hat Su-
sann« Struvin G. Berlichin dieses Gold aus der Saale
waschen lassen." Im Innern befindet sich die Inschrift:
„Gott allein die Ehr: ^miro 1687."
Auch bei dem schwarzburg-rudolstädter Fürstenhause wurde
bis 1786 eine lange Kette aus Saalgold aufbewahrt. Herzog
Ernst zu Hildburghausen ließ Snalgoid ausprügen; eine solche
Münze zeigt auf der einen Seite sein Brustbild mit seinem
Namen und auf der andern Seite folgende Inschrift:
„Zu Schwarzbrunn aus der Goldwäsche.
Der Schwarzbrunn gibt Gold,
Dergleichen bricht Schalkau,
Das Salz schenkt Lindenau
Gott ist dem Lande hold.
Hildburghausen 1716." b. T.
Jer beste ANirte. — Sir Andrew Mitchell, zur Zeit
Friedrich's des Großen englischer Gesandter in Berlin, stand bei
dem großen König in ganz besonderer Gunst, denn Mitchell war
während des ganzen siebenjährigen Krieges Friedrich's Be-
gleiter gewesen und hatte, wie in der Schlacht bei Zorndorf,
alle Gefahren mit seinem hohen Freunde getheilt. Später-
machte er sich durch seinen unversiegbaren Humor dem Könige
fast unentbehrlich. Als die Engländer im Jahre 1759 Quebek
eingenommen hatten, fragte Friedrich den Gesandten, ob diese
Nachricht auf Wahrheit beruhe.
„Man hat," entgegnete Mitchell, „in der That mit Gottes
Hilfe Quebek erobert."
„Wie," fruq der König, „gehört denn der liebe Gott auch
zu Ihren Alliirten?"
„Allerdings, Sire," lautete Mitchell's Antwort, „und er
ist der Einzige, dem wir keine Subsidien zu zahlen brauchen!"
I. W.
Seltsamer Wunsch. — Die Gattin des Satirikers John
Dryden, Elisabeth Howard, beklagte sich häufig darüber, daß
ihr Gemahl sich um seine Bücher mehr bekümmere, als um
ihre Person. „Kannst Du mir es verdenken, wenn ich bis-
weilen wünsche, selber ein Buch zu sein, damit Du Dich mehr
mit mir beschäftigtest?"
„Ein Buch, meine Liebe?" rief Dryden, „in der That, ein
vortrefflicher Gedanke! Noch lieber aber wäre es mir, wenn
Du ein Kalender wärest!"
„Warum ein Kalender?" fragte die Gattin verwundert.
„Nun, weil ich Dich dann alle Jahre neu bekäme!"
E. K.
Im unterzeichneten Verlage ist im Erscheinen begriffen:
Ajnser Visrncr^ck von El. Dellers.
GeXt von Kerns Kroenrer.
Etwa 280 Seiten Sext mit über 200 Sextillullralioueu und circa 40 Vollbildern. Das Werk erscheint in 14 Lieferungen L 2 Mark.
C W Allers schildert in „Unser Bismarck" das tägliche Leben unseres Altreichskanzlers und bietet damit dem gesammten deutschen Volke das künstlerische
Denkmal des größten unserer Zeitgenossen. „Unser Bismarck" ist ein Prachtwerk, welches geeigneterscheint, in der Bibliothek jedes Deutschen einen Ehrenplatz einzunehmen.
Möchte es den Weg in das Haus aller derer finden, welche die Erinnerung an die große Zert, die wir nnterleben durften, sich, ihren Kmdern und Enkeln wachhalten wollen.
Bestellungen nehmen die meisten Buchhandlungen entgegen. Mit dem früheren Bismarckwerk desselben Künstlers hat „Unser Bismarck" nichts gemein, es enthält
bis auf ein paar Kleinigkeiten Illustrationen, die sonst noch nie veröffentlicht sind.
—Union Deutsche UerlugsgeseUschust in Stuttgart» Berlin» Seipxig.