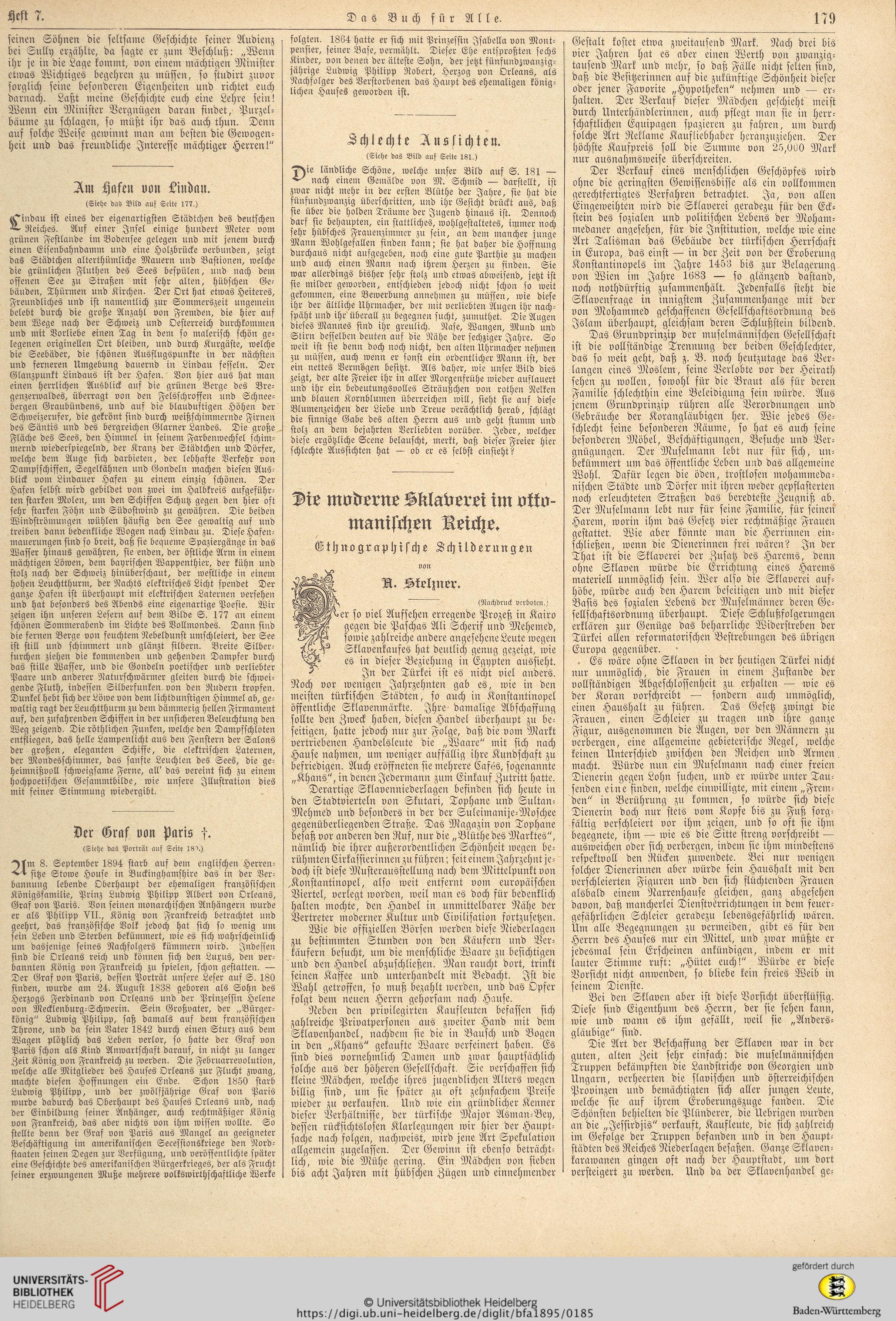179
Heft 7.
seinen Söhnen die seltsame Geschichte seiner Audienz
bei Sully erzählte, da sagte er zum Beschluß: „Wenn
ihr je in die Lage kommt, von einem mächtigen Minister
etwas Wichtiges begehren zu müssen, so studirt zuvor
sorglich seine besonderen Eigenheiten und richtet euch
darnach. Laßt meine Geschichte euch eine Lehre sein!
Wenn ein Minister Vergnügen daran findet, Purzel-
bäume zu schlagen, so müßt ihr das auch thun. Denn
auf solche Weise gewinnt man am besten die Gewogen-
heit und das freundliche Interesse mächtiger Herren!"
Am Hafen von Lindan.
(Siehe das Bild auf Seite 177.)
«Lindau ist eines der eigenartigsten Städtchen des deutschen
Reiches. Auf einer Insel einige hundert Meter vom
grünen Festlande im Bodensee gelegen und mit jenem durch
einen Eisenbahndamm und eine Holzbrücke verbunden, zeigt
das Städtchen alterthümliche Mauern und Bastionen, welche
die grünlichen Flnthen des Sees bespülen, und nach dem
offenen See zu Straßen mit sehr alten, hübschen Ge-
bäuden, Thürmen und Kirchen. Der Ort hat etwas Heiteres,
Freundliches und ist namentlich zur Sommerszeit ungemein
belebt durch die große Anzahl von Fremden, die hier auf
dem Wege nach der Schweiz und Oesterreich durchkommen
und mit Vorliebe einen Tag in dem so malerisch schön ge-
legenen originellen Ort bleiben, und durch Kurgäste, welche
die Seebäder, die schönen Ausflugspunkte in der nächsten
und ferneren Umgebung dauernd in Lindau fesseln. Der
Glanzpunkt Lindaus ist der Hafen. Von hier aus hat man
einen herrlichen Ausblick aus die grünen Berge des Bre-
genzerwaldes, überragt von den Felsschrosfen und Schnee-
bergen Graubündens, und aus die blauduftigen Höhen der
Schweizerufer, die gekrönt sind durch weißschimmernde Firnen
des Säntis und des bergreichen Glarner Landes. Die große
Fläche des Sees, den Himmel in seinem Farbenwechsel schim-
mernd wiederspiegelnd, der Kranz der Städtchen und Dörfer,
welche dem Auge sich darbieten, der lebhafte Verkehr von
Dampfschiffen, Segelkähnen und Gondeln machen diesen Aus-
blick vom Lindauer Hafen zu einem einzig schönen. Der
Hasen selbst wird gebildet von zwei im Halbkreis ausgeführ-
ten starken Molen, um den Schiffen Schutz gegen den hier oft
sehr starken Föhn und Südostwind zu gewähren. Die beiden
Windströmungen wühlen häusig den See gewaltig aus und
treiben dann bedenkliche Wogen nach Lindau zu. Diese Hasen-
mauerungen sind so breit, daß sie bequeme Spaziergänge in das
Wasser hinaus gewähren, sie enden, der östliche Arm in einem
mächtigen Löwen, dem bayrischen Wappenthier, der kühn und
stolz nach der Schweiz hinüberschaut, der westliche in einem
hohen Leuchtthurm, der Nachts elektrisches Licht spendet Der
ganze Hafen ist überhaupt mit elektrischen Laternen versehen
und hat besonders des Abends eine eigenartige Poesie. Wir
zeigen ihn unseren Lesern auf dem Bilde S. 177 an einem
schönen Sommerabend im Lichte des Vollmondes. Dann sind
die fernen Berge von feuchtem Nebeldunst umschleiert, der See
ist still und schimmert und glänzt silbern. Breite Silber-
furchen ziehen die kommenden und gehenden Dampfer durch
das stille Wasser, und die Gondeln poetischer und verliebter
Paare und anderer Naturschwärmer gleiten durch die schwei-
gende Fluth, indessen Silberfunken von den Rudern tropfen.
Dunkel hebt sich der Löwe von dem lichtdunstigen Himmel ab, ge-
waltig ragt der Leuchtthurm zu dem dämmerig Hellen Firmament
auf, den zufahrenden Schiffen in der unsicheren Beleuchtung den
Weg zeigend. Die röthlichen Funken, welche den Dampfschloten
entfliegen, das Helle Lampenlicht aus den Fenstern der Salons
der großen, eleganten Schiffe, die elektrischen Laternen,
der Mondesschimmer, das sanfte Leuchten des Sees, die ge-
heimnißvoll schweigsame Ferne, all' das vereint sich zu einem
hochpoetischen Gesammtbilde, wie unsere Illustration dies
mit feiner Stimmung wiedergibt.
Der Graf von Paris
8. September 1894 starb auf dem englischen Herren-
sitze Stowe House in Buckinghamshire das in der Ver-
bannung lebende Oberhaupt der ehemaligen französischen
Königsfamilie, Prinz Ludwig Philipp Albert von Orleans,
Graf von Paris. Von seinen monarchischen Anhängern wurde
er als Philipp VII., König von Frankreich betrachtet und
geehrt, das französische Volk jedoch hat sich so wenig um
sein Leben und Sterben bekümmert, wie es sich wahrscheinlich
um dasjenige seines Nachfolgers kümmern wird. Indessen
sind die Orleans reich und können sich den Luxus, den ver-
bannten König von Frankreich zu spielen, schon gestatten. —
Der Graf von Paris, dessen Porträt unsere Leser auf S. 180
finden, wurde am 24. August 1838 geboren als Sohn des
Herzogs Ferdinand von Orleans und der Prinzessin Helene
von Mecklenburg-Schwerin. Sein Großvater, der „Bürger-
könig" Ludwig Philipp, saß damals auf dem französischen
Throne, und da sein Vater 1842 durch einen Sturz aus dem
Wagen plötzlich das Leben verlor, so hatte der Graf von
Paris schon als Kind Anwartschaft darauf, in nicht zu langer
Zeit König von Frankreich zu werden. Die Februarrevolution,
welche alle Mitglieder des Hauses Orleans zur Flucht zwang,
machte diesen Hoffnungen ein Ende. Schon 1850 starb
Ludwig Philipp, und der zwölfjährige Graf von Paris
wurde dadurch das Oberhaupt des Hauses Orleans und, nach
der Einbildung seiner Anhänger, auch rechtmäßiger König
von Frankreich, das aber nichts von ihm wissen wollte. So
stellte denn der Graf von Paris aus Mangel an geeigneter
Beschäftigung im amerikanischen Secessionskriege den Nord-
staaten seinen Degen zur Verfügung, und veröffentlichte später
eine Geschichte des amerikanischen Bürgerkrieges, der als Frucht
feiner erzwungenen Muße mehrere volkswirthschaftliche Werke
Das Buch für Alle.
folgten. 1864 hatte er sich mit Prinzessin Isabella von Mont-
pensier, seiner Base, vermählt. Dieser Ehe entsproßten sechs
Kinder, von denen der älteste Sohn, der jetzt fünfundzwanzig-
jährige Ludwig Philipp Robert, Herzog von Orleans, als
Nachfolger des Verstorbenen das Haupt des ehemaligen könig-
lichen Hauses geworden ist.
Schlechte Aussichten.
(Siehe das Bild auf Seite 181.)
?>ie ländliche Schöne, welche unser Bild auf S. 181 —
nach einem Gemälde von M. Schmid — darstellt, ist
zwar nicht mehr in der ersten Blüthe der Jahre, sie hat die
fünfundzwanzig überschritten, und ihr Gesicht drückt aus, daß
sie über die holden Träume der Jugend hinaus ist. Dennoch
darf sie behaupten, ein stattliches, wohlgestaltetes, immer noch
sehr hübsches Frauenzimmer zu sein, an dem mancher junge
Mann Wohlgefallen finden kann; sie hat daher die Hoffnung
durchaus nicht aufgegeben, noch eine gute Parthie zu machen
und auch einen Mann nach ihrem Herzen zu finden. Sie
war allerdings bisher sehr stolz und etwas abweisend, jetzt ist
sie milder geworden, entschieden jedoch nicht schon so weit
gekommen, eine Bewerbung annehmen zu müssen, wie diese
ihr der ältliche Uhrmacher, der mit verliebten Augen ihr nach-
späht und ihr überall zu begegnen sucht, zumnthet. Die Augen
dieses Mannes sind ihr greulich. Nase, Wangen, Mund und
Stirn desselben deuten auf die Nähe der sechziger Jahre. So
weit ist sie denn doch noch nicht, den alten Uhrmacher nehmen
zu müssen, auch wenn er sonst ein ordentlicher Mann ist, der
ein nettes Vermögen besitzt. Als daher, wie unser Bild dies
zeigt, der alte Freier ihr in aller Morgenfrühe wieder auflauert
und ihr ein bedeutungsvolles Sträußchen von rothen Nelken
und blauen Kornblumen überreichen will, sieht sie auf diese
Blumenzeichen der Liebe und Treue verächtlich herab, schlägt
die sinnige Gabe des alten Herrn aus und geht stumm und
stolz an dem bejahrten Verliebten vorüber. Jeder, welcher
diese ergötzliche Scene belauscht, merkt, daß dieser Freier hier
schlechte Aussichten hat — ob er es selbst einsieht?
Die moderne Sklaverei im olko-
manischen Reiche.
Ethnographische Schilderungen
von
A. Stelzner.
er so viel Aufsehen erregende Prozeß in Kairo
gegen die Paschas Ali Scherif und Mehemed,
sowie zahlreiche andere angesehene Leute wegen
Sklavenkauses hat deutlich genug gezeigt, wie
es in dieser Beziehung in Egypten aussieht.
In der Türkei ist es nicht viel anders.
Noch vor wenigen Jahrzehnten gab es, wie in den
meisten türkischen Städten, so auch in Konstantinopel
öffentliche Sklavenmärkte. Ihre damalige Abschaffung
sollte den Zweck haben, diesen Handel überhaupt zu be-
seitigen, hatte jedoch nur zur Folge, daß die vom Markt
vertriebenen Handelsleute die „Waare" mit sich nach
Hause nahmen, um weniger auffällig ihre Kundschaft zu
befriedigen. Auch eröffneten sie mehrere Cafos, sogenannte
„Khans", in denen Jedermann zum Einkauf Zutritt hatte.
Derartige Sklavenniederlagen befinden sich heute in
den Stadtvierteln von Skutari, Tophane und Sultan-
Mehmed und besonders in der der Suleimanije-Moschee
gegenüberliegenden Straße. Das Magazin von Tophane
besaß vor anderen den Ruf, nur die „Blüthe des Marktes",
nämlich die ihrer außerordentlichen Schönheit wegen be-
rühmten Cirkassierinnen zu führen; seit einem Jahrzehnt je-
doch ist diese Musterausstellung nach dem Mittelpunkt von
,Konstantinopel, also weit entfernt vom europäischen
Viertel, verlegt worden, weil man es doch für bedenklich
halten mochte, den Handel in unmittelbarer Nähe der
Vertreter moderner Kultur und Civilisation fortzusetzen.
Wie die offiziellen Börsen werden diese Niederlagen
zu bestimmten Stunden von den Käufern und Ver-
käufern besucht, um die menschliche Waare zu besichtigen
und den Handel abzuschließen. Man raucht dort, trinkt
seinen Kaffee und unterhandelt mit Bedacht. Ist die
Wahl getroffen, so muß bezahlt werden, und das Opfer
folgt dem neuen Herrn gehorsam nach Hause.
Neben den privilegirten Kaufleuten befassen sich
zahlreiche Privatpersonen aus zweiter Hand mit dem
Sklavenhandel, nachdem sie die in Bausch und Bogen
in den „Khans" gekaufte Waare verfeinert haben. Es
sind dies vornehmlich Damen und zwar hauptsächlich
solche aus der höheren Gesellschaft. Sie verschaffen sich
kleine Mädchen, welche ihres jugendlichen Alters wegen
billig sind, um sie später zu oft zehnfachem Preise
wieder zu verkaufen. Und wie ein gründlicher Kenner
dieser Verhältnisse, der türkische Major Asman-Bey,
dessen rücksichtslosen Klarlegungen wir hier der Haupt-
sache nach folgen, nnchweist, wird jene Art Spekulation
allgemein zugelassen. Der Gewinn ist ebenso beträcht-
lich, wie die Mühe gering. Ein Mädchen von sieben
bis acht Jahren mit hübschen Zügen und einnehmender
Gestalt kostet etwa zweitausend Mark. Nach drei bis
vier Jahren hat es aber einen Werth von zwanzig-
tausend Mark und mehr, so daß Fälle nicht selten sind,
daß die Besitzerinnen auf die zukünftige Schönheit dieser
oder jener Favorite „Hypotheken" nehmen und — er-
halten. Der Verkauf dieser Mädchen geschieht meist
durch Unterhändlerinnen, auch pflegt man sie in herr-
schaftlichen Equipagen spazieren zu fahren, um durch
solche Art Reklame Kaufliebhaber heranzuziehen. Der
höchste Kaufpreis soll die Summe von 25,000 Mark
nur ausnahmsweise überschreiten.
Der Verkauf eines menschlichen Geschöpfes wird
ohne die geringsten Gewissensbisse als ein vollkommen
gerechtfertigtes' Verfahren betrachtet. Ja, von allen
Eingeweihten wird die Sklaverei geradezu für den Eck-
stein des sozialen und politischen Lebens der Moham-
medaner angesehen, für die Institution, welche wie eine
Art Talisman das Gebäude der türkischen Herrschaft
in Europa, das einst — in der Zeit von der Eroberung
Konstantinopels im Jahre 1453 bis zur Belagerung
von Wien im Jahre 1683 — so glänzend dastand,
noch nothdürftig zusammenhält. Jedenfalls steht die
Sklavenfrage in innigstem Zusammenhänge mit der
von Mohammed geschaffenen Gesellschaftsordnung des
Islam überhaupt, gleichsam deren Schlußstein bildend.
Das Grundprinzip der muselmännischen Gesellschaft
ist die vollständige Trennung der beiden Geschlechter,
das so weit geht, daß z. B. noch heutzutage das Ver-
langen eines Moslem, seine Verlobte vor der Heirath
sehen zu wollen, sowohl für die Braut als für deren
Familie schlechthin eine Beleidigung sein würde. Aus
jenem Grundprinzip rühren alle Verordnungen und
Gebräuche der Korangläubigen her. Wie jedes Ge-
schlecht seine besonderen Räume, so hat es auch seine
besonderen Möbel, Beschäftigungen, Besuche und Ver-
gnügungen. Der Muselmann lebt nur für sich, un-
bekümmert um das öffentliche Leben und das allgemeine
Wohl. Dafür legen die öden, trostlosen mohammeda-
nischen Städte und Dörfer mit ihren weder gepflasterten
noch erleuchteten Straßen das beredteste Zeugniß ab.
Der Muselmann lebt nur für seine Familie, für seinen
Harem, worin ihm das Gesetz vier rechtmäßige Frauen
gestattet. Wie aber könnte man die Herrinnen ein-
fchließen, wenn die Dienerinnen frei wären? In der
That ist die Sklaverei der Zusatz des Harems, denn
ohne Sklaven würde die Errichtung eines Harems
materiell unmöglich sein. Wer also die Sklaverei auf-
höbe, würde auch den Harem beseitigen und mit dieser
Basis des sozialen Lebens der Muselmänner deren Ge-
sellschaftsordnung überhaupt. Diese Schlußfolgerungen
erklären zur Genüge das beharrliche Widerstreben der
Türkei allen reformatorischen Bestrebungen des übrigen
Europa gegenüber.
Es wäre ohne Sklaven in der heutigen Türkei nicht
nur unmöglich, die Frauen in einem Zustande der
vollständigen Abgeschlossenheit zu erhalten —- wie es
der Koran vorschreibt — sondern auch unmöglich,
einen Haushalt zu führen. Das Gesetz zwingt die
Frauen, einen Schleier zu tragen und ihre ganze
Figur, ausgenommen die Augen, vor den Männern zu
verbergen, eine allgemeine gebieterische Regel, welche
keinen Unterschied zwischen den Reichen und Armen
macht. Würde nun ein Muselmann nach einer freien
Dienerin gegen Lohn suchen, und er würde unter Tau-
senden eine finden, welche einwilligte, mit einem „Frem-
den" in Berührung zu kommen, so würde sich diese
Dienerin doch nur stets vom Kopfe bis zu Fuß sorg-
fältig verschleiert vor ihm zeigen, und so oft sie ihm
begegnete, ihm — wie es die Sitte streng vorschreibt —
ausweichen oder sich verbergen, indem sie ihm mindestens
respektvoll den Rücken zuwendete. Bei nur wenigen
solcher Dienerinnen aber würde sein Haushalt mit den
verschleierten Figuren und den sich flüchtenden Frauen
alsbald einem Narrenhause gleichen, ganz abgesehen
davon, daß mancherlei Dienstverrichtungen in dem feuer-
gefährlichen Schleier geradezu lebensgefährlich wären.
Um alle Begegnungen zu vermeiden, gibt es für den
Herrn des Hauses nur ein Mittel, und zwar müßte er
jedesmal sein Erscheinen ankündigen, indem er mit
lauter Stimme ruft: „Hütet euch!" Würde er diese
Vorsicht nicht anwenden, so bliebe kein freies Weib in
seinem Dienste.
Bei den Sklaven aber ist diese Vorsicht überflüssig.
Diese sind Eigenthum des Herrn, der sie sehen kann,
wie und wann es ihm gefällt, weil sie „Anders-
gläubige" sind.
Die Art der Beschaffung der Sklaven war in der
guten, alten Zeit sehr einfach: die muselmännischen
Truppen bekämpften die Landstriche von Georgien und
Ungarn, verheerten die slavischen und österreichischen
Provinzen und bemächtigten sich aller jungen Leute,
welche sie auf ihrem Eroberungszuge fanden. Die
Schönsten behielten die Plünderer, die Uebrigen wurden
an die „Jessirdjis" verkauft, Kaufleute, die sich zahlreich
im Gefolge der Truppen befanden und in den Haupt-
städten des Reiches Niederlagen besaßen. Ganze Sklaven-
karawanen gingen oft nach der Hauptstadt, um dort
versteigert zu werden. Und da der Sklavenhandel ge-
Heft 7.
seinen Söhnen die seltsame Geschichte seiner Audienz
bei Sully erzählte, da sagte er zum Beschluß: „Wenn
ihr je in die Lage kommt, von einem mächtigen Minister
etwas Wichtiges begehren zu müssen, so studirt zuvor
sorglich seine besonderen Eigenheiten und richtet euch
darnach. Laßt meine Geschichte euch eine Lehre sein!
Wenn ein Minister Vergnügen daran findet, Purzel-
bäume zu schlagen, so müßt ihr das auch thun. Denn
auf solche Weise gewinnt man am besten die Gewogen-
heit und das freundliche Interesse mächtiger Herren!"
Am Hafen von Lindan.
(Siehe das Bild auf Seite 177.)
«Lindau ist eines der eigenartigsten Städtchen des deutschen
Reiches. Auf einer Insel einige hundert Meter vom
grünen Festlande im Bodensee gelegen und mit jenem durch
einen Eisenbahndamm und eine Holzbrücke verbunden, zeigt
das Städtchen alterthümliche Mauern und Bastionen, welche
die grünlichen Flnthen des Sees bespülen, und nach dem
offenen See zu Straßen mit sehr alten, hübschen Ge-
bäuden, Thürmen und Kirchen. Der Ort hat etwas Heiteres,
Freundliches und ist namentlich zur Sommerszeit ungemein
belebt durch die große Anzahl von Fremden, die hier auf
dem Wege nach der Schweiz und Oesterreich durchkommen
und mit Vorliebe einen Tag in dem so malerisch schön ge-
legenen originellen Ort bleiben, und durch Kurgäste, welche
die Seebäder, die schönen Ausflugspunkte in der nächsten
und ferneren Umgebung dauernd in Lindau fesseln. Der
Glanzpunkt Lindaus ist der Hafen. Von hier aus hat man
einen herrlichen Ausblick aus die grünen Berge des Bre-
genzerwaldes, überragt von den Felsschrosfen und Schnee-
bergen Graubündens, und aus die blauduftigen Höhen der
Schweizerufer, die gekrönt sind durch weißschimmernde Firnen
des Säntis und des bergreichen Glarner Landes. Die große
Fläche des Sees, den Himmel in seinem Farbenwechsel schim-
mernd wiederspiegelnd, der Kranz der Städtchen und Dörfer,
welche dem Auge sich darbieten, der lebhafte Verkehr von
Dampfschiffen, Segelkähnen und Gondeln machen diesen Aus-
blick vom Lindauer Hafen zu einem einzig schönen. Der
Hasen selbst wird gebildet von zwei im Halbkreis ausgeführ-
ten starken Molen, um den Schiffen Schutz gegen den hier oft
sehr starken Föhn und Südostwind zu gewähren. Die beiden
Windströmungen wühlen häusig den See gewaltig aus und
treiben dann bedenkliche Wogen nach Lindau zu. Diese Hasen-
mauerungen sind so breit, daß sie bequeme Spaziergänge in das
Wasser hinaus gewähren, sie enden, der östliche Arm in einem
mächtigen Löwen, dem bayrischen Wappenthier, der kühn und
stolz nach der Schweiz hinüberschaut, der westliche in einem
hohen Leuchtthurm, der Nachts elektrisches Licht spendet Der
ganze Hafen ist überhaupt mit elektrischen Laternen versehen
und hat besonders des Abends eine eigenartige Poesie. Wir
zeigen ihn unseren Lesern auf dem Bilde S. 177 an einem
schönen Sommerabend im Lichte des Vollmondes. Dann sind
die fernen Berge von feuchtem Nebeldunst umschleiert, der See
ist still und schimmert und glänzt silbern. Breite Silber-
furchen ziehen die kommenden und gehenden Dampfer durch
das stille Wasser, und die Gondeln poetischer und verliebter
Paare und anderer Naturschwärmer gleiten durch die schwei-
gende Fluth, indessen Silberfunken von den Rudern tropfen.
Dunkel hebt sich der Löwe von dem lichtdunstigen Himmel ab, ge-
waltig ragt der Leuchtthurm zu dem dämmerig Hellen Firmament
auf, den zufahrenden Schiffen in der unsicheren Beleuchtung den
Weg zeigend. Die röthlichen Funken, welche den Dampfschloten
entfliegen, das Helle Lampenlicht aus den Fenstern der Salons
der großen, eleganten Schiffe, die elektrischen Laternen,
der Mondesschimmer, das sanfte Leuchten des Sees, die ge-
heimnißvoll schweigsame Ferne, all' das vereint sich zu einem
hochpoetischen Gesammtbilde, wie unsere Illustration dies
mit feiner Stimmung wiedergibt.
Der Graf von Paris
8. September 1894 starb auf dem englischen Herren-
sitze Stowe House in Buckinghamshire das in der Ver-
bannung lebende Oberhaupt der ehemaligen französischen
Königsfamilie, Prinz Ludwig Philipp Albert von Orleans,
Graf von Paris. Von seinen monarchischen Anhängern wurde
er als Philipp VII., König von Frankreich betrachtet und
geehrt, das französische Volk jedoch hat sich so wenig um
sein Leben und Sterben bekümmert, wie es sich wahrscheinlich
um dasjenige seines Nachfolgers kümmern wird. Indessen
sind die Orleans reich und können sich den Luxus, den ver-
bannten König von Frankreich zu spielen, schon gestatten. —
Der Graf von Paris, dessen Porträt unsere Leser auf S. 180
finden, wurde am 24. August 1838 geboren als Sohn des
Herzogs Ferdinand von Orleans und der Prinzessin Helene
von Mecklenburg-Schwerin. Sein Großvater, der „Bürger-
könig" Ludwig Philipp, saß damals auf dem französischen
Throne, und da sein Vater 1842 durch einen Sturz aus dem
Wagen plötzlich das Leben verlor, so hatte der Graf von
Paris schon als Kind Anwartschaft darauf, in nicht zu langer
Zeit König von Frankreich zu werden. Die Februarrevolution,
welche alle Mitglieder des Hauses Orleans zur Flucht zwang,
machte diesen Hoffnungen ein Ende. Schon 1850 starb
Ludwig Philipp, und der zwölfjährige Graf von Paris
wurde dadurch das Oberhaupt des Hauses Orleans und, nach
der Einbildung seiner Anhänger, auch rechtmäßiger König
von Frankreich, das aber nichts von ihm wissen wollte. So
stellte denn der Graf von Paris aus Mangel an geeigneter
Beschäftigung im amerikanischen Secessionskriege den Nord-
staaten seinen Degen zur Verfügung, und veröffentlichte später
eine Geschichte des amerikanischen Bürgerkrieges, der als Frucht
feiner erzwungenen Muße mehrere volkswirthschaftliche Werke
Das Buch für Alle.
folgten. 1864 hatte er sich mit Prinzessin Isabella von Mont-
pensier, seiner Base, vermählt. Dieser Ehe entsproßten sechs
Kinder, von denen der älteste Sohn, der jetzt fünfundzwanzig-
jährige Ludwig Philipp Robert, Herzog von Orleans, als
Nachfolger des Verstorbenen das Haupt des ehemaligen könig-
lichen Hauses geworden ist.
Schlechte Aussichten.
(Siehe das Bild auf Seite 181.)
?>ie ländliche Schöne, welche unser Bild auf S. 181 —
nach einem Gemälde von M. Schmid — darstellt, ist
zwar nicht mehr in der ersten Blüthe der Jahre, sie hat die
fünfundzwanzig überschritten, und ihr Gesicht drückt aus, daß
sie über die holden Träume der Jugend hinaus ist. Dennoch
darf sie behaupten, ein stattliches, wohlgestaltetes, immer noch
sehr hübsches Frauenzimmer zu sein, an dem mancher junge
Mann Wohlgefallen finden kann; sie hat daher die Hoffnung
durchaus nicht aufgegeben, noch eine gute Parthie zu machen
und auch einen Mann nach ihrem Herzen zu finden. Sie
war allerdings bisher sehr stolz und etwas abweisend, jetzt ist
sie milder geworden, entschieden jedoch nicht schon so weit
gekommen, eine Bewerbung annehmen zu müssen, wie diese
ihr der ältliche Uhrmacher, der mit verliebten Augen ihr nach-
späht und ihr überall zu begegnen sucht, zumnthet. Die Augen
dieses Mannes sind ihr greulich. Nase, Wangen, Mund und
Stirn desselben deuten auf die Nähe der sechziger Jahre. So
weit ist sie denn doch noch nicht, den alten Uhrmacher nehmen
zu müssen, auch wenn er sonst ein ordentlicher Mann ist, der
ein nettes Vermögen besitzt. Als daher, wie unser Bild dies
zeigt, der alte Freier ihr in aller Morgenfrühe wieder auflauert
und ihr ein bedeutungsvolles Sträußchen von rothen Nelken
und blauen Kornblumen überreichen will, sieht sie auf diese
Blumenzeichen der Liebe und Treue verächtlich herab, schlägt
die sinnige Gabe des alten Herrn aus und geht stumm und
stolz an dem bejahrten Verliebten vorüber. Jeder, welcher
diese ergötzliche Scene belauscht, merkt, daß dieser Freier hier
schlechte Aussichten hat — ob er es selbst einsieht?
Die moderne Sklaverei im olko-
manischen Reiche.
Ethnographische Schilderungen
von
A. Stelzner.
er so viel Aufsehen erregende Prozeß in Kairo
gegen die Paschas Ali Scherif und Mehemed,
sowie zahlreiche andere angesehene Leute wegen
Sklavenkauses hat deutlich genug gezeigt, wie
es in dieser Beziehung in Egypten aussieht.
In der Türkei ist es nicht viel anders.
Noch vor wenigen Jahrzehnten gab es, wie in den
meisten türkischen Städten, so auch in Konstantinopel
öffentliche Sklavenmärkte. Ihre damalige Abschaffung
sollte den Zweck haben, diesen Handel überhaupt zu be-
seitigen, hatte jedoch nur zur Folge, daß die vom Markt
vertriebenen Handelsleute die „Waare" mit sich nach
Hause nahmen, um weniger auffällig ihre Kundschaft zu
befriedigen. Auch eröffneten sie mehrere Cafos, sogenannte
„Khans", in denen Jedermann zum Einkauf Zutritt hatte.
Derartige Sklavenniederlagen befinden sich heute in
den Stadtvierteln von Skutari, Tophane und Sultan-
Mehmed und besonders in der der Suleimanije-Moschee
gegenüberliegenden Straße. Das Magazin von Tophane
besaß vor anderen den Ruf, nur die „Blüthe des Marktes",
nämlich die ihrer außerordentlichen Schönheit wegen be-
rühmten Cirkassierinnen zu führen; seit einem Jahrzehnt je-
doch ist diese Musterausstellung nach dem Mittelpunkt von
,Konstantinopel, also weit entfernt vom europäischen
Viertel, verlegt worden, weil man es doch für bedenklich
halten mochte, den Handel in unmittelbarer Nähe der
Vertreter moderner Kultur und Civilisation fortzusetzen.
Wie die offiziellen Börsen werden diese Niederlagen
zu bestimmten Stunden von den Käufern und Ver-
käufern besucht, um die menschliche Waare zu besichtigen
und den Handel abzuschließen. Man raucht dort, trinkt
seinen Kaffee und unterhandelt mit Bedacht. Ist die
Wahl getroffen, so muß bezahlt werden, und das Opfer
folgt dem neuen Herrn gehorsam nach Hause.
Neben den privilegirten Kaufleuten befassen sich
zahlreiche Privatpersonen aus zweiter Hand mit dem
Sklavenhandel, nachdem sie die in Bausch und Bogen
in den „Khans" gekaufte Waare verfeinert haben. Es
sind dies vornehmlich Damen und zwar hauptsächlich
solche aus der höheren Gesellschaft. Sie verschaffen sich
kleine Mädchen, welche ihres jugendlichen Alters wegen
billig sind, um sie später zu oft zehnfachem Preise
wieder zu verkaufen. Und wie ein gründlicher Kenner
dieser Verhältnisse, der türkische Major Asman-Bey,
dessen rücksichtslosen Klarlegungen wir hier der Haupt-
sache nach folgen, nnchweist, wird jene Art Spekulation
allgemein zugelassen. Der Gewinn ist ebenso beträcht-
lich, wie die Mühe gering. Ein Mädchen von sieben
bis acht Jahren mit hübschen Zügen und einnehmender
Gestalt kostet etwa zweitausend Mark. Nach drei bis
vier Jahren hat es aber einen Werth von zwanzig-
tausend Mark und mehr, so daß Fälle nicht selten sind,
daß die Besitzerinnen auf die zukünftige Schönheit dieser
oder jener Favorite „Hypotheken" nehmen und — er-
halten. Der Verkauf dieser Mädchen geschieht meist
durch Unterhändlerinnen, auch pflegt man sie in herr-
schaftlichen Equipagen spazieren zu fahren, um durch
solche Art Reklame Kaufliebhaber heranzuziehen. Der
höchste Kaufpreis soll die Summe von 25,000 Mark
nur ausnahmsweise überschreiten.
Der Verkauf eines menschlichen Geschöpfes wird
ohne die geringsten Gewissensbisse als ein vollkommen
gerechtfertigtes' Verfahren betrachtet. Ja, von allen
Eingeweihten wird die Sklaverei geradezu für den Eck-
stein des sozialen und politischen Lebens der Moham-
medaner angesehen, für die Institution, welche wie eine
Art Talisman das Gebäude der türkischen Herrschaft
in Europa, das einst — in der Zeit von der Eroberung
Konstantinopels im Jahre 1453 bis zur Belagerung
von Wien im Jahre 1683 — so glänzend dastand,
noch nothdürftig zusammenhält. Jedenfalls steht die
Sklavenfrage in innigstem Zusammenhänge mit der
von Mohammed geschaffenen Gesellschaftsordnung des
Islam überhaupt, gleichsam deren Schlußstein bildend.
Das Grundprinzip der muselmännischen Gesellschaft
ist die vollständige Trennung der beiden Geschlechter,
das so weit geht, daß z. B. noch heutzutage das Ver-
langen eines Moslem, seine Verlobte vor der Heirath
sehen zu wollen, sowohl für die Braut als für deren
Familie schlechthin eine Beleidigung sein würde. Aus
jenem Grundprinzip rühren alle Verordnungen und
Gebräuche der Korangläubigen her. Wie jedes Ge-
schlecht seine besonderen Räume, so hat es auch seine
besonderen Möbel, Beschäftigungen, Besuche und Ver-
gnügungen. Der Muselmann lebt nur für sich, un-
bekümmert um das öffentliche Leben und das allgemeine
Wohl. Dafür legen die öden, trostlosen mohammeda-
nischen Städte und Dörfer mit ihren weder gepflasterten
noch erleuchteten Straßen das beredteste Zeugniß ab.
Der Muselmann lebt nur für seine Familie, für seinen
Harem, worin ihm das Gesetz vier rechtmäßige Frauen
gestattet. Wie aber könnte man die Herrinnen ein-
fchließen, wenn die Dienerinnen frei wären? In der
That ist die Sklaverei der Zusatz des Harems, denn
ohne Sklaven würde die Errichtung eines Harems
materiell unmöglich sein. Wer also die Sklaverei auf-
höbe, würde auch den Harem beseitigen und mit dieser
Basis des sozialen Lebens der Muselmänner deren Ge-
sellschaftsordnung überhaupt. Diese Schlußfolgerungen
erklären zur Genüge das beharrliche Widerstreben der
Türkei allen reformatorischen Bestrebungen des übrigen
Europa gegenüber.
Es wäre ohne Sklaven in der heutigen Türkei nicht
nur unmöglich, die Frauen in einem Zustande der
vollständigen Abgeschlossenheit zu erhalten —- wie es
der Koran vorschreibt — sondern auch unmöglich,
einen Haushalt zu führen. Das Gesetz zwingt die
Frauen, einen Schleier zu tragen und ihre ganze
Figur, ausgenommen die Augen, vor den Männern zu
verbergen, eine allgemeine gebieterische Regel, welche
keinen Unterschied zwischen den Reichen und Armen
macht. Würde nun ein Muselmann nach einer freien
Dienerin gegen Lohn suchen, und er würde unter Tau-
senden eine finden, welche einwilligte, mit einem „Frem-
den" in Berührung zu kommen, so würde sich diese
Dienerin doch nur stets vom Kopfe bis zu Fuß sorg-
fältig verschleiert vor ihm zeigen, und so oft sie ihm
begegnete, ihm — wie es die Sitte streng vorschreibt —
ausweichen oder sich verbergen, indem sie ihm mindestens
respektvoll den Rücken zuwendete. Bei nur wenigen
solcher Dienerinnen aber würde sein Haushalt mit den
verschleierten Figuren und den sich flüchtenden Frauen
alsbald einem Narrenhause gleichen, ganz abgesehen
davon, daß mancherlei Dienstverrichtungen in dem feuer-
gefährlichen Schleier geradezu lebensgefährlich wären.
Um alle Begegnungen zu vermeiden, gibt es für den
Herrn des Hauses nur ein Mittel, und zwar müßte er
jedesmal sein Erscheinen ankündigen, indem er mit
lauter Stimme ruft: „Hütet euch!" Würde er diese
Vorsicht nicht anwenden, so bliebe kein freies Weib in
seinem Dienste.
Bei den Sklaven aber ist diese Vorsicht überflüssig.
Diese sind Eigenthum des Herrn, der sie sehen kann,
wie und wann es ihm gefällt, weil sie „Anders-
gläubige" sind.
Die Art der Beschaffung der Sklaven war in der
guten, alten Zeit sehr einfach: die muselmännischen
Truppen bekämpften die Landstriche von Georgien und
Ungarn, verheerten die slavischen und österreichischen
Provinzen und bemächtigten sich aller jungen Leute,
welche sie auf ihrem Eroberungszuge fanden. Die
Schönsten behielten die Plünderer, die Uebrigen wurden
an die „Jessirdjis" verkauft, Kaufleute, die sich zahlreich
im Gefolge der Truppen befanden und in den Haupt-
städten des Reiches Niederlagen besaßen. Ganze Sklaven-
karawanen gingen oft nach der Hauptstadt, um dort
versteigert zu werden. Und da der Sklavenhandel ge-