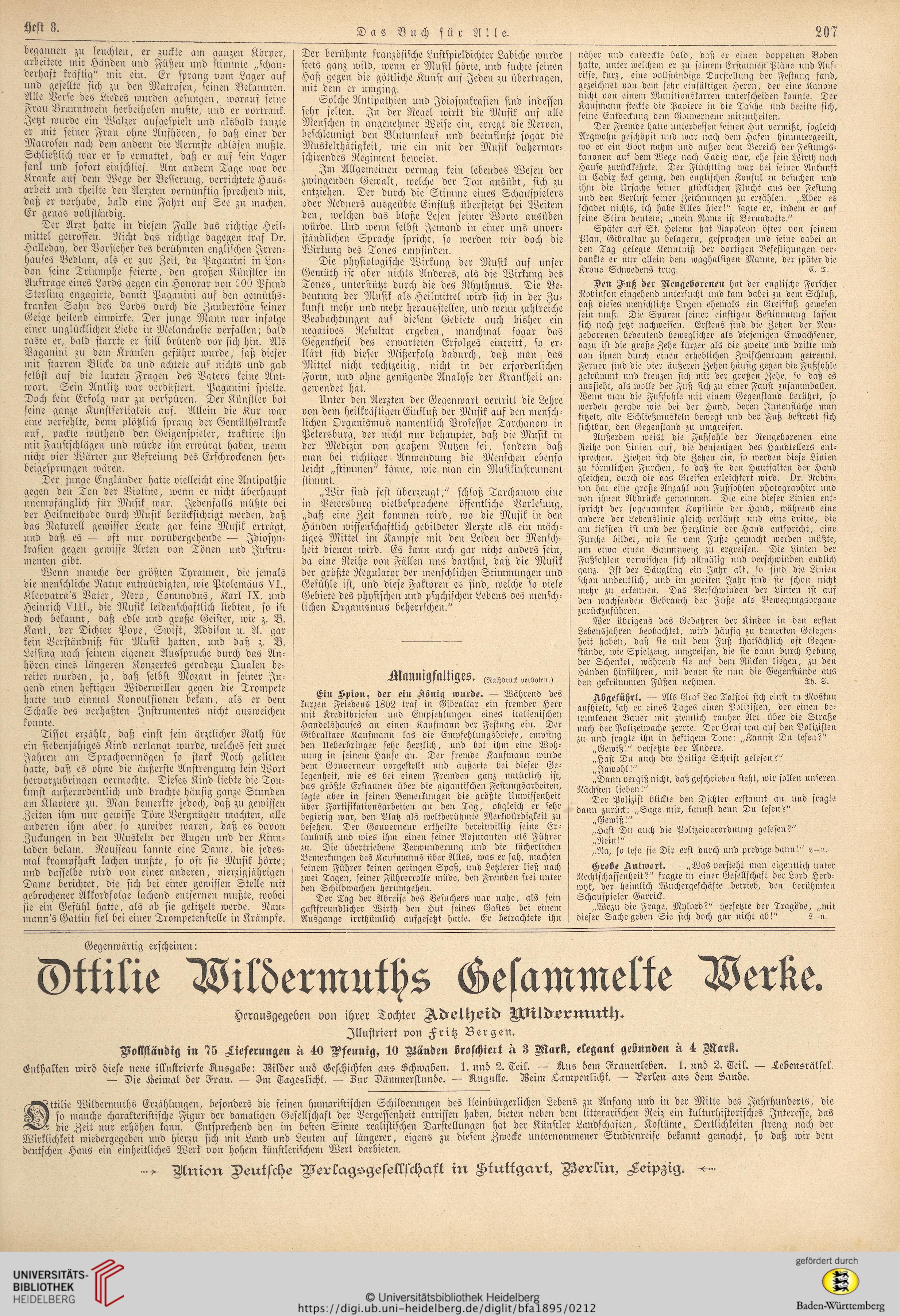Heft 8.
207
begannen zu leuchten, er znckte am ganzen Körper,
arbeitete mit Händen und Füßen und stimmte „schau-
derhaft kräftig" mit ein. Er sprang vom Lager aus
und gesellte sich zu den Matrosen, seinen Bekannten.
Alle Berse des Liedes wurden gesungen, worauf seine
Frau Branntwein herbeiholen mußte, und er vortrank.
Jetzt wurde ein^ Walzer aufgespielt und alsbald tanzte
er mit seiner Frau ohne Äufhören, so daß einer der
Matrosen nach dem andern die Aermste ablösen mußte.
Schließlich war er so ermattet, daß er auf sein Lager
sank und sofort einfchtief. Am andern Tage war der
Kranke auf dem Wege der Besserung, verrichtete Haus-
arbeit und theilte den Aerzten vernünftig sprechend nut,
daß er vorhabe, bald eine Fahrt auf See zu machen.
Er genas vollständig.
Der Arzft hatte in diesem Falle das richtige Heil-
mittel getroffen. Nicht das richtige dagegen traf vr.
Halleday, der Vorsteher des berühmten englischen Irren-
hauses Bedlam, als er zur Zeit, da Paganini in Lon-
don feine Triumphe feierte, den großen Künstler im
Auftrage eines Lords gegen ein Honorar von LOO Pfund
Sterling engagirte, damit Paganini auf den gemüths-
kranken Sohn des Lords durch die Zaubertöne seiner
Geige heilend einwirke. Der junge Mann war infolge
einer unglücklichen Liebe in Melancholie verfallen; bald
raste er, bald starrte er still brütend vor sich hin. Als
Paganini zu dem Kranken geführt wnrde, saß dieser
mit starrem Blicke da und achtete auf nichts und gab
selbst auf die lauten Fragen des Vaters keine Ant-
wort. Sein Antlitz war verdüstert. Paganini spielte.
Doch kein Erfolg war zu verspüren. Der Künstler bot
feine ganze Kunstfertigkeit auf. Allein die Kur war
eine verfehlte, denn plötzlich sprang der Gemüthskranke
auf, packte wüthend den Geigenspieler, traktirte ihn
mit Faustschlägen und würde ihn erwürgt haben, wenn
nicht vier Wärter znr Befreiung des Erschrockenen her-
beigesprungen untren.
Der junge Engländer hatte vielleicht eine Antipathie
gegen den Ton der Violine, wenn er nicht überhaupt
unempfänglich für Musik war. Jedenfalls müßte bei
der Heilmethode durch Musik berücksichtigt werden, daß
das Naturell gewisser Leute gar keine Musik erträgt,
und daß es — oft nur vorübergehende — Idiosyn-
krasien gegen gewisse Arten von Tönen und Instru-
menten gibt.
Wenn manche der größten Tyrannen, die jemals
die menschliche Natur entwürdigten, wie Ptolemäus VI.,
Kleopatra's Vater, Nero, Commodus, Karl IX. und
Heinrich VIII., die Musik leidenschaftlich liebten, so ist
doch bekannt, daß edle und große Geister, wie z. B.
Kant, der Dichter Pope, Swift, Addison u. A. gar
kein Verständniß für Musik hatten, und daß z. B.
Lessing nach seinem eigenen Ausspruche durch das An-
hören eines längeren Konzertes geradezu Qualen be-
reitet wurden, ja, daß selbst Mozart in seiner Ju-
gend einen heftigen Widerwillen gegen die Trompete
hatte und einmal Konvulsionen bekam, als er dem
Schalle des verhaßten Instrumentes nicht ausweichen
konnte.
Tissot erzählt, daß einst fein ärztlicher Rath für
ein siebenjähiges Kind verlangt wurde, welches feit zwei
Jahren am Sprachvermögen so stark Noth gelitten
hatte, daß es ohne die äußerste Anstrengung kein Wort
hervorzubringen vermochte. Dieses Kind liebte die Ton-
kunst außerordentlich und brachte häufig ganze Stunden
am Klaviere zu. Man bemerkte jedoch, daß zu gewissen
Zeiten ihm nur gewisse Töne Vergnügen machten, alle
anderen ihm aber so zuwider waren, daß es davon
Zuckungen in den Muskeln der Augen und der Kinn-
laden bekam. Rousseau kannte eine Dame, die jedes-
mal krampfhaft lachen mußte, so ost sie Musik hörte;
und dasselhe wird von einer anderen, vierzigjährigen
Dame berichtet, die sich bei einer gewissen Stelle mit
gebrochener Akkordfolge lachend entfernen mußte, wobei
sie ein Gefühl hatte, als ob sie gekitzelt werde. Nau-
mann's Gattin fiel bei einer Trompetenstelle in Krämpfe.
Das B u ch f n r A l l e.
Der berühmte französische Luftspieldichter Labiche wurde
stets ganz wild, wenn er Musik hörte, und suchte seinen
Haß gegen die göttliche Kunst aus Jeden zu übertragen,
mit dem er umging.
Solche Antipathien und Idiosynkrasien sind indessen
sehr selten. In der Regel wirkt die Musik aus alle
Menschen in angenehmer Weise ein, erregt die Nerven,
beschleunigt den Blutumlauf und beeinflußt sogar die
Muskelthätigkeit, wie ein mit der Musik dahermar-
schirendes Regiment beweist.
Im Allgemeinen vermag kein lebendes Wesen der
zwingenden Gewalt, welche der Ton ausübt, sich zu
entziehen. Der durch die Stimme eines Schauspielers
oder Redners ausgeübte Einfluß übersteigt bei Weitem
den, welchen das bloße Lesen seiner Worte ausüben
würde. Und wenn selbst Jemand in einer uns unver-
ständlichen Sprache spricht, so werden nur doch die
Wirkung des Tones empfinden.
Die physiologische Wirkung der Musik auf unser
Gemüth ist aber nichts Anderes, als die Wirkung des
Tones, unterstützt durch die des Rhythmus. Die Be-
deutung der Musik als Heilmittel wird sich in der Zu-
kunft mehr und mehr Herausstellen, und wenn zahlreiche
Beobachtungen auf diesem Gebiete auch bisher ein
negatives Resultat ergeben, manchmal sogar das
Gegentheil des erwarteten Erfolges eintritt, so er-
klärt sich dieser Mißerfolg dadurch, daß man das
Mittel nicht rechtzeitig, nicht in der erforderlichen
Form, und ohne genügende Analyse der Krankheit an-
gewendet hat.
Unter den Aerzten der Gegenwart vertritt die Lehre
von dem heilkräftigen Einfluß der Musik auf den mensch-
lichen Organismus namentlich Professor Tarchanow in
Petersburg, der nicht nur behauptet, daß die Musik in
der Medizin von großem Nutzen sei, sondern daß
man bei richtiger Anwendung die Menschen ebenso
leicht „stimmen" könne, wie man ein Musikinstrument
stimmt.
„Wir find fest überzeugt," schloß Tarchanow eine
in Petershurg vielbesprochene öffentliche Vorlesung,
„daß eine Zeit kommen wird, wo die Musik in den
Händen wissenschaftlich gebildeter Aerzte als ein mäch-
tiges Mittel im Kampfe mit den Leiden der Mensch-
heit dienen wird. Es kann auch gar nicht anders sein,
da eine Reihe von Fällen uns darthut, daß die Musik
der größte Regulator der menschlichen Stimmungen und
Gefühle ist, und diese Faktoren es sind, welche so viele
Gebiete des physischen und psychischen Lehens des mensch-
lichen Organismus beherrschen."
(Nachdruck verboten.)
Hin Spion, der ein König wurde. — Während des
kurzen Friedens 1802 traf in Gibraltar ein fremder Herr
mit Kreditbriefen und Empfehlungen eines italienischen
Handelshauses an einen Kaufmann der Festung ein. Der
Gibraltaer Kaufmann las die Empfehlungsbriefe, empfing
den Ueberbringer sehr herzlich, und bot ihm eine Woh-
nung in seinem Hause an. Der fremde Kaufmann wurde
dem Gouverneur vorgestellt und äußerte bei dieser Ge-
legenheit, wie es bei einem Fremden ganz natürlich ist,
das größte Erstaunen über dis gigantischen Festungsarbeiten,
legte aber in seinen Bemerkungen die größte Unwissenheit
über Fortifikationsarbeiten an den Tag, obgleich er sehr
begierig war, den Platz als weltberühmte Merkwürdigkeit zu
besehen. Der Gouverneur ertheilte bereitwillig seine Er-
laubniß und wies ihm einen seiner Adjutanten als Führer
zu. Die übertriebene Verwunderung und die lächerlichen
Bemerkungen des Kaufmanns über Alles, was er sah, machten
seinem Führer keinen geringen Spaß, und Letzterer ließ nach
zwei Tagen, feiner Führerrolls müde, den Fremden frei unter
den Schildwachen herumgehen.
Der Tag der Abreise des Besuchers war nahe, als sein
gastfreundlicher Wirth den Hut feines Gastes bei einem
Ausgange irrthümlich aufgesetzt hatte. Er betrachtete ihn
näher und entdeckte bald, daß er einen doppelten Boden
hatte, unter welchem er zu seinem Erstaunen Pläne und Auf-
risse, kurz, eine vollständige Darstellung der Festung fand,
gezeichnet von dem sehr einfältigen Herrn, der eine Kanone
nicht von einem Munitionskarren unterscheiden konnte. Der
Kaufmann steckte die Papiere in die Tasche und beeilte sich,
seine Entdeckung dem Gouverneur mitzutheilen.
Der Fremde hatte unterdessen seinen Hut vermißt, sogleich
Argwohn geschöpft und war nach dem Hafen hinuntergeeilt,
wo er ein Boot nahm und außer dem Bereich der Festungs-
kanonen auf dem Wegs nach Cadix war, ehe sein Wirth nach
Hause zurückkehrte. Der Flüchtling war bei seiner Ankunft
in Cadix keck genug, den englischen Konsul zu besuchen und
ihm die Ursache seiner glücklichen Flucht aus der Festung
und den Verlust seiner Zeichnungen zu erzählen. „Aber es
schadet nichts, ich habe Alles hier!" sagte er, indem er auf
seine Stirn deutete; „mein Name ist Bernadotte."
Später aus St. Helena hat Napoleon öfter von seinem
Plan, Gibraltar zu belagern, gesprochen und seine dabei an
den Tag gelegte Kenntnis; der dortigen Befestigungen ver-
dankte er nur allein dem waghalsigen Manne, der später die
Krone Schwedens trug. C. T.
Den Kuß der Neugeborenen hat der englische Forscher
Robinson eingehend untersucht und kam dabei zu dem Schluß,
daß dieses menschliche Organ ehemals ein Greiffuß gewesen
sein muß. Die Spuren seiner einstigen Bestimmung lassen
sich noch jetzt nachweisen. Erstens sind die Zehen der Neu-
geborenen bedeutend beweglicher als diejenigen Erwachsener,
dazu ist die große Zehe kürzer als die zweite und dritte und
von ihnen durch einen erheblichen Zwischenraum getrennt.
Ferner sind die vier äußeren Zehen häufig gegen die Fußsohle
gekrümmt und kreuzen sich mit der großen Zehe, so daß es
aussieht, als wolle der Fuß sich zu einer Faust zusammballen.
Wenn man die Fußsohle mit einem Gegenstand berührt, so
werden gerade wie bei der Hand, deren Innenfläche man
kitzelt, alle Schließmuskeln bewegt und der Fuß bestrebt sich
sichtbar, den Gegenstand zu umgreifen.
Außerdem weist die Fußsohle der Neugeborenen eine
Reihe von Linien auf, die denjenigen des Handtellers ent-
sprechen. Ziehen sich die Zehen ein, so werden diese Linien
zu förmlichen Furchen, so daß sie den Hautfalten der Hand
gleichen, durch die das Greifen erleichtert wird. Dr. Robin-
son hat eine große Anzahl von Fußsohlen photographirt und
von ihnen Abdrücke genommen. Die eine dieser Linien ent-
spricht der sogenannten Kopflinie der Hand, während eine
andere der Lebenslinie gleich verläuft und eine dritte, die
am tiefsten ist und der Herzlinie der Hand entspricht, eine
Furche bildet, wie sie vom Fuße gemacht werden müßte,
um etwa einen Baumzweig zu ergreifen. Die Linien der
Fußsohlen verwischen sich allmälig und verschwinden endlich
ganz. Ist der Säugling ein Jahr alt, so sind die Linien
schon undeutlich, und im zweiten Jahr sind sie schon nicht
mehr zu erkennen. Das Verschwinden der Linien ist auf
den wachsenden Gebrauch der Füße als Bewegungsorgane
zurückzuführen.
Wer übrigens das Gebahren der Kinder in den ersten
Lebensjahren beobachtet, wird häufig zu bemerken Gelegen-
heit haben, daß sie mit dein Fuß thatsächlich oft Gegen-
stände, wie Spielzeug, umgreifen, die sie dann durch Hebung
der Schenkel, während sie auf den: Rücken liegen, zu den
Händen hinführen, mit denen sie nun die Gegenstände aus
den gekrümmten Füßen nehmen. Th. S.
Angeführt. — Als Graf Leo Tolstoi sich einst in Moskau
aufhielt, sah er eines Tages einen Polizisten, der einen be-
trunkenen Bauer mit ziemlich rauher Art über die Straße
nach der Polizeiwache zerrte. Der Gras trat auf den Polizisten
zu und fragte ihn in heftigem Tone: „Kannst Du lesen?"
„Gewiß!" versetzte der Andere.
„Hast Du auch die Heilige Schrift gelesen?"
„Jawohl!"
„Dann vergiß nicht, daß geschrieben steht, wir sollen unseren
Nächsten lieben!"
Der Polizist blickte den Dichter erstaunt an und fragte
dann zurück: „Sage mir, kannst denn Du lesen?"
„Gewiß!"
„Hast Du auch die Polizeiverordnung gelesen?"
„Nein!"
„Na, so lese sie Dir erst durch und predige dann!" L-n.
Grobe Antwort. — „Was versteht man eigentlich unter
Rechtschaffenheit?" fragte in einer Gesellschaft der Lord Herd-
wyk, der heimlich Wuchergeschäfte betrieb, den berühmten
Schauspieler Garrick.
„Wozu die Frage, Mylord?" versetzte der Tragöde, „mit
dieser Sache geben Sie sich doch gar nicht ab!" L-n.
Gegenwärtig erscheinen:
Zilöernruths Gesammelte '
Herausgegeben von ihrer Tochter Adelheid
Illustriert von Fritz Bergen.
Vollständig in 75 Lieferungen A 40 Pfennig, 10 Wänden broschiert a 3 Mark, elegant gebunden a 4 Mark.
Enthalten wird diese neue illustrierte Ausgabe: Vilöer und Geschichten aus Schwaben. I. und 2. Teil. — Aus dem Arauenteben. I. und 2. Teil. — Lebensrätsel.
— Die Heimat der Nrau. — Dm Tageslicht. — Zur Dämmerstunde. — Auguste. iKeim Lampenlicht. — Derlen aus dem L»ande.
/^Ettilie Wildermuths Erzählungen, besonders die feinen humoristischen Schilderungen des kleinbürgerlichen Lebens zu Anfang und in der Mitte des Jahrhunderts, die
KN so manche charakteristische Figur der damaligen Gesellschaft der Vergessenheit entrissen haben, bieten neben dem litterarischen Reiz ein kulturhistorisches Interesse, das
die Zeit nur erhöhen kann. Entsprechend den im besten Sinne realistischen Darstellungen hat der Künstler Landschaften, Kostüme, Oertüchketten streng nach der
Wirklichkeit wiedergegeben und hierzu sich mit Land und Leuten auf längerer, eigens zu diesem Zwecke unternommener Studienreise bekannt gemacht, so daß wir dem
deutschen Haus ein einheitliches Werk von hohem künstlerischem Wert darbieten.
Union Deutsche Uertagsgesettschaft in Stuttgart, Wertin, Leipzig.
207
begannen zu leuchten, er znckte am ganzen Körper,
arbeitete mit Händen und Füßen und stimmte „schau-
derhaft kräftig" mit ein. Er sprang vom Lager aus
und gesellte sich zu den Matrosen, seinen Bekannten.
Alle Berse des Liedes wurden gesungen, worauf seine
Frau Branntwein herbeiholen mußte, und er vortrank.
Jetzt wurde ein^ Walzer aufgespielt und alsbald tanzte
er mit seiner Frau ohne Äufhören, so daß einer der
Matrosen nach dem andern die Aermste ablösen mußte.
Schließlich war er so ermattet, daß er auf sein Lager
sank und sofort einfchtief. Am andern Tage war der
Kranke auf dem Wege der Besserung, verrichtete Haus-
arbeit und theilte den Aerzten vernünftig sprechend nut,
daß er vorhabe, bald eine Fahrt auf See zu machen.
Er genas vollständig.
Der Arzft hatte in diesem Falle das richtige Heil-
mittel getroffen. Nicht das richtige dagegen traf vr.
Halleday, der Vorsteher des berühmten englischen Irren-
hauses Bedlam, als er zur Zeit, da Paganini in Lon-
don feine Triumphe feierte, den großen Künstler im
Auftrage eines Lords gegen ein Honorar von LOO Pfund
Sterling engagirte, damit Paganini auf den gemüths-
kranken Sohn des Lords durch die Zaubertöne seiner
Geige heilend einwirke. Der junge Mann war infolge
einer unglücklichen Liebe in Melancholie verfallen; bald
raste er, bald starrte er still brütend vor sich hin. Als
Paganini zu dem Kranken geführt wnrde, saß dieser
mit starrem Blicke da und achtete auf nichts und gab
selbst auf die lauten Fragen des Vaters keine Ant-
wort. Sein Antlitz war verdüstert. Paganini spielte.
Doch kein Erfolg war zu verspüren. Der Künstler bot
feine ganze Kunstfertigkeit auf. Allein die Kur war
eine verfehlte, denn plötzlich sprang der Gemüthskranke
auf, packte wüthend den Geigenspieler, traktirte ihn
mit Faustschlägen und würde ihn erwürgt haben, wenn
nicht vier Wärter znr Befreiung des Erschrockenen her-
beigesprungen untren.
Der junge Engländer hatte vielleicht eine Antipathie
gegen den Ton der Violine, wenn er nicht überhaupt
unempfänglich für Musik war. Jedenfalls müßte bei
der Heilmethode durch Musik berücksichtigt werden, daß
das Naturell gewisser Leute gar keine Musik erträgt,
und daß es — oft nur vorübergehende — Idiosyn-
krasien gegen gewisse Arten von Tönen und Instru-
menten gibt.
Wenn manche der größten Tyrannen, die jemals
die menschliche Natur entwürdigten, wie Ptolemäus VI.,
Kleopatra's Vater, Nero, Commodus, Karl IX. und
Heinrich VIII., die Musik leidenschaftlich liebten, so ist
doch bekannt, daß edle und große Geister, wie z. B.
Kant, der Dichter Pope, Swift, Addison u. A. gar
kein Verständniß für Musik hatten, und daß z. B.
Lessing nach seinem eigenen Ausspruche durch das An-
hören eines längeren Konzertes geradezu Qualen be-
reitet wurden, ja, daß selbst Mozart in seiner Ju-
gend einen heftigen Widerwillen gegen die Trompete
hatte und einmal Konvulsionen bekam, als er dem
Schalle des verhaßten Instrumentes nicht ausweichen
konnte.
Tissot erzählt, daß einst fein ärztlicher Rath für
ein siebenjähiges Kind verlangt wurde, welches feit zwei
Jahren am Sprachvermögen so stark Noth gelitten
hatte, daß es ohne die äußerste Anstrengung kein Wort
hervorzubringen vermochte. Dieses Kind liebte die Ton-
kunst außerordentlich und brachte häufig ganze Stunden
am Klaviere zu. Man bemerkte jedoch, daß zu gewissen
Zeiten ihm nur gewisse Töne Vergnügen machten, alle
anderen ihm aber so zuwider waren, daß es davon
Zuckungen in den Muskeln der Augen und der Kinn-
laden bekam. Rousseau kannte eine Dame, die jedes-
mal krampfhaft lachen mußte, so ost sie Musik hörte;
und dasselhe wird von einer anderen, vierzigjährigen
Dame berichtet, die sich bei einer gewissen Stelle mit
gebrochener Akkordfolge lachend entfernen mußte, wobei
sie ein Gefühl hatte, als ob sie gekitzelt werde. Nau-
mann's Gattin fiel bei einer Trompetenstelle in Krämpfe.
Das B u ch f n r A l l e.
Der berühmte französische Luftspieldichter Labiche wurde
stets ganz wild, wenn er Musik hörte, und suchte seinen
Haß gegen die göttliche Kunst aus Jeden zu übertragen,
mit dem er umging.
Solche Antipathien und Idiosynkrasien sind indessen
sehr selten. In der Regel wirkt die Musik aus alle
Menschen in angenehmer Weise ein, erregt die Nerven,
beschleunigt den Blutumlauf und beeinflußt sogar die
Muskelthätigkeit, wie ein mit der Musik dahermar-
schirendes Regiment beweist.
Im Allgemeinen vermag kein lebendes Wesen der
zwingenden Gewalt, welche der Ton ausübt, sich zu
entziehen. Der durch die Stimme eines Schauspielers
oder Redners ausgeübte Einfluß übersteigt bei Weitem
den, welchen das bloße Lesen seiner Worte ausüben
würde. Und wenn selbst Jemand in einer uns unver-
ständlichen Sprache spricht, so werden nur doch die
Wirkung des Tones empfinden.
Die physiologische Wirkung der Musik auf unser
Gemüth ist aber nichts Anderes, als die Wirkung des
Tones, unterstützt durch die des Rhythmus. Die Be-
deutung der Musik als Heilmittel wird sich in der Zu-
kunft mehr und mehr Herausstellen, und wenn zahlreiche
Beobachtungen auf diesem Gebiete auch bisher ein
negatives Resultat ergeben, manchmal sogar das
Gegentheil des erwarteten Erfolges eintritt, so er-
klärt sich dieser Mißerfolg dadurch, daß man das
Mittel nicht rechtzeitig, nicht in der erforderlichen
Form, und ohne genügende Analyse der Krankheit an-
gewendet hat.
Unter den Aerzten der Gegenwart vertritt die Lehre
von dem heilkräftigen Einfluß der Musik auf den mensch-
lichen Organismus namentlich Professor Tarchanow in
Petersburg, der nicht nur behauptet, daß die Musik in
der Medizin von großem Nutzen sei, sondern daß
man bei richtiger Anwendung die Menschen ebenso
leicht „stimmen" könne, wie man ein Musikinstrument
stimmt.
„Wir find fest überzeugt," schloß Tarchanow eine
in Petershurg vielbesprochene öffentliche Vorlesung,
„daß eine Zeit kommen wird, wo die Musik in den
Händen wissenschaftlich gebildeter Aerzte als ein mäch-
tiges Mittel im Kampfe mit den Leiden der Mensch-
heit dienen wird. Es kann auch gar nicht anders sein,
da eine Reihe von Fällen uns darthut, daß die Musik
der größte Regulator der menschlichen Stimmungen und
Gefühle ist, und diese Faktoren es sind, welche so viele
Gebiete des physischen und psychischen Lehens des mensch-
lichen Organismus beherrschen."
(Nachdruck verboten.)
Hin Spion, der ein König wurde. — Während des
kurzen Friedens 1802 traf in Gibraltar ein fremder Herr
mit Kreditbriefen und Empfehlungen eines italienischen
Handelshauses an einen Kaufmann der Festung ein. Der
Gibraltaer Kaufmann las die Empfehlungsbriefe, empfing
den Ueberbringer sehr herzlich, und bot ihm eine Woh-
nung in seinem Hause an. Der fremde Kaufmann wurde
dem Gouverneur vorgestellt und äußerte bei dieser Ge-
legenheit, wie es bei einem Fremden ganz natürlich ist,
das größte Erstaunen über dis gigantischen Festungsarbeiten,
legte aber in seinen Bemerkungen die größte Unwissenheit
über Fortifikationsarbeiten an den Tag, obgleich er sehr
begierig war, den Platz als weltberühmte Merkwürdigkeit zu
besehen. Der Gouverneur ertheilte bereitwillig seine Er-
laubniß und wies ihm einen seiner Adjutanten als Führer
zu. Die übertriebene Verwunderung und die lächerlichen
Bemerkungen des Kaufmanns über Alles, was er sah, machten
seinem Führer keinen geringen Spaß, und Letzterer ließ nach
zwei Tagen, feiner Führerrolls müde, den Fremden frei unter
den Schildwachen herumgehen.
Der Tag der Abreise des Besuchers war nahe, als sein
gastfreundlicher Wirth den Hut feines Gastes bei einem
Ausgange irrthümlich aufgesetzt hatte. Er betrachtete ihn
näher und entdeckte bald, daß er einen doppelten Boden
hatte, unter welchem er zu seinem Erstaunen Pläne und Auf-
risse, kurz, eine vollständige Darstellung der Festung fand,
gezeichnet von dem sehr einfältigen Herrn, der eine Kanone
nicht von einem Munitionskarren unterscheiden konnte. Der
Kaufmann steckte die Papiere in die Tasche und beeilte sich,
seine Entdeckung dem Gouverneur mitzutheilen.
Der Fremde hatte unterdessen seinen Hut vermißt, sogleich
Argwohn geschöpft und war nach dem Hafen hinuntergeeilt,
wo er ein Boot nahm und außer dem Bereich der Festungs-
kanonen auf dem Wegs nach Cadix war, ehe sein Wirth nach
Hause zurückkehrte. Der Flüchtling war bei seiner Ankunft
in Cadix keck genug, den englischen Konsul zu besuchen und
ihm die Ursache seiner glücklichen Flucht aus der Festung
und den Verlust seiner Zeichnungen zu erzählen. „Aber es
schadet nichts, ich habe Alles hier!" sagte er, indem er auf
seine Stirn deutete; „mein Name ist Bernadotte."
Später aus St. Helena hat Napoleon öfter von seinem
Plan, Gibraltar zu belagern, gesprochen und seine dabei an
den Tag gelegte Kenntnis; der dortigen Befestigungen ver-
dankte er nur allein dem waghalsigen Manne, der später die
Krone Schwedens trug. C. T.
Den Kuß der Neugeborenen hat der englische Forscher
Robinson eingehend untersucht und kam dabei zu dem Schluß,
daß dieses menschliche Organ ehemals ein Greiffuß gewesen
sein muß. Die Spuren seiner einstigen Bestimmung lassen
sich noch jetzt nachweisen. Erstens sind die Zehen der Neu-
geborenen bedeutend beweglicher als diejenigen Erwachsener,
dazu ist die große Zehe kürzer als die zweite und dritte und
von ihnen durch einen erheblichen Zwischenraum getrennt.
Ferner sind die vier äußeren Zehen häufig gegen die Fußsohle
gekrümmt und kreuzen sich mit der großen Zehe, so daß es
aussieht, als wolle der Fuß sich zu einer Faust zusammballen.
Wenn man die Fußsohle mit einem Gegenstand berührt, so
werden gerade wie bei der Hand, deren Innenfläche man
kitzelt, alle Schließmuskeln bewegt und der Fuß bestrebt sich
sichtbar, den Gegenstand zu umgreifen.
Außerdem weist die Fußsohle der Neugeborenen eine
Reihe von Linien auf, die denjenigen des Handtellers ent-
sprechen. Ziehen sich die Zehen ein, so werden diese Linien
zu förmlichen Furchen, so daß sie den Hautfalten der Hand
gleichen, durch die das Greifen erleichtert wird. Dr. Robin-
son hat eine große Anzahl von Fußsohlen photographirt und
von ihnen Abdrücke genommen. Die eine dieser Linien ent-
spricht der sogenannten Kopflinie der Hand, während eine
andere der Lebenslinie gleich verläuft und eine dritte, die
am tiefsten ist und der Herzlinie der Hand entspricht, eine
Furche bildet, wie sie vom Fuße gemacht werden müßte,
um etwa einen Baumzweig zu ergreifen. Die Linien der
Fußsohlen verwischen sich allmälig und verschwinden endlich
ganz. Ist der Säugling ein Jahr alt, so sind die Linien
schon undeutlich, und im zweiten Jahr sind sie schon nicht
mehr zu erkennen. Das Verschwinden der Linien ist auf
den wachsenden Gebrauch der Füße als Bewegungsorgane
zurückzuführen.
Wer übrigens das Gebahren der Kinder in den ersten
Lebensjahren beobachtet, wird häufig zu bemerken Gelegen-
heit haben, daß sie mit dein Fuß thatsächlich oft Gegen-
stände, wie Spielzeug, umgreifen, die sie dann durch Hebung
der Schenkel, während sie auf den: Rücken liegen, zu den
Händen hinführen, mit denen sie nun die Gegenstände aus
den gekrümmten Füßen nehmen. Th. S.
Angeführt. — Als Graf Leo Tolstoi sich einst in Moskau
aufhielt, sah er eines Tages einen Polizisten, der einen be-
trunkenen Bauer mit ziemlich rauher Art über die Straße
nach der Polizeiwache zerrte. Der Gras trat auf den Polizisten
zu und fragte ihn in heftigem Tone: „Kannst Du lesen?"
„Gewiß!" versetzte der Andere.
„Hast Du auch die Heilige Schrift gelesen?"
„Jawohl!"
„Dann vergiß nicht, daß geschrieben steht, wir sollen unseren
Nächsten lieben!"
Der Polizist blickte den Dichter erstaunt an und fragte
dann zurück: „Sage mir, kannst denn Du lesen?"
„Gewiß!"
„Hast Du auch die Polizeiverordnung gelesen?"
„Nein!"
„Na, so lese sie Dir erst durch und predige dann!" L-n.
Grobe Antwort. — „Was versteht man eigentlich unter
Rechtschaffenheit?" fragte in einer Gesellschaft der Lord Herd-
wyk, der heimlich Wuchergeschäfte betrieb, den berühmten
Schauspieler Garrick.
„Wozu die Frage, Mylord?" versetzte der Tragöde, „mit
dieser Sache geben Sie sich doch gar nicht ab!" L-n.
Gegenwärtig erscheinen:
Zilöernruths Gesammelte '
Herausgegeben von ihrer Tochter Adelheid
Illustriert von Fritz Bergen.
Vollständig in 75 Lieferungen A 40 Pfennig, 10 Wänden broschiert a 3 Mark, elegant gebunden a 4 Mark.
Enthalten wird diese neue illustrierte Ausgabe: Vilöer und Geschichten aus Schwaben. I. und 2. Teil. — Aus dem Arauenteben. I. und 2. Teil. — Lebensrätsel.
— Die Heimat der Nrau. — Dm Tageslicht. — Zur Dämmerstunde. — Auguste. iKeim Lampenlicht. — Derlen aus dem L»ande.
/^Ettilie Wildermuths Erzählungen, besonders die feinen humoristischen Schilderungen des kleinbürgerlichen Lebens zu Anfang und in der Mitte des Jahrhunderts, die
KN so manche charakteristische Figur der damaligen Gesellschaft der Vergessenheit entrissen haben, bieten neben dem litterarischen Reiz ein kulturhistorisches Interesse, das
die Zeit nur erhöhen kann. Entsprechend den im besten Sinne realistischen Darstellungen hat der Künstler Landschaften, Kostüme, Oertüchketten streng nach der
Wirklichkeit wiedergegeben und hierzu sich mit Land und Leuten auf längerer, eigens zu diesem Zwecke unternommener Studienreise bekannt gemacht, so daß wir dem
deutschen Haus ein einheitliches Werk von hohem künstlerischem Wert darbieten.
Union Deutsche Uertagsgesettschaft in Stuttgart, Wertin, Leipzig.