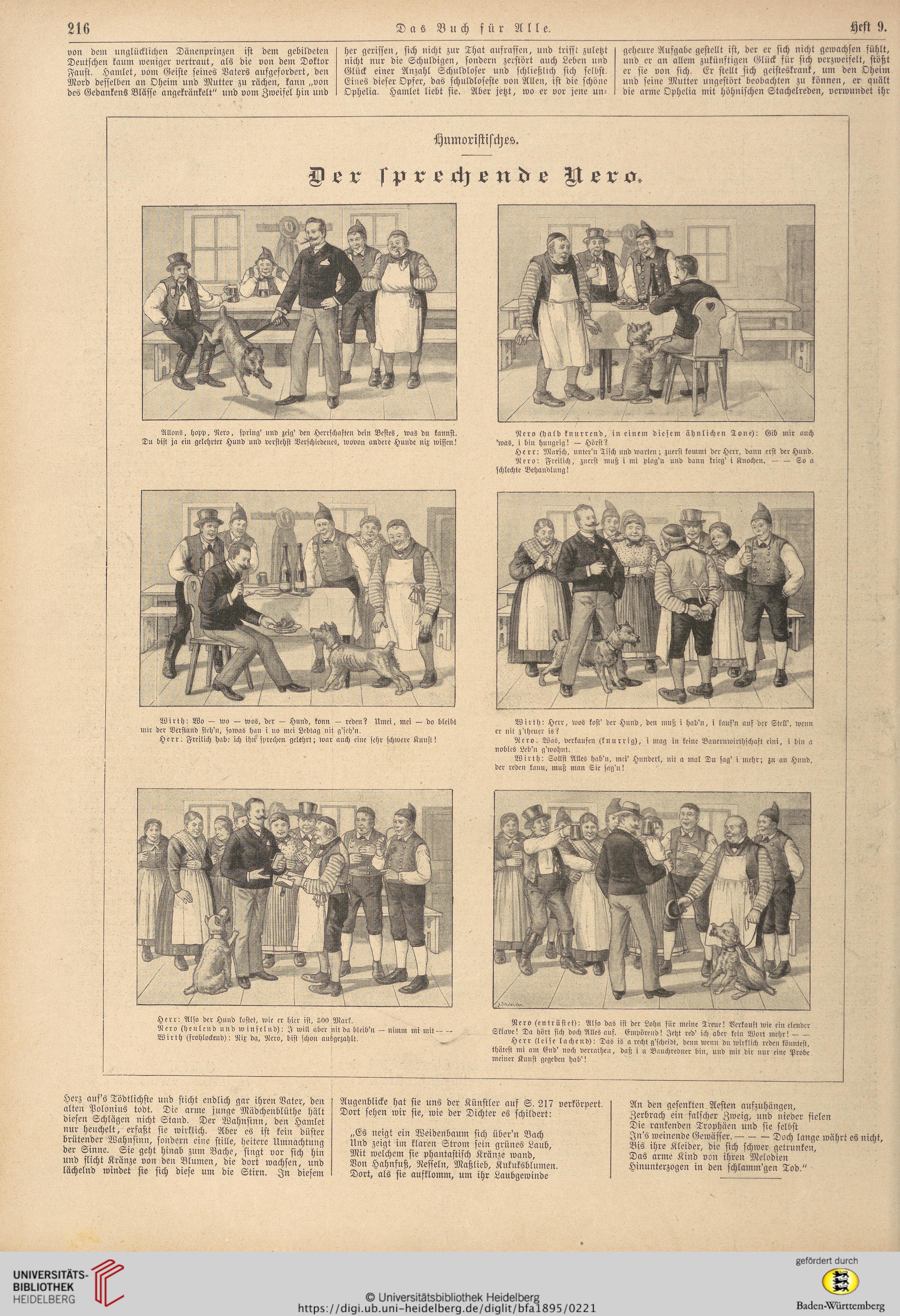216
Das Buch für Alle.
von dem unglücklichen Dänenprinzen ist dem gebildeten
Deutschen kaum weniger vertraut, als die von dem Doktor
Faust. Hamlet, vom Geiste seines Vaters aufgefordert, den
Mord desselben an Oheim und Mutter zu rächen, kann „von
des Gedankens Bläffe angekränkelt" und vom Zweifel hin und
her gerissen, sich nicht zur That aufraffen, und trifft zuletzt
nicht nur die Schuldigen, sondern zerstört auch Leben und
Glück einer Anzahl Schuldloser und schließlich sich selbst.
Eines dieser Opfer, das schuldloseste von Allen, ist die schöne
Ophelia. Hamlet liebt sie. Aber jetzt, wo er vor jene un-
Heft 9.
geheure Aufgabe gestellt ist, der er sich nicht gewachsen fühlt,
und er an allem zukünftigen Glück für sich verzweifelt, stößt
er sie von sich. Er stellt sich geisteskrank, um den Oheim
und seine Mutter ungestört beobachten zu können, er quält
die arme Ophelia mit höhnischen Stachelreden, verwundet ihr
Der sprechende Uero-
Allons, hopp, Nero, spring' nnd zeig' den Herrschaften dein Bestes, was du kannst.
Du bist ja ein gelehrter Hund und verstehst Verschiedenes, wovon andere Hunde nix wissen!
Nero (halb knurrend, in einem diesem ähnlichen Tone): Gib mir auch
'was, i bin hungrig! — Hörst?
Herr: Marsch, unter'n Tisch und warten; zuerst kommt der Herr, dann erst der Hund.
Nero: Freilich, zuerst muß i mi Plag'n und dann krieg' i Knochen. — — So a
schlechte Behandlung!
Wirth: Wo — wo — wos, der — Hund, kann — reden? Nmci, mei — do bleibt
mir der Verstand stch'n, sowas Han i no mei Lebtag nit g'sch'n.
Herr: Freilich habe ich ihn sprechen gelehrt; war auch eine sehr schwere Kunst!
Herr: Also der Hund kostet, wie er hier ist, 300 Mark.
Nero (heulend und winselnd): I will aber nit da bleib'n — nimm mi mit-
Wirth (frohlockend): Nix da, Nero, bist schon ausgczahlt.
Wirth: Herr, wos kost' der Hund, den muß i hab'n, i kauf'» auf der Stell', wenn
er nit z'thcucr is?
Nero. Was, verkaufen (knurrig), i mag in keine Baucrnwirthschaft ciui, i bin a
nobles Lcb'n g'wohnt.
Wirth: Sollst Alles hab'», mei' Hundcrl, nit a mal Du sag' i mehr; zu an Hund,
der reden kann, muß man Sie sag'»!
Nero (entrüstet): Also das ist der Lohn für meine Treue! Verkauft wie ein elender
Sklave! Da hort sich doch Alles auf. Empörend! Jetzt red' ich aber kein Wort mehr!-
Herr (leise lachend): Das is a recht g'scheidt, denn wenn du wirklich reden könntest,
thätcst mi am End' noch vcrrathen, daß i a Bauchredner bin, und mit dir nur eine Probe
meiner Kunst gegeben hab'!
Herz auf's Tödtlichste und sticht endlich gar ihren Vater, den
alten Polonius todt. Die arme junge Mädchenblüthe hält
diesen Schlägen nicht Stand. Der Wahnsinn, den Hamlet
nur heuchelt, erfaßt sie wirklich. Aber es ist kein "düster
brütender Wahnsinn, sondern eine stille, heitere Umnachtung
der Sinne. Sie geht hinab zum Bache, singt vor sich hin
und flicht Kränze von den Blumen, die dort wachsen, und
lächelnd windet sie sich diese um die Stirn. In diesem
Augenblicke hat sie uns der Künstler auf S. 217 verkörpert.
Dort sehen wir sie, wie der Dichter es fchildert:
„Es neigt ein Weidenbaum sich über'n Vach
Und zeigt im klaren Strom sein grünes Laub,
Mit welchem sie phantastisch Kränze wand.
Von Hahnfuß, Nesseln, Maßlieb, Kukuksbluinen.
Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde
An den gesenkten. Aesten aufzuhängen.
Zerbrach ein falscher Zweig, und nieder fielen
Die rankenden Trophäen und sie selbst
Jn's weinende Gewässer.-Doch lange währt es nicht,
Bis ihre Kleider, die sich schwer getrunken.
Das arme Kind von ihren Melodien
Hinunterzogen in den schlamm'gen Tod."
Das Buch für Alle.
von dem unglücklichen Dänenprinzen ist dem gebildeten
Deutschen kaum weniger vertraut, als die von dem Doktor
Faust. Hamlet, vom Geiste seines Vaters aufgefordert, den
Mord desselben an Oheim und Mutter zu rächen, kann „von
des Gedankens Bläffe angekränkelt" und vom Zweifel hin und
her gerissen, sich nicht zur That aufraffen, und trifft zuletzt
nicht nur die Schuldigen, sondern zerstört auch Leben und
Glück einer Anzahl Schuldloser und schließlich sich selbst.
Eines dieser Opfer, das schuldloseste von Allen, ist die schöne
Ophelia. Hamlet liebt sie. Aber jetzt, wo er vor jene un-
Heft 9.
geheure Aufgabe gestellt ist, der er sich nicht gewachsen fühlt,
und er an allem zukünftigen Glück für sich verzweifelt, stößt
er sie von sich. Er stellt sich geisteskrank, um den Oheim
und seine Mutter ungestört beobachten zu können, er quält
die arme Ophelia mit höhnischen Stachelreden, verwundet ihr
Der sprechende Uero-
Allons, hopp, Nero, spring' nnd zeig' den Herrschaften dein Bestes, was du kannst.
Du bist ja ein gelehrter Hund und verstehst Verschiedenes, wovon andere Hunde nix wissen!
Nero (halb knurrend, in einem diesem ähnlichen Tone): Gib mir auch
'was, i bin hungrig! — Hörst?
Herr: Marsch, unter'n Tisch und warten; zuerst kommt der Herr, dann erst der Hund.
Nero: Freilich, zuerst muß i mi Plag'n und dann krieg' i Knochen. — — So a
schlechte Behandlung!
Wirth: Wo — wo — wos, der — Hund, kann — reden? Nmci, mei — do bleibt
mir der Verstand stch'n, sowas Han i no mei Lebtag nit g'sch'n.
Herr: Freilich habe ich ihn sprechen gelehrt; war auch eine sehr schwere Kunst!
Herr: Also der Hund kostet, wie er hier ist, 300 Mark.
Nero (heulend und winselnd): I will aber nit da bleib'n — nimm mi mit-
Wirth (frohlockend): Nix da, Nero, bist schon ausgczahlt.
Wirth: Herr, wos kost' der Hund, den muß i hab'n, i kauf'» auf der Stell', wenn
er nit z'thcucr is?
Nero. Was, verkaufen (knurrig), i mag in keine Baucrnwirthschaft ciui, i bin a
nobles Lcb'n g'wohnt.
Wirth: Sollst Alles hab'», mei' Hundcrl, nit a mal Du sag' i mehr; zu an Hund,
der reden kann, muß man Sie sag'»!
Nero (entrüstet): Also das ist der Lohn für meine Treue! Verkauft wie ein elender
Sklave! Da hort sich doch Alles auf. Empörend! Jetzt red' ich aber kein Wort mehr!-
Herr (leise lachend): Das is a recht g'scheidt, denn wenn du wirklich reden könntest,
thätcst mi am End' noch vcrrathen, daß i a Bauchredner bin, und mit dir nur eine Probe
meiner Kunst gegeben hab'!
Herz auf's Tödtlichste und sticht endlich gar ihren Vater, den
alten Polonius todt. Die arme junge Mädchenblüthe hält
diesen Schlägen nicht Stand. Der Wahnsinn, den Hamlet
nur heuchelt, erfaßt sie wirklich. Aber es ist kein "düster
brütender Wahnsinn, sondern eine stille, heitere Umnachtung
der Sinne. Sie geht hinab zum Bache, singt vor sich hin
und flicht Kränze von den Blumen, die dort wachsen, und
lächelnd windet sie sich diese um die Stirn. In diesem
Augenblicke hat sie uns der Künstler auf S. 217 verkörpert.
Dort sehen wir sie, wie der Dichter es fchildert:
„Es neigt ein Weidenbaum sich über'n Vach
Und zeigt im klaren Strom sein grünes Laub,
Mit welchem sie phantastisch Kränze wand.
Von Hahnfuß, Nesseln, Maßlieb, Kukuksbluinen.
Dort, als sie aufklomm, um ihr Laubgewinde
An den gesenkten. Aesten aufzuhängen.
Zerbrach ein falscher Zweig, und nieder fielen
Die rankenden Trophäen und sie selbst
Jn's weinende Gewässer.-Doch lange währt es nicht,
Bis ihre Kleider, die sich schwer getrunken.
Das arme Kind von ihren Melodien
Hinunterzogen in den schlamm'gen Tod."