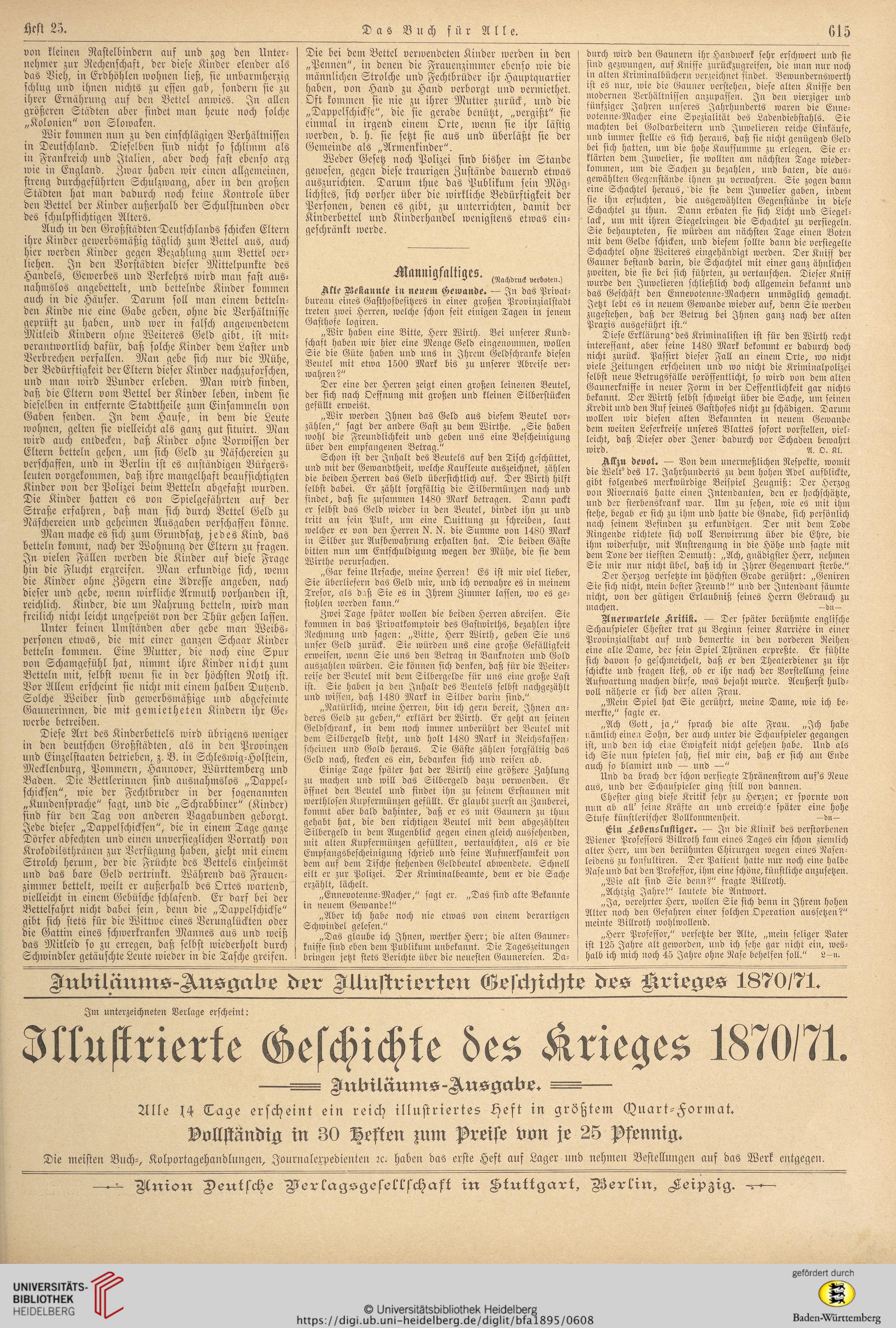Heft 25.
615
Das Buch für Alle.
von kleinen Rastelbindern auf und zog den Unter-
nehmer zur Rechenschaft, der diese Kinder elender als
das Vieh, in Erdhöhlen wohnen ließ, sie unbarmherzig
schlug und ihnen nichts zu essen gab, sondern sie zu
ihrer Ernährung auf den Bettel anwies. In allen
größeren Städten aber findet man heute noch solche
„Kolonien" von Slowaken.
Wir kommen nun zu den einschlägigen Verhältnissen
in Deutschland. Dieselben sind nicht so schlimm als
in Frankreich und Italien, aber doch fast ebenso arg
wie in England. Zwar haben wir einen allgemeinen,
streng durchgeführten Schulzwang, aber in den großen
Städten hat man dadurch noch keine Kontrole über
den Bettel der Kinder außerhalb der Schulstunden oder
des schulpflichtigen Alters.
Auch in den Großstädten Deutschlands schicken Eltern
ihre Kinder gewerbsmäßig täglich zum Bettel aus, auch
hier werden Kinder gegen Bezahlung zum Vettel ver-
liehen. In den Vorstädten dieser Mittelpunkte des
Handels, Gewerbes und Verkehrs wird man fast aus-
nahmslos nngebettelt, und bettelnde Kinder kommen
auch in die Häuser. Darum soll man einem betteln-
den Kinde nie eine Gabe geben, ohne die Verhältnisse
geprüft zu haben, und wer in falsch angewendetem
Mitleid Kindern ohne Weiteres Geld gibt, ist mit-
verantwortlich dafür, daß solche Kinder dem Laster und
Verbrechen verfallen. Alan gebe sich nur die Mühe,
der Bedürftigkeit der Eltern dieser Kinder nachzuforschen,
und mair wird Wunder erleben. Man wird finden,
daß die Eltern vom Bettel der Kinder leben, indem sie
dieselben in entfernte Stadttheile zum Einsammeln von
Gaben senden. In dem Hause, in dem die Leute
wohnen, gelten sie vielleicht als ganz gut situirt. Man
wird auch entdecken, daß Kinder ohne Vorwissen der
Eltern betteln gehen, um sich Geld zu Näschereien zu
verschaffen, und in Berlin ist es anständigen Bürgers-
leuten vorgekommen, daß ihre mangelhaft beaufsichtigten
Kinder von der Polizei beim Betteln ahgefaßt wurden.
Die Kinder hatten es von Spielgefährten auf der
Straße erfahren, daß man sich durch Bettel Geld zu
Näschereien und geheimen Ausgaben verschaffen könne.
Man mache es sich zum Grundsatz, jedes Kind, das
betteln kommt, nach der Wohnung der Eltern zu fragen.
In vielen Füllen werden die Kinder auf diese Frage
hin die Flucht ergreifen. Man erkundige sich, wenn
die Kinder ohne Zögern eine Adresse angeben, nach
dieser und gebe, wenn wirkliche Armuth vorhanden ist,
reichlich. Kinder, die um Nahrung betteln, wird man
freilich nicht leicht ungespeist von der Thür gehen lassen.
Unter keinen Umständen aber gebe man Weibs-
personen etwas, die mit einer ganzen Schaar Kinder
betteln kommen. Eine Mutter, die noch eine Spur
von Schamgefühl hat, nimmt ihre Kinder nicht zum
Betteln mit, selbst wenn sie in der höchsten Noth ist.
Vor Allem erscheint sie nicht mit einem halben Dutzend.
Solche Weiber sind gewerbsmäßige und abgefeimte
Gaunerinnen, die mit gemietheten Kindern ihr Ge-
werbe betreiben.
Diese Art des Kinderbettels wird übrigens weniger
in den deutschen Großstädten, als in den Provinzen
und Einzelstaaten betrieben, z. B. in Schleswig-Holstein,
Mecklenburg, Pommern, Hannover, Württemberg und
Baden. Die Bettlerinnen find ausnahmslos „Dappel-
fchicksen", wie der Fechtbruder in der sogenannten
„Kundensprache" sagt, und die „Schrabbiner" (Kinder)
sind für den Tag von anderen Vagabunden geborgt.
Jede dieser „Dappelschicksen", die in einem Tage ganze
Dörfer abfechten und einen unversieglichen Vorrath von
Krokodilsthrünen zur Verfügung haben, zieht mit einem
Strolch herum, der die Früchte des Bettels einheimst
und das bare Geld vertrinkt. Während das Frauen-
zimmer bettelt, weilt er außerhalb des Ortes wartend,
vielleicht in einem Gebüsche schlafend. Er darf bei der
Rettelfahrt nicht dabei sein, denn die „Dappelschickse"
gibt sich stets für die Wittwe eines Verunglückten oder
die Gattin eines fchwerkranken Mannes aus und weiß
das Mitleid so zu erregen, daß selbst wiederholt durch
Schwindler getäuschte Leute wieder in die Tasche greifen.
Die bei dein Bettel verwendeten Kinder werden in den
„Pennen", in denen die Frauenzimmer ebenso wie die
männlichen Strolche und Fechtbrüder ihr Hauptquartier
haben, von Hand zu Hand verborgt und vermiethet.
Oft kommen sie nie zu ihrer Mutter zurück, und die
„Dappelschickse", die sie gerade benützt, „vergißt" sie
einmal in irgend einem Orte, wenn sie ihr lästig
werden, d. h. sie fetzt sie aus und überläßt sie der
Gemeinde als „Armenkinder".
Weder Gesetz noch Polizei sind bisher im Stande
gewesen, gegen diese traurigen Zustände dauernd etwas
auszurichten. Darum thue das Publikum sein Mög-
lichstes, sich vorher über die wirkliche Bedürftigkeit der
Personen, denen es gibt, zu unterrichten, damit der
Kinderbettel und Kinderhandel wenigstens etwas ein-
geschränkt werde.
(Nachdruck verboten.)
Akte gekannte in neuem Kervande. — In das Privat-
bureau eines Gasthofbesitzers in einer großen Provinzialstadt
treten zwei Herren, welche schon seit einigen Tagen in jenem
Gasthofe logiren.
„Wir habesr eine Bitte, Herr Wirth. Bei unserer Kund-
schaft haben wir hier eine Menge Geld eingenommen, wollen
Sie die Güte haben und uns in Ihrem Geldschranke diesen
Betitel mit etwa 1500 Mark bis zu unserer Abreise ver-
wahret:?"
Der eine der Herren zeigt einen großen leinenen Beutel,
der sich nach Oeffnung mit großen und kleinen Silberstücken
gefüllt erweist.
„Wir werden Ihnen das Geld aus diesem Beutel vor-
zählen," sagt der andere Gast zu dem Wirthe. „Sie haben
wohl die Freundlichkeit und geben uns eine Bescheinigung
über den empfangenen Betrag."
Schon ist der Inhalt des Beutels auf den Tisch geschüttet,
und mit der Gewandtheit, welche Kaufleute auszeichnet, zählen
die beiden Herren das Geld übersichtlich aus. Der Wirth hilft
selbst dabei. Er zählt sorgfältig die Silbermünzen nach und
findet, daß sie zusammen 1480 Mark betragen. Dann packt
er selbst das Geld wieder in den Beutel, bindet ihn zu und
tritt an sein Pult, um eine Quittung zu schreiben, laut
welcher er voir den Herren 17. bt. die Summe von 1480 Mark
in Silber zur Aufbewahrung erhalten hat. Die beiden Gäste
bitten nun um Entschuldigung wegen der Mühe, die sie dem
Wirthe verursachen.
„Gar keine Ursache, meine Herren! Es ist mir viel lieber,
Sie überliefern das Geld mir, und ich verwahre es in meinem
Tresor, als doß Sie es in Ihrem Zimmer lassen, wo es ge-
stohlen werden kann."
Zwei Tage später wollen die beiden Herren abrcisen. Sie
kommen in das Privatkomptoir des Gastwirths, bezahlen ihre
Rechnung und sagen: „Bitte, Herr Wirth, geben Sie uns
unser Geld zurück. Sie würden uns eine große Gefälligkeit
erweisen, wenn Sie uns den Betrag in Bailknoten und Gold
auszahlen würden. Sie können sich denken, daß für die Weiter-
reise der Beutel mit dem Silbergelde für uns eine große Last
ist. Sie haben ja den Inhalt des Beutels selbst nachgezählt
und wissen, daß 1480 Mark in Silber darin sind."
„Natürlich, meine Herren, bin ich gern bereit. Ihnen an-
deres Geld zu geben," erklärt der Wirth. Er geht an seinen
Geldschrank, in dein noch immer unberührt der Beutel mit
dem Silbergeld steht, und holt 1480 Mark in Neichskassen-
scheinen und Gold heraus. Die Gäste zählen sorgfältig das
Geld nach, stecken es ein, bedanken sich und reisen ab.
Einige Tage später hat der Wirth eine größere Zahlung
zu machen und will das Silbergeld dazu verwenden. Er
öffnet den Beutel und findet ihn zu seinem Erstaunen mit
werthlosen Kupfermünzen gefüllt. Er glaubt zuerst an Zauberei,
kommt aber bald dahinter, daß er es mit Gaunern zu thun
gehabt hat, die den richtigen Beutel mit dem abgezählten
Silbergcld in dein Augenblick gegen einen gleich aussehenden,
mit alten Kupfermünzen gefüllteil, vertauschten, als er die
Empfangsbescheinigung schrieb und seine Aufmerksamkeit voll
dem auf dem Tische stehenden Geldbeutel abwendete. Schnell
eilt er zur Polizei. Der Kriminalbeamte, dem er die Sache
erzählt, lächelt.
„Ennevotenne-Macher," sagt er. „Das sind alte Bekannte
in neuem Gewände!"
„Aber ich habe noch nie etwas von einem derartigen
Schwindel gelesen."
„Das glaube ich Ihnen, werther Herr; die alten Gauner-
kniffe sind eben dein Publikum unbekannt. Die Tageszeitungen
bringen jetzt stets Berichte über die neuesten Gaunereien. Da-
durch wird den Gaunern ihr Handwerk sehr erschwert und sie
sind gezwungen, auf Kniffe zurückzugreifen, die man nur noch
in alten Kriminalbüchern verzeichnet findet. Bewundernswerth
ist es nur, wie die Gauner verstehen, diese alten Kniffe den
modernen Verhältnissen anzupassen. In den vierziger und
fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts waren die Enne-
votenne-Macher eine Spezialität des Ladendiebstahls. Sie
machten bei Goldarbeitern und Juwelieren reiche Einkäufe,
und immer stellte es sich heraus, daß sie nicht genügend Geld
bei sich hatten, um die hohe Kaufsumme zu erlegen. Sie er-
klärten dem Juwelier, sie wollten am nächsten Tage wieder-
kommen, um die Sachen zu bezahlen, und baten, die aus-
gewählten Gegenstände ihnen zu verwahren. Sie zogen dann
eine Schachtel heraus,'die sie dem Juwelier gaben, indem
sie ihn ersuchten, die ausgewählten Gegenstände in diese
Schachtel zu thun. Dann erbaten sie sich Licht und Siegel-
lack, um mit ihren Siegelringen die Schachtel zu versiegeln.
Sie behaupteten, sie würden am nächsten Tage einen Boten
mit dem Gelds schicken, und diesem sollte dann die versiegelte
Schachtel ohne Weiteres eingehändigt werden. Der Kniff der
Gauner bestand darin, die Schachtel mit einer ganz ähnlichen
zweiten, die sie bei sich führten, zu vertauschen. Dieser Kniff
wurde den Juwelieren schließlich doch allgemein bekannt und
das Geschäft den Ennevotenne-Machern unmöglich gemacht.
Jetzt lebt es in neuem Gewände wieder auf, denn Sie werden
zugestehen, daß der Betrug bei Ihnen ganz nach der alten
Praxis ausgeführt ist."
Diese Erklärung-des Kriminalisten ist für den Wirth recht
interessant, aber seine 1480 Mark bekommt er dadurch doch
nicht zurück. Passirt dieser Fall an einem Orte, wo nicht
viele Zeitungen erscheinen und wo nicht die Kriminalpolizei
selbst neue Betrugsfälle veröffentlicht, so wird von dem alten
Gaunerkniffe in neuer Form in der Oesfentlichkeit gar nichts
bekannt. Der Wirth selbst schweigt über die Sache, um seinen
Kredit und den Ruf seines Gasthofes nicht zu schädigen. Darum
wollen wir diesen alten Bekannten in neuem Gewände
dem weiten Leserkreise unseres Blattes sofort vorstellen, viel-
leicht, daß Dieser oder Jener dadurch vor Schaden bewahrt
wird. A. O. Kl.
Allzu devot. — Von dem unermeßlichen Respekte, womit
die Welt des 17. Jahrhunderts zu dem hohen Adel aufblickte,
gibt folgendes merkwürdige Beispiel Zeugniß: Der Herzog
von Nivernais hatte einen Intendanten, den er hochschätzte,
und der sterbenskrank war. Um zu sehen, wie es mit ihm
stehe, begab er sich zu ihm und hatte die Gnade, sich persönlich
nach seinem Befinden zu erkundigen. Der mit dem Tode
Ringende richtete sich voll Verwirrung über die Ehre, die
ihn: widerfuhr, mit Anstrengung in die Höhe und sagte mit
dem Tone der tiefsten Demutzh: „Ach, gnädigster Herr, nehmen
Sie mir nur nicht übel, daß ich in Ihrer Gegenwart sterbe."
Der Herzog versetzte im höchsten Grade gerührt: „Geniren
Sie sich nicht, mein bester Freund!" und der Intendant säumte
nicht, von der gütigen Erlaubnis^ seines Herrn Gebrauch zu
machen. -du-
Unerwartete Kritik. — Der später berühmte englische
Schauspieler Chester trat zu Beginn seiner Karriere in einer
Provinzialstadt auf und bemerkte in den vorderen Reihen
eine alte Dame, der fein Spiel Thränen erpreßte. Er fühlte
sich davon so geschmeichelt, daß er den Theaterdiener zu ihr
schickte und fragen ließ, ob er ihr nach der Vorstellung seine
Aufwartung machen dürfe, was bejaht wurde. Aeußerst huld-
voll näherte er sich der alten Frau.
„Mein Spiel hat Sie gerührt, meine Dame, wie ich be-
merkte," sagte er.
„Ach Gott, ja," sprach die alte Frau. „Ich habe
nämlich einen Sohn, der auch unter die Schauspieler gegangen
ist, und den ich eine Ewigkeit nicht gesehen habe. Und als
ich Sie nun spielen sah, fiel mir ein, daß er sich am Ende
auch so blamirt und — und —"
Und da brach der schon versiegte Thränenstrom auf's Neue
aus, und der Schauspieler ging still von dannen.
Chester ging diese Kritik sehr zu Herzen; er spornte von
nun ab all' seine Kräfte an und erreichte später eine hohe
Stufe künstlerischer Vollkommenheit. -dn-
Hin Lebenslustiger. — In die'Klinik des verstorbenen
Wiener Professors Billroth kam eines Tages ein schon ziemlich
alter Herr, um den berühmten Chirurgen wegen eines Nasen-
leidens zu konsultiren. Der Patient hatte nur noch eine halbe
Nase und bat den Professor, ihm eine schöne, künstliche anzusetzen.
„Wie alt sind Sie denn?" fragte Billroth.
„Achtzig Jahre!" lautete die Antwort.
„Ja, verehrter Herr, wollen Sie sich denn in Ihrem hohen
Alter noch den Gefahren einer solchen Operation aussetzen?"
meinte Billroth wohlwollend.
„Herr Professor," versetzte der Alte, „mein seliger Vater
ist 125 Jahre alt geworden, und ich sehe gar nicht ein, wes-
halb ich mich noch 45 Jahre ohne Nase behelfen soll." L-n.
Iuditgurns-Ausgade der Illustrierten GeUPicstte des Krieges 1870/74.
Im unterzeichneten Verlage erscheint:
Illustrierte Geschichte des Krieges 1870/71.
— InviMums-AuSgave. -
Alle 14 Tage erscheint ein reich illustriertes Heft in größtem chuart-Zormat.
Vollständig in 30 Heften zum Preise von je 25 Pfennig.
Die meisten Buch-, Kolportagehandlungen, Journalexpedienten rc. haben das erste Heft auf Lager und nehmen Bestellungen auf das Werk entgegen.
Anion Deutsche Aerlagsgesettschaft in Stuttgart, Wertin, Leipzig.
615
Das Buch für Alle.
von kleinen Rastelbindern auf und zog den Unter-
nehmer zur Rechenschaft, der diese Kinder elender als
das Vieh, in Erdhöhlen wohnen ließ, sie unbarmherzig
schlug und ihnen nichts zu essen gab, sondern sie zu
ihrer Ernährung auf den Bettel anwies. In allen
größeren Städten aber findet man heute noch solche
„Kolonien" von Slowaken.
Wir kommen nun zu den einschlägigen Verhältnissen
in Deutschland. Dieselben sind nicht so schlimm als
in Frankreich und Italien, aber doch fast ebenso arg
wie in England. Zwar haben wir einen allgemeinen,
streng durchgeführten Schulzwang, aber in den großen
Städten hat man dadurch noch keine Kontrole über
den Bettel der Kinder außerhalb der Schulstunden oder
des schulpflichtigen Alters.
Auch in den Großstädten Deutschlands schicken Eltern
ihre Kinder gewerbsmäßig täglich zum Bettel aus, auch
hier werden Kinder gegen Bezahlung zum Vettel ver-
liehen. In den Vorstädten dieser Mittelpunkte des
Handels, Gewerbes und Verkehrs wird man fast aus-
nahmslos nngebettelt, und bettelnde Kinder kommen
auch in die Häuser. Darum soll man einem betteln-
den Kinde nie eine Gabe geben, ohne die Verhältnisse
geprüft zu haben, und wer in falsch angewendetem
Mitleid Kindern ohne Weiteres Geld gibt, ist mit-
verantwortlich dafür, daß solche Kinder dem Laster und
Verbrechen verfallen. Alan gebe sich nur die Mühe,
der Bedürftigkeit der Eltern dieser Kinder nachzuforschen,
und mair wird Wunder erleben. Man wird finden,
daß die Eltern vom Bettel der Kinder leben, indem sie
dieselben in entfernte Stadttheile zum Einsammeln von
Gaben senden. In dem Hause, in dem die Leute
wohnen, gelten sie vielleicht als ganz gut situirt. Man
wird auch entdecken, daß Kinder ohne Vorwissen der
Eltern betteln gehen, um sich Geld zu Näschereien zu
verschaffen, und in Berlin ist es anständigen Bürgers-
leuten vorgekommen, daß ihre mangelhaft beaufsichtigten
Kinder von der Polizei beim Betteln ahgefaßt wurden.
Die Kinder hatten es von Spielgefährten auf der
Straße erfahren, daß man sich durch Bettel Geld zu
Näschereien und geheimen Ausgaben verschaffen könne.
Man mache es sich zum Grundsatz, jedes Kind, das
betteln kommt, nach der Wohnung der Eltern zu fragen.
In vielen Füllen werden die Kinder auf diese Frage
hin die Flucht ergreifen. Man erkundige sich, wenn
die Kinder ohne Zögern eine Adresse angeben, nach
dieser und gebe, wenn wirkliche Armuth vorhanden ist,
reichlich. Kinder, die um Nahrung betteln, wird man
freilich nicht leicht ungespeist von der Thür gehen lassen.
Unter keinen Umständen aber gebe man Weibs-
personen etwas, die mit einer ganzen Schaar Kinder
betteln kommen. Eine Mutter, die noch eine Spur
von Schamgefühl hat, nimmt ihre Kinder nicht zum
Betteln mit, selbst wenn sie in der höchsten Noth ist.
Vor Allem erscheint sie nicht mit einem halben Dutzend.
Solche Weiber sind gewerbsmäßige und abgefeimte
Gaunerinnen, die mit gemietheten Kindern ihr Ge-
werbe betreiben.
Diese Art des Kinderbettels wird übrigens weniger
in den deutschen Großstädten, als in den Provinzen
und Einzelstaaten betrieben, z. B. in Schleswig-Holstein,
Mecklenburg, Pommern, Hannover, Württemberg und
Baden. Die Bettlerinnen find ausnahmslos „Dappel-
fchicksen", wie der Fechtbruder in der sogenannten
„Kundensprache" sagt, und die „Schrabbiner" (Kinder)
sind für den Tag von anderen Vagabunden geborgt.
Jede dieser „Dappelschicksen", die in einem Tage ganze
Dörfer abfechten und einen unversieglichen Vorrath von
Krokodilsthrünen zur Verfügung haben, zieht mit einem
Strolch herum, der die Früchte des Bettels einheimst
und das bare Geld vertrinkt. Während das Frauen-
zimmer bettelt, weilt er außerhalb des Ortes wartend,
vielleicht in einem Gebüsche schlafend. Er darf bei der
Rettelfahrt nicht dabei sein, denn die „Dappelschickse"
gibt sich stets für die Wittwe eines Verunglückten oder
die Gattin eines fchwerkranken Mannes aus und weiß
das Mitleid so zu erregen, daß selbst wiederholt durch
Schwindler getäuschte Leute wieder in die Tasche greifen.
Die bei dein Bettel verwendeten Kinder werden in den
„Pennen", in denen die Frauenzimmer ebenso wie die
männlichen Strolche und Fechtbrüder ihr Hauptquartier
haben, von Hand zu Hand verborgt und vermiethet.
Oft kommen sie nie zu ihrer Mutter zurück, und die
„Dappelschickse", die sie gerade benützt, „vergißt" sie
einmal in irgend einem Orte, wenn sie ihr lästig
werden, d. h. sie fetzt sie aus und überläßt sie der
Gemeinde als „Armenkinder".
Weder Gesetz noch Polizei sind bisher im Stande
gewesen, gegen diese traurigen Zustände dauernd etwas
auszurichten. Darum thue das Publikum sein Mög-
lichstes, sich vorher über die wirkliche Bedürftigkeit der
Personen, denen es gibt, zu unterrichten, damit der
Kinderbettel und Kinderhandel wenigstens etwas ein-
geschränkt werde.
(Nachdruck verboten.)
Akte gekannte in neuem Kervande. — In das Privat-
bureau eines Gasthofbesitzers in einer großen Provinzialstadt
treten zwei Herren, welche schon seit einigen Tagen in jenem
Gasthofe logiren.
„Wir habesr eine Bitte, Herr Wirth. Bei unserer Kund-
schaft haben wir hier eine Menge Geld eingenommen, wollen
Sie die Güte haben und uns in Ihrem Geldschranke diesen
Betitel mit etwa 1500 Mark bis zu unserer Abreise ver-
wahret:?"
Der eine der Herren zeigt einen großen leinenen Beutel,
der sich nach Oeffnung mit großen und kleinen Silberstücken
gefüllt erweist.
„Wir werden Ihnen das Geld aus diesem Beutel vor-
zählen," sagt der andere Gast zu dem Wirthe. „Sie haben
wohl die Freundlichkeit und geben uns eine Bescheinigung
über den empfangenen Betrag."
Schon ist der Inhalt des Beutels auf den Tisch geschüttet,
und mit der Gewandtheit, welche Kaufleute auszeichnet, zählen
die beiden Herren das Geld übersichtlich aus. Der Wirth hilft
selbst dabei. Er zählt sorgfältig die Silbermünzen nach und
findet, daß sie zusammen 1480 Mark betragen. Dann packt
er selbst das Geld wieder in den Beutel, bindet ihn zu und
tritt an sein Pult, um eine Quittung zu schreiben, laut
welcher er voir den Herren 17. bt. die Summe von 1480 Mark
in Silber zur Aufbewahrung erhalten hat. Die beiden Gäste
bitten nun um Entschuldigung wegen der Mühe, die sie dem
Wirthe verursachen.
„Gar keine Ursache, meine Herren! Es ist mir viel lieber,
Sie überliefern das Geld mir, und ich verwahre es in meinem
Tresor, als doß Sie es in Ihrem Zimmer lassen, wo es ge-
stohlen werden kann."
Zwei Tage später wollen die beiden Herren abrcisen. Sie
kommen in das Privatkomptoir des Gastwirths, bezahlen ihre
Rechnung und sagen: „Bitte, Herr Wirth, geben Sie uns
unser Geld zurück. Sie würden uns eine große Gefälligkeit
erweisen, wenn Sie uns den Betrag in Bailknoten und Gold
auszahlen würden. Sie können sich denken, daß für die Weiter-
reise der Beutel mit dem Silbergelde für uns eine große Last
ist. Sie haben ja den Inhalt des Beutels selbst nachgezählt
und wissen, daß 1480 Mark in Silber darin sind."
„Natürlich, meine Herren, bin ich gern bereit. Ihnen an-
deres Geld zu geben," erklärt der Wirth. Er geht an seinen
Geldschrank, in dein noch immer unberührt der Beutel mit
dem Silbergeld steht, und holt 1480 Mark in Neichskassen-
scheinen und Gold heraus. Die Gäste zählen sorgfältig das
Geld nach, stecken es ein, bedanken sich und reisen ab.
Einige Tage später hat der Wirth eine größere Zahlung
zu machen und will das Silbergeld dazu verwenden. Er
öffnet den Beutel und findet ihn zu seinem Erstaunen mit
werthlosen Kupfermünzen gefüllt. Er glaubt zuerst an Zauberei,
kommt aber bald dahinter, daß er es mit Gaunern zu thun
gehabt hat, die den richtigen Beutel mit dem abgezählten
Silbergcld in dein Augenblick gegen einen gleich aussehenden,
mit alten Kupfermünzen gefüllteil, vertauschten, als er die
Empfangsbescheinigung schrieb und seine Aufmerksamkeit voll
dem auf dem Tische stehenden Geldbeutel abwendete. Schnell
eilt er zur Polizei. Der Kriminalbeamte, dem er die Sache
erzählt, lächelt.
„Ennevotenne-Macher," sagt er. „Das sind alte Bekannte
in neuem Gewände!"
„Aber ich habe noch nie etwas von einem derartigen
Schwindel gelesen."
„Das glaube ich Ihnen, werther Herr; die alten Gauner-
kniffe sind eben dein Publikum unbekannt. Die Tageszeitungen
bringen jetzt stets Berichte über die neuesten Gaunereien. Da-
durch wird den Gaunern ihr Handwerk sehr erschwert und sie
sind gezwungen, auf Kniffe zurückzugreifen, die man nur noch
in alten Kriminalbüchern verzeichnet findet. Bewundernswerth
ist es nur, wie die Gauner verstehen, diese alten Kniffe den
modernen Verhältnissen anzupassen. In den vierziger und
fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts waren die Enne-
votenne-Macher eine Spezialität des Ladendiebstahls. Sie
machten bei Goldarbeitern und Juwelieren reiche Einkäufe,
und immer stellte es sich heraus, daß sie nicht genügend Geld
bei sich hatten, um die hohe Kaufsumme zu erlegen. Sie er-
klärten dem Juwelier, sie wollten am nächsten Tage wieder-
kommen, um die Sachen zu bezahlen, und baten, die aus-
gewählten Gegenstände ihnen zu verwahren. Sie zogen dann
eine Schachtel heraus,'die sie dem Juwelier gaben, indem
sie ihn ersuchten, die ausgewählten Gegenstände in diese
Schachtel zu thun. Dann erbaten sie sich Licht und Siegel-
lack, um mit ihren Siegelringen die Schachtel zu versiegeln.
Sie behaupteten, sie würden am nächsten Tage einen Boten
mit dem Gelds schicken, und diesem sollte dann die versiegelte
Schachtel ohne Weiteres eingehändigt werden. Der Kniff der
Gauner bestand darin, die Schachtel mit einer ganz ähnlichen
zweiten, die sie bei sich führten, zu vertauschen. Dieser Kniff
wurde den Juwelieren schließlich doch allgemein bekannt und
das Geschäft den Ennevotenne-Machern unmöglich gemacht.
Jetzt lebt es in neuem Gewände wieder auf, denn Sie werden
zugestehen, daß der Betrug bei Ihnen ganz nach der alten
Praxis ausgeführt ist."
Diese Erklärung-des Kriminalisten ist für den Wirth recht
interessant, aber seine 1480 Mark bekommt er dadurch doch
nicht zurück. Passirt dieser Fall an einem Orte, wo nicht
viele Zeitungen erscheinen und wo nicht die Kriminalpolizei
selbst neue Betrugsfälle veröffentlicht, so wird von dem alten
Gaunerkniffe in neuer Form in der Oesfentlichkeit gar nichts
bekannt. Der Wirth selbst schweigt über die Sache, um seinen
Kredit und den Ruf seines Gasthofes nicht zu schädigen. Darum
wollen wir diesen alten Bekannten in neuem Gewände
dem weiten Leserkreise unseres Blattes sofort vorstellen, viel-
leicht, daß Dieser oder Jener dadurch vor Schaden bewahrt
wird. A. O. Kl.
Allzu devot. — Von dem unermeßlichen Respekte, womit
die Welt des 17. Jahrhunderts zu dem hohen Adel aufblickte,
gibt folgendes merkwürdige Beispiel Zeugniß: Der Herzog
von Nivernais hatte einen Intendanten, den er hochschätzte,
und der sterbenskrank war. Um zu sehen, wie es mit ihm
stehe, begab er sich zu ihm und hatte die Gnade, sich persönlich
nach seinem Befinden zu erkundigen. Der mit dem Tode
Ringende richtete sich voll Verwirrung über die Ehre, die
ihn: widerfuhr, mit Anstrengung in die Höhe und sagte mit
dem Tone der tiefsten Demutzh: „Ach, gnädigster Herr, nehmen
Sie mir nur nicht übel, daß ich in Ihrer Gegenwart sterbe."
Der Herzog versetzte im höchsten Grade gerührt: „Geniren
Sie sich nicht, mein bester Freund!" und der Intendant säumte
nicht, von der gütigen Erlaubnis^ seines Herrn Gebrauch zu
machen. -du-
Unerwartete Kritik. — Der später berühmte englische
Schauspieler Chester trat zu Beginn seiner Karriere in einer
Provinzialstadt auf und bemerkte in den vorderen Reihen
eine alte Dame, der fein Spiel Thränen erpreßte. Er fühlte
sich davon so geschmeichelt, daß er den Theaterdiener zu ihr
schickte und fragen ließ, ob er ihr nach der Vorstellung seine
Aufwartung machen dürfe, was bejaht wurde. Aeußerst huld-
voll näherte er sich der alten Frau.
„Mein Spiel hat Sie gerührt, meine Dame, wie ich be-
merkte," sagte er.
„Ach Gott, ja," sprach die alte Frau. „Ich habe
nämlich einen Sohn, der auch unter die Schauspieler gegangen
ist, und den ich eine Ewigkeit nicht gesehen habe. Und als
ich Sie nun spielen sah, fiel mir ein, daß er sich am Ende
auch so blamirt und — und —"
Und da brach der schon versiegte Thränenstrom auf's Neue
aus, und der Schauspieler ging still von dannen.
Chester ging diese Kritik sehr zu Herzen; er spornte von
nun ab all' seine Kräfte an und erreichte später eine hohe
Stufe künstlerischer Vollkommenheit. -dn-
Hin Lebenslustiger. — In die'Klinik des verstorbenen
Wiener Professors Billroth kam eines Tages ein schon ziemlich
alter Herr, um den berühmten Chirurgen wegen eines Nasen-
leidens zu konsultiren. Der Patient hatte nur noch eine halbe
Nase und bat den Professor, ihm eine schöne, künstliche anzusetzen.
„Wie alt sind Sie denn?" fragte Billroth.
„Achtzig Jahre!" lautete die Antwort.
„Ja, verehrter Herr, wollen Sie sich denn in Ihrem hohen
Alter noch den Gefahren einer solchen Operation aussetzen?"
meinte Billroth wohlwollend.
„Herr Professor," versetzte der Alte, „mein seliger Vater
ist 125 Jahre alt geworden, und ich sehe gar nicht ein, wes-
halb ich mich noch 45 Jahre ohne Nase behelfen soll." L-n.
Iuditgurns-Ausgade der Illustrierten GeUPicstte des Krieges 1870/74.
Im unterzeichneten Verlage erscheint:
Illustrierte Geschichte des Krieges 1870/71.
— InviMums-AuSgave. -
Alle 14 Tage erscheint ein reich illustriertes Heft in größtem chuart-Zormat.
Vollständig in 30 Heften zum Preise von je 25 Pfennig.
Die meisten Buch-, Kolportagehandlungen, Journalexpedienten rc. haben das erste Heft auf Lager und nehmen Bestellungen auf das Werk entgegen.
Anion Deutsche Aerlagsgesettschaft in Stuttgart, Wertin, Leipzig.