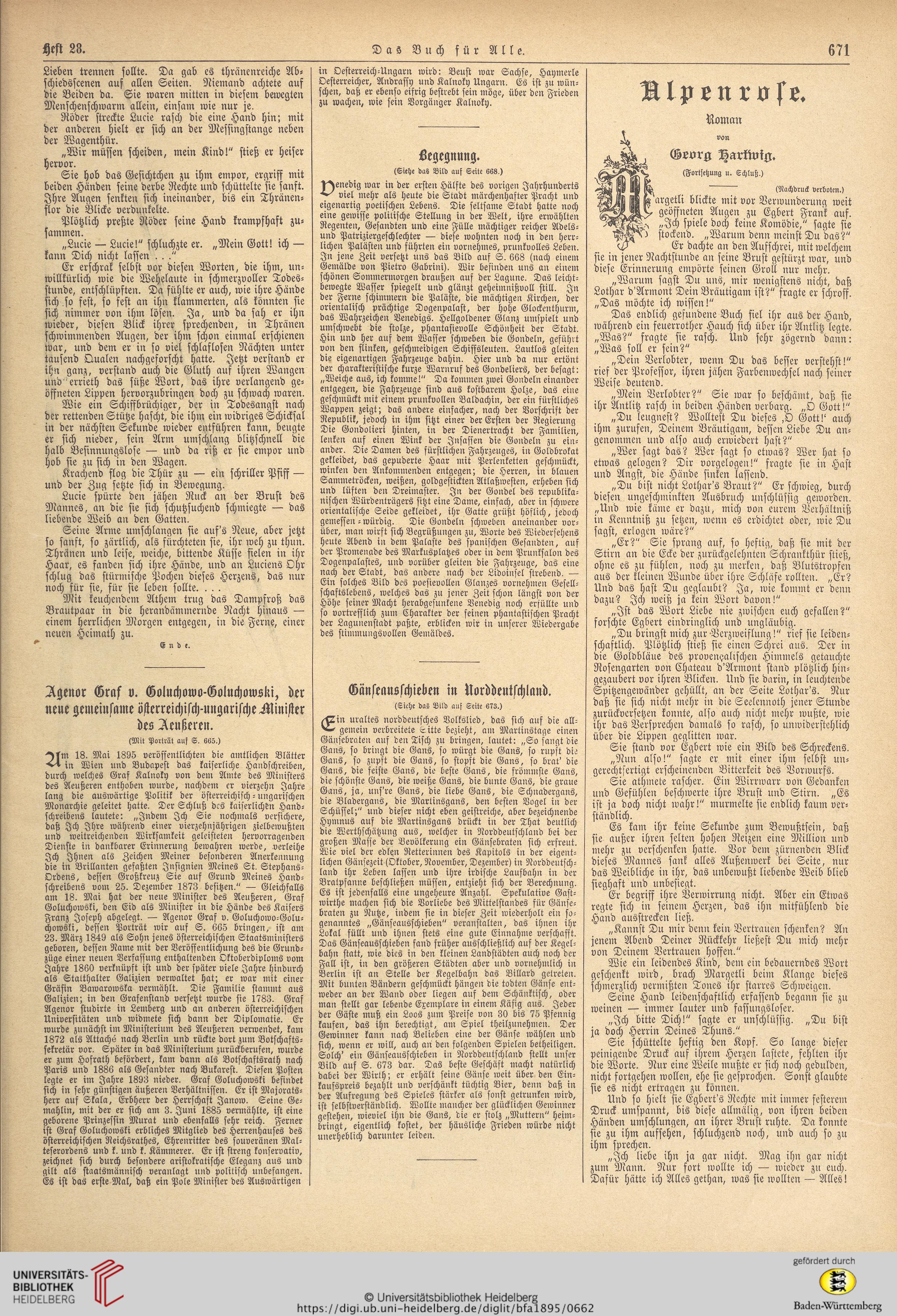Heft 28.
Das Buch für Alle.
671
Lieben trennen sollte. Da gab es thränenreiche Ab-
schiedsscenen auf allen Seiten. Niemand achtete auf
die Beiden da. Sie waren mitten in diesem bewegten
Menschenschwarm allein, einsam wie nur je.
Röder streckte Lucie rasch die eine Hand hin; mit
der anderen hielt er sich an der Messingstange neben
der Wagenthür.
„Wir müssen scheiden, mein Kind!" stieß er heiser
hervor.
Sie hob das Gesichtchen zu ihm empor, ergriff mit
beiden Händen seine derbe Rechte und schüttelte sie sanft.
Ihre Augen senkten sich ineinander, bis ein Thränen-
flor die Blicke verdunkelte.
Plötzlich preßte Röder seine Hand krampfhaft zu-
sammen.
„Lucie — Lucie!" schluchzte er. „Mein Gott! ich —
kann Dich nicht lassen . . ."
Er erschrak selbst vor diesen Worten, die ihm, un-
willkürlich wie die Wehelaute in schmerzvoller Todes-
stunde, entschlüpften. Da fühlte er auch, wie ihre Hände
sich so fest, so fest an ihn klammerten, als könnten sie
sich nimmer von ihm lösen. Ja, und da sah er ihn
wieder, diesen Blick ihrer sprechenden, in Thränen
schwimmenden Augen, der ihm schon einmal erschienen
war, und dem er in so viel schlaflosen Nächten unter
tausend Qualen nachgeforscht hatte. Jetzt verstand er
ihn ganz, verstand auch die Gluth auf ihren Wangen
und errieth das süße Wort, das ihre verlangend ge-
öffneten Lippen hervorzubringen doch zu schwach waren.
Wie ein Schiffbrüchiger, der in Todesangst nach
der rettenden Stütze hascht, die ihm ein widriges Schicksal
in der nächsten Sekunde wieder entführen kann, beugte
er sich nieder, sein Arm umschlang blitzschnell die
halb Besinnungslose — und da riß er sie empor und
hob sie zu sich in den Wagen.
Krachend flog die Thür zu — ein schriller Pfiff —
und der Zug fetzte sich in Bewegung.
Lucie spürte den jähen Ruck an der Brust des
Mannes, an die sie sich schutzsuchend schmiegte — das
liebende Weib an den Gatten.
Seine Arme umschlangen sie auf's Neue, aber jetzt
so sanft, so zärtlich, als fürchteten sie, ihr weh zu thun.
Thränen und leise, weiche, bittende Küsse fielen in ihr
Haar, es sanden sich ihre Hände, und an Luciens Ohr
schlug das stürmische Pochen dieses Herzens, das nur
noch für sie, für sie leben sollte. . . .
Mit keuchendem Athem trug das Dampfroß das
Brautpaar in die herandämmernde Nacht hinaus —
einem herrlichen Morgen entgegen, in die Ferne, einer
neuen Heimath zu.
Ende.
Agenor Graf v. Goluchowo-Goluchowski, -er
neue gemeinsame österreichisch-ungarische Minister
-es Aeußeren.
(Mit Porträt auf S. 665.)
18. Mai 1895 veröffentlichten die amtlichen Blätter
in Wien und Budapest das kaiserliche Handschreiben,
durch welches Graf Kalnoky von dem Amte des Ministers
des Aeußeren enthoben wurde, nachdem er vierzehn Jahre
lang die auswärtige Politik der österreichisch-ungarischen
Monarchie geleitet hatte. Der Schluß des kaiserlichen Hand-
schreibens lautete: „Indem Ich Sie nochmals versichere,
daß Ich Ihre während einer vierzehnjährigen zielbewußten
und weitreichenden Wirksamkeit geleisteten hervorragenden
Dienste in dankbarer Erinnerung bewahren werde, verleihe
Ich Ihnen als Zeichen Meiner besonderen Anerkennung
die in Brillanten gefaßten Insignien Meines St. Stephans-
Ordens, dessen Großkreuz Sie auf Grund Meines Hand-
schreibens vom 25. Dezember 1873 besitzen." — Gleichfalls
am 18. Mai hat der neue Minister des Aeußeren, Graf
Goluchowski, den Eid als Minister in die Hände des Kaisers
Franz Joseph abgelegt. — Agenor Graf v. Goluchowo-Golu-
chowski, dessen Porträt wir auf S. 665 bringen, ist am
23. März 1849 als Sohn jenes österreichischen Staatsministers
geboren, dessen Name mit der Veröffentlichung des die Grund-
züge einer neuen Verfassung enthaltenden Oktoberdiploms vom
Jahre 1860 verknüpft ist und der später viele Jahre hindurch
als Statthalter Galizien verwaltet hat; er war mit einer
Gräfin Bawarowska vermählt. Die Familie stammt aus
Galizien; in den Grafenstand versetzt wurde sie 1783. Graf
Agenor studirte in Lemberg und an anderen österreichischen
Universitäten und widmete sich dann der Diplomatie. Er
wurde zunächst im Ministerium des Aeußeren verwendet, kam
1872 als Attachs nach Berlin und rückte dort zum Botschafts-
sekretär vor. Später in das Ministerium zurückberufen, wurde
er zum Hosrath befördert, kam dann als Botschaftsrath nach
Paris und 1886 als Gesandter nach Bukarest. Diesen Posten
legte er im Jahre 1893 nieder. Graf Goluchowski befindet
sich in sehr günstigen äußeren Verhältnissen. Er ist Majorats-
herr auf Skala, Erbherr der Herrschaft Janow. Seine Ge-
mahlin, mit der er sich am 3. Juni 1885 vermählte, ist eine
geborene Prinzessin Murat und ebenfalls sehr reich. Ferner
ist Graf Goluchowski erbliches Mitglied des Herrenhauses des
österreichischen Reichsrathes, Ehrenritter des souveränen Mal-
teserordens und k. und k. Kämmerer. Er ist streng konservativ,
zeichnet sich durch besondere aristokratische Eleganz aus und
gilt als staatsmännisch veranlagt und politisch unbefangen.
Es ist das erste Mal, daß ein Pole Minister des Auswärtigen
in Oesterreich-Ungarn wird: Beust war Sachse, Haymerle
Oesterreicher, Andrassy und Kalnoky Ungarn. Es ist zu wün-
schen, daß er ebenso eifrig bestrebt sein möge, über den Frieden
zu wachen, wie sein Vorgänger Kalnoky.
Begegnung.
(Siehe das Bild auf Seite 668.)
I^enedig war in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
viel mehr als heute die Stadt märchenhafter Pracht und
eigenartig poetischen Lebens. Die seltsame Stadt hatte noch
eine gewisse politische Stellung in der Welt, ihre erwählten
Regenten, Gesandten und eine Fülle mächtiger reicher Adels-
und Patriziergeschlechter — diese wohnten noch in den herr-
lichen Palästen und führten ein vornehmes, prunkvolles Leben.
In jene Zeit versetzt uns das Bild auf S. 668 (nach einem
Gemälde von Pietro Gabrini). Wir befinden uns an einem
schönen Sommermorgen draußen auf der Lagune. Das leicht-
bewegte Wasser spiegelt und glänzt geheimnißvoll still. In
der Ferne schimmern die Paläste, die mächtigen Kirchen, der
orientalisch prächtige Dogenpalast, der hohe Glockenthurm,
das Wahrzeichen Venedigs. Hellgoldener Glanz umspielt und
umschwebt die stolze, phantasievolle Schönheit der Stadt.
Hin und her auf dem Wasser schweben die Gondeln, geführt
von den flinken, geschmeidigen Schiffsleuten. Lautlos gleiten
die eigenartigen Fahrzeuge dahin. Hier und da nur ertönt
der charakteristische kurze Warnruf des Gondeliers, der besagt:
„Weiche aus, ich komme!" Da kommen zwei Gondeln einander
entgegen, die Fahrzeuge sind aus kostbarem Holze, das eine
geschmückt mit einem prunkvollen Baldachin, der ein fürstliches
Wappen zeigt; das andere einfacher, nach der Vorschrift der
Republik, jedoch in ihm sitzt einer der Ersten der Regierung
Die Gondolieri hinten, in der Dienertracht der Familien,
lenken auf einen Wink der Insassen die Gondeln zu ein-
ander. Die Damen des fürstlichen Fahrzeuges, in Goldbrokat
gekleidet, das gepuderte Haar mit Perlenketten geschmückt,
winken den Ankommenden entgegen; die Herren, in blauen
Sammetröcken, weißen, goldgestickten Atlaßwesten, erheben sich
und lüften den Dreimaster. In der Gondel des republika-
nischen Würdenträgers sitzt eine Dame, einfach, aber in schwere
orientalische Seide gekleidet, ihr Gatte grüßt höflich, jedoch
gemessen-würdig. Die Gondeln schweben aneinander vor-
über, man wirft sich Begrüßungen zu, Worte des Wiedersehens
heute Abend in dem Palaste des spanischen Gesandten, auf
der Promenade des Markusplatzes oder in dem Prunksalon des
Dogenpalastes, und vorüber gleiten die Fahrzeuge, das eine
nach der Stadt, das andere nach der Lidoinsel strebend. —
Ein solches Bild des poesievollen Glanzes vornehmen Gesell-
schaftslebens, welches das zu jener Zeitschon längst von der
Höhe seiner Macht herabgesunkene Venedig noch erfüllte und
so vortrefflich zum Charakter der feinen phantastischen Pracht
der Lagunenstadt paßte, erblicken wir in unserer Wiedergabe
des stimmungsvollen Gemäldes.
Gänsenusschie-en m Ror--eutschlan-.
(Siche das Bild auf Seite 673.)
/<2in uraltes norddeutsches Volkslied, das sich auf die all-
gemein verbreitete Sitte bezieht, am Martinstage einen
Gänsebraten aus den Tisch zu bringen, lautet: „So sangt die
Gans, so bringt die Gans, so würgt die Gans, so rupft die
Gans, so zupft die Gans, so stopft die Gans, so brat' die
Gans, die feiste Gans, die beste Gans, die frömmste Gans,
die schönste Gans, die weiße Gans, die bunte Gans, die graue
Gans, ja, unsre Gans, die liebe Gans, die Schnadergans,
die Bladergans, die Martinsgans, den besten Vogel in der
Schüssel;" und dieser nicht eben geistreiche, aber bezeichnende
Hymnus auf die Martinsgans drückt in der That deutlich
die Werthschätzung aus, welcher in Norddeutschland bei der
großen Masse der Bevölkerung ein Gänsebraten sich erfreut.
Wie viel der edlen Retterinnen des Kapitols in der eigent-
lichen Günsezeit (Oktober, November, Dezember) in Norddeutsch-
land ihr Leben lassen und ihre irdische Laufbahn in der
Bratpfanne beschließen müssen, entzieht sich der Berechnung.
Es ist jedenfalls eine ungeheure Anzahl. Spekulative Gast-
wirthe machen sich die Vorliebe des Mittelstandes für Gänse-
braten zu Nutze, indem sie in dieser Zeit wiederholt ein so-
genanntes „Gänseausschieben" veranstalten, das ihnen ihr
Lokal füllt und ihnen stets eine gute Einnahme verschafft.
Das Gänseausschieben fand früher ausschließlich aus der Kegel-
bahn statt, wie dies in den kleinen Landstädten auch noch der
Fall ist, in den größeren Städten aber und vornehmlich in
Berlin ist an Stelle der Kegelbahn das Billard getreten.
Mit bunten Bändern geschmückt hängen die todten Gänse ent-
weder an der Wand oder liegen auf dem Schänktisch, oder
man stellt gar lebende Exemplare in einem Käfig aus. Jeder
der Gäste muß ein Loos zum Preise von 30 bis 75 Pfennig
kaufen, das ihn berechtigt, am Spiel theilzunehmen. Der
Gewinner kann nach Belieben eine der Gänse wählen und
sich, wenn er will, auch an den folgenden Spielen betheiligen.
Solch' ein Gänseausschieben in Norddeutschland stellt unser
Bild auf S. 673 dar. Das beste Geschäft macht natürlich
dabei der Wirth; er erhält seine Gänse weit über den Ein-
kaufspreis bezahlt und verschänkt tüchtig Vier, denn daß in
der Aufregung des Spieles stärker als sonst getrunken wird,
ist selbstverständlich. Wollte mancher der glücklichen Gewinner
gestehen, wieviel ihn die Gans, die er stolz „Muttern" heim-
bringt, eigentlich kostet, der häusliche Frieden würde nicht
unerheblich darunter leiden.
Alpen rose.
Roman
von
Georg Hartwig.
(Fortsetzung u. Schluß.)
(Nachdruck verboten.)
argetli blickte mit vor Verwunderung weit
geöffneten Augen zu Egbert Frank auf.
„Ich spiele doch keine Komödie," sagte sie
stockend. „Warum denn meinst Du das?"
Er dachte an den Aufschrei, mit welchem
sie in jener Nachtstunde an seine Brust gestürzt war, und
diese Erinnerung empörte seinen Groll nur mehr.
„Warum sagst Du uns, mir wenigstens nicht, daß
Lothar d'Armont Dein Bräutigam ist?" fragte er schroff.
„Das möchte ich wissen!"
Das endlich gefundene Buch fiel ihr aus der Hand,
während ein seuerrother Hauch sich über ihr Antlitz legte.
„Was?" fragte sie rasch. Und sehr zögernd dann:
„Was soll er sein?"
„Dein Verlobter, wenn Du das besser verstehst!"
rief der Professor, ihren jähen Farbenwechsel nach seiner
Weise deutend.
„Mein Verlobter?" Sie war so beschämt, daß sie
ihr Antlitz rasch in beiden Händen verbarg. „O Gott!"
„Du leugnest? Wolltest Du dieses ,O Gott!' auch
ihm zurufen, Deinem Bräutigam, dessen Liebe Du an-
genommen und also auch erwiedert hast?"
„Wer sagt das? Wer sagt so etwas? Wer hat so
etwas gelogen? Dir vorgelogen!" fragte sie in Hast
und Angst, die Hände sinken lassend.
„Du bist nicht Lothar's Braut?" Er schwieg, durch
diesen ungeschminkten Ausbruch unschlüssig geworden.
„Und wie käme er dazu, mich von eurem Verhültniß
in Kenntniß zu setzen, wenn es erdichtet oder, wie Du
sagst, erlogen wäre?"
„Er?" Sie sprang auf, so heftig, daß sie mit der
Stirn an die Ecke der zurückgelehnten Schrankthür stieß,
ohne es zu fühlen, noch zu merken, daß Blutstropfen
aus der kleinen Wunde über ihre Schläfe rollten. „Er?
Und das hast Du geglaubt? Ja, wie kommt er denn
dazu? Ich weiß ja kein Wort davon!"
„Ist das Wort Liebe nie zwischen euch gefallen?"
forschte Egbert eindringlich und ungläubig.
„Du bringst mich zur Verzweiflung!" rief sie leiden-
schaftlich. Plötzlich stieß sie einen Schrei aus. Der in
die Goldbläue des proven^alischen Himmels getauchte
Rosengarten von Chateau d'Armont stand plötzlich hin-
gezaubert vor ihren Blicken. Und sie darin, in leuchtende
Spitzengewänder gehüllt, an der Seite Lothar's. Nur
daß sie sich nicht mehr in die Seelennoth jener Stunde
zurückversetzen konnte, also auch nicht mehr wußte, wie
ihr das Versprechen damals so rasch, so unwiderstehlich
über die Lippen geglitten war.
Sie stand vor Egbert wie ein Bild des Schreckens.
„Nun also!" sagte er mit einer ihm selbst un-
gerechtfertigt erscheinenden Bitterkeit des Vorwurfs.
Sie athmete rascher. Ein Wirrwarr von Gedanken
und Gefühlen beschwerte ihre Brust und Stirn. „Es
ist ja doch nicht wahr!" murmelte sie endlich kaum ver-
ständlich.
Es kam ihr keine Sekunde zum Bewußtsein, daß
sie außer ihren selten hohen Reizen eine Million und
mehr zu verschenken hatte. Vor dem zürnenden Blick
dieses Mannes sank alles Außenwerk bei Seite, nur
das Weibliche in ihr, das unbewußt liebende Weib blieb
sieghaft und unbesiegt.
Er begriff ihre Verwirrung nicht. Aber ein Etwas
regte sich in seinem Herzen, das ihn mitfühlend die
Hand ausstrecken ließ.
„Kannst Du mir denn kein Vertrauen schenken? An
jenem Abend Deiner Rückkehr ließest Du mich mehr
von Deinem Vertrauen hoffen."
Wie ein leidendes Kind, dem ein bedauerndes Wort
geschenkt wird, brach Margetli beim Klange dieses
schmerzlich vermißten Tones ihr starres Schweigen.
Seine Hand leidenschaftlich erfassend begann sie zu
weinen — immer lauter und fassungsloser.'
„Ich bitte Dich!" sagte er unschlüssig. „Du bist
ja doch Herrin Deines Thuns."
Sie schüttelte heftig den Kopf. So lange dieser
peinigende Druck auf ihrem Herzen lastete, fehlten ihr
die Worte. Nur eine Weile mußte er sich noch gedulden,
nicht fortgehen wollen, ehe sie gesprochen. Sonst glaubte
sie es nicht ertragen zu können.
Und so hielt sie Egbert's Rechte mit immer festerein
Druck umspannt, bis diese allmälig, von ihren beiden
Händen umschlungen, an ihrer Brust ruhte. Da konnte
sie zu ihm aufsehen, schluchzend noch, und auch so zu
ihm sprechen.
„Ich liebe ihn ja gar nicht. Mag ihn gar nicht
zum Mann. Nur fort wollte ich — wieder zu euch.
Dafür hätte ich Alles gethan, was sie wollten — Alles!
Das Buch für Alle.
671
Lieben trennen sollte. Da gab es thränenreiche Ab-
schiedsscenen auf allen Seiten. Niemand achtete auf
die Beiden da. Sie waren mitten in diesem bewegten
Menschenschwarm allein, einsam wie nur je.
Röder streckte Lucie rasch die eine Hand hin; mit
der anderen hielt er sich an der Messingstange neben
der Wagenthür.
„Wir müssen scheiden, mein Kind!" stieß er heiser
hervor.
Sie hob das Gesichtchen zu ihm empor, ergriff mit
beiden Händen seine derbe Rechte und schüttelte sie sanft.
Ihre Augen senkten sich ineinander, bis ein Thränen-
flor die Blicke verdunkelte.
Plötzlich preßte Röder seine Hand krampfhaft zu-
sammen.
„Lucie — Lucie!" schluchzte er. „Mein Gott! ich —
kann Dich nicht lassen . . ."
Er erschrak selbst vor diesen Worten, die ihm, un-
willkürlich wie die Wehelaute in schmerzvoller Todes-
stunde, entschlüpften. Da fühlte er auch, wie ihre Hände
sich so fest, so fest an ihn klammerten, als könnten sie
sich nimmer von ihm lösen. Ja, und da sah er ihn
wieder, diesen Blick ihrer sprechenden, in Thränen
schwimmenden Augen, der ihm schon einmal erschienen
war, und dem er in so viel schlaflosen Nächten unter
tausend Qualen nachgeforscht hatte. Jetzt verstand er
ihn ganz, verstand auch die Gluth auf ihren Wangen
und errieth das süße Wort, das ihre verlangend ge-
öffneten Lippen hervorzubringen doch zu schwach waren.
Wie ein Schiffbrüchiger, der in Todesangst nach
der rettenden Stütze hascht, die ihm ein widriges Schicksal
in der nächsten Sekunde wieder entführen kann, beugte
er sich nieder, sein Arm umschlang blitzschnell die
halb Besinnungslose — und da riß er sie empor und
hob sie zu sich in den Wagen.
Krachend flog die Thür zu — ein schriller Pfiff —
und der Zug fetzte sich in Bewegung.
Lucie spürte den jähen Ruck an der Brust des
Mannes, an die sie sich schutzsuchend schmiegte — das
liebende Weib an den Gatten.
Seine Arme umschlangen sie auf's Neue, aber jetzt
so sanft, so zärtlich, als fürchteten sie, ihr weh zu thun.
Thränen und leise, weiche, bittende Küsse fielen in ihr
Haar, es sanden sich ihre Hände, und an Luciens Ohr
schlug das stürmische Pochen dieses Herzens, das nur
noch für sie, für sie leben sollte. . . .
Mit keuchendem Athem trug das Dampfroß das
Brautpaar in die herandämmernde Nacht hinaus —
einem herrlichen Morgen entgegen, in die Ferne, einer
neuen Heimath zu.
Ende.
Agenor Graf v. Goluchowo-Goluchowski, -er
neue gemeinsame österreichisch-ungarische Minister
-es Aeußeren.
(Mit Porträt auf S. 665.)
18. Mai 1895 veröffentlichten die amtlichen Blätter
in Wien und Budapest das kaiserliche Handschreiben,
durch welches Graf Kalnoky von dem Amte des Ministers
des Aeußeren enthoben wurde, nachdem er vierzehn Jahre
lang die auswärtige Politik der österreichisch-ungarischen
Monarchie geleitet hatte. Der Schluß des kaiserlichen Hand-
schreibens lautete: „Indem Ich Sie nochmals versichere,
daß Ich Ihre während einer vierzehnjährigen zielbewußten
und weitreichenden Wirksamkeit geleisteten hervorragenden
Dienste in dankbarer Erinnerung bewahren werde, verleihe
Ich Ihnen als Zeichen Meiner besonderen Anerkennung
die in Brillanten gefaßten Insignien Meines St. Stephans-
Ordens, dessen Großkreuz Sie auf Grund Meines Hand-
schreibens vom 25. Dezember 1873 besitzen." — Gleichfalls
am 18. Mai hat der neue Minister des Aeußeren, Graf
Goluchowski, den Eid als Minister in die Hände des Kaisers
Franz Joseph abgelegt. — Agenor Graf v. Goluchowo-Golu-
chowski, dessen Porträt wir auf S. 665 bringen, ist am
23. März 1849 als Sohn jenes österreichischen Staatsministers
geboren, dessen Name mit der Veröffentlichung des die Grund-
züge einer neuen Verfassung enthaltenden Oktoberdiploms vom
Jahre 1860 verknüpft ist und der später viele Jahre hindurch
als Statthalter Galizien verwaltet hat; er war mit einer
Gräfin Bawarowska vermählt. Die Familie stammt aus
Galizien; in den Grafenstand versetzt wurde sie 1783. Graf
Agenor studirte in Lemberg und an anderen österreichischen
Universitäten und widmete sich dann der Diplomatie. Er
wurde zunächst im Ministerium des Aeußeren verwendet, kam
1872 als Attachs nach Berlin und rückte dort zum Botschafts-
sekretär vor. Später in das Ministerium zurückberufen, wurde
er zum Hosrath befördert, kam dann als Botschaftsrath nach
Paris und 1886 als Gesandter nach Bukarest. Diesen Posten
legte er im Jahre 1893 nieder. Graf Goluchowski befindet
sich in sehr günstigen äußeren Verhältnissen. Er ist Majorats-
herr auf Skala, Erbherr der Herrschaft Janow. Seine Ge-
mahlin, mit der er sich am 3. Juni 1885 vermählte, ist eine
geborene Prinzessin Murat und ebenfalls sehr reich. Ferner
ist Graf Goluchowski erbliches Mitglied des Herrenhauses des
österreichischen Reichsrathes, Ehrenritter des souveränen Mal-
teserordens und k. und k. Kämmerer. Er ist streng konservativ,
zeichnet sich durch besondere aristokratische Eleganz aus und
gilt als staatsmännisch veranlagt und politisch unbefangen.
Es ist das erste Mal, daß ein Pole Minister des Auswärtigen
in Oesterreich-Ungarn wird: Beust war Sachse, Haymerle
Oesterreicher, Andrassy und Kalnoky Ungarn. Es ist zu wün-
schen, daß er ebenso eifrig bestrebt sein möge, über den Frieden
zu wachen, wie sein Vorgänger Kalnoky.
Begegnung.
(Siehe das Bild auf Seite 668.)
I^enedig war in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts
viel mehr als heute die Stadt märchenhafter Pracht und
eigenartig poetischen Lebens. Die seltsame Stadt hatte noch
eine gewisse politische Stellung in der Welt, ihre erwählten
Regenten, Gesandten und eine Fülle mächtiger reicher Adels-
und Patriziergeschlechter — diese wohnten noch in den herr-
lichen Palästen und führten ein vornehmes, prunkvolles Leben.
In jene Zeit versetzt uns das Bild auf S. 668 (nach einem
Gemälde von Pietro Gabrini). Wir befinden uns an einem
schönen Sommermorgen draußen auf der Lagune. Das leicht-
bewegte Wasser spiegelt und glänzt geheimnißvoll still. In
der Ferne schimmern die Paläste, die mächtigen Kirchen, der
orientalisch prächtige Dogenpalast, der hohe Glockenthurm,
das Wahrzeichen Venedigs. Hellgoldener Glanz umspielt und
umschwebt die stolze, phantasievolle Schönheit der Stadt.
Hin und her auf dem Wasser schweben die Gondeln, geführt
von den flinken, geschmeidigen Schiffsleuten. Lautlos gleiten
die eigenartigen Fahrzeuge dahin. Hier und da nur ertönt
der charakteristische kurze Warnruf des Gondeliers, der besagt:
„Weiche aus, ich komme!" Da kommen zwei Gondeln einander
entgegen, die Fahrzeuge sind aus kostbarem Holze, das eine
geschmückt mit einem prunkvollen Baldachin, der ein fürstliches
Wappen zeigt; das andere einfacher, nach der Vorschrift der
Republik, jedoch in ihm sitzt einer der Ersten der Regierung
Die Gondolieri hinten, in der Dienertracht der Familien,
lenken auf einen Wink der Insassen die Gondeln zu ein-
ander. Die Damen des fürstlichen Fahrzeuges, in Goldbrokat
gekleidet, das gepuderte Haar mit Perlenketten geschmückt,
winken den Ankommenden entgegen; die Herren, in blauen
Sammetröcken, weißen, goldgestickten Atlaßwesten, erheben sich
und lüften den Dreimaster. In der Gondel des republika-
nischen Würdenträgers sitzt eine Dame, einfach, aber in schwere
orientalische Seide gekleidet, ihr Gatte grüßt höflich, jedoch
gemessen-würdig. Die Gondeln schweben aneinander vor-
über, man wirft sich Begrüßungen zu, Worte des Wiedersehens
heute Abend in dem Palaste des spanischen Gesandten, auf
der Promenade des Markusplatzes oder in dem Prunksalon des
Dogenpalastes, und vorüber gleiten die Fahrzeuge, das eine
nach der Stadt, das andere nach der Lidoinsel strebend. —
Ein solches Bild des poesievollen Glanzes vornehmen Gesell-
schaftslebens, welches das zu jener Zeitschon längst von der
Höhe seiner Macht herabgesunkene Venedig noch erfüllte und
so vortrefflich zum Charakter der feinen phantastischen Pracht
der Lagunenstadt paßte, erblicken wir in unserer Wiedergabe
des stimmungsvollen Gemäldes.
Gänsenusschie-en m Ror--eutschlan-.
(Siche das Bild auf Seite 673.)
/<2in uraltes norddeutsches Volkslied, das sich auf die all-
gemein verbreitete Sitte bezieht, am Martinstage einen
Gänsebraten aus den Tisch zu bringen, lautet: „So sangt die
Gans, so bringt die Gans, so würgt die Gans, so rupft die
Gans, so zupft die Gans, so stopft die Gans, so brat' die
Gans, die feiste Gans, die beste Gans, die frömmste Gans,
die schönste Gans, die weiße Gans, die bunte Gans, die graue
Gans, ja, unsre Gans, die liebe Gans, die Schnadergans,
die Bladergans, die Martinsgans, den besten Vogel in der
Schüssel;" und dieser nicht eben geistreiche, aber bezeichnende
Hymnus auf die Martinsgans drückt in der That deutlich
die Werthschätzung aus, welcher in Norddeutschland bei der
großen Masse der Bevölkerung ein Gänsebraten sich erfreut.
Wie viel der edlen Retterinnen des Kapitols in der eigent-
lichen Günsezeit (Oktober, November, Dezember) in Norddeutsch-
land ihr Leben lassen und ihre irdische Laufbahn in der
Bratpfanne beschließen müssen, entzieht sich der Berechnung.
Es ist jedenfalls eine ungeheure Anzahl. Spekulative Gast-
wirthe machen sich die Vorliebe des Mittelstandes für Gänse-
braten zu Nutze, indem sie in dieser Zeit wiederholt ein so-
genanntes „Gänseausschieben" veranstalten, das ihnen ihr
Lokal füllt und ihnen stets eine gute Einnahme verschafft.
Das Gänseausschieben fand früher ausschließlich aus der Kegel-
bahn statt, wie dies in den kleinen Landstädten auch noch der
Fall ist, in den größeren Städten aber und vornehmlich in
Berlin ist an Stelle der Kegelbahn das Billard getreten.
Mit bunten Bändern geschmückt hängen die todten Gänse ent-
weder an der Wand oder liegen auf dem Schänktisch, oder
man stellt gar lebende Exemplare in einem Käfig aus. Jeder
der Gäste muß ein Loos zum Preise von 30 bis 75 Pfennig
kaufen, das ihn berechtigt, am Spiel theilzunehmen. Der
Gewinner kann nach Belieben eine der Gänse wählen und
sich, wenn er will, auch an den folgenden Spielen betheiligen.
Solch' ein Gänseausschieben in Norddeutschland stellt unser
Bild auf S. 673 dar. Das beste Geschäft macht natürlich
dabei der Wirth; er erhält seine Gänse weit über den Ein-
kaufspreis bezahlt und verschänkt tüchtig Vier, denn daß in
der Aufregung des Spieles stärker als sonst getrunken wird,
ist selbstverständlich. Wollte mancher der glücklichen Gewinner
gestehen, wieviel ihn die Gans, die er stolz „Muttern" heim-
bringt, eigentlich kostet, der häusliche Frieden würde nicht
unerheblich darunter leiden.
Alpen rose.
Roman
von
Georg Hartwig.
(Fortsetzung u. Schluß.)
(Nachdruck verboten.)
argetli blickte mit vor Verwunderung weit
geöffneten Augen zu Egbert Frank auf.
„Ich spiele doch keine Komödie," sagte sie
stockend. „Warum denn meinst Du das?"
Er dachte an den Aufschrei, mit welchem
sie in jener Nachtstunde an seine Brust gestürzt war, und
diese Erinnerung empörte seinen Groll nur mehr.
„Warum sagst Du uns, mir wenigstens nicht, daß
Lothar d'Armont Dein Bräutigam ist?" fragte er schroff.
„Das möchte ich wissen!"
Das endlich gefundene Buch fiel ihr aus der Hand,
während ein seuerrother Hauch sich über ihr Antlitz legte.
„Was?" fragte sie rasch. Und sehr zögernd dann:
„Was soll er sein?"
„Dein Verlobter, wenn Du das besser verstehst!"
rief der Professor, ihren jähen Farbenwechsel nach seiner
Weise deutend.
„Mein Verlobter?" Sie war so beschämt, daß sie
ihr Antlitz rasch in beiden Händen verbarg. „O Gott!"
„Du leugnest? Wolltest Du dieses ,O Gott!' auch
ihm zurufen, Deinem Bräutigam, dessen Liebe Du an-
genommen und also auch erwiedert hast?"
„Wer sagt das? Wer sagt so etwas? Wer hat so
etwas gelogen? Dir vorgelogen!" fragte sie in Hast
und Angst, die Hände sinken lassend.
„Du bist nicht Lothar's Braut?" Er schwieg, durch
diesen ungeschminkten Ausbruch unschlüssig geworden.
„Und wie käme er dazu, mich von eurem Verhültniß
in Kenntniß zu setzen, wenn es erdichtet oder, wie Du
sagst, erlogen wäre?"
„Er?" Sie sprang auf, so heftig, daß sie mit der
Stirn an die Ecke der zurückgelehnten Schrankthür stieß,
ohne es zu fühlen, noch zu merken, daß Blutstropfen
aus der kleinen Wunde über ihre Schläfe rollten. „Er?
Und das hast Du geglaubt? Ja, wie kommt er denn
dazu? Ich weiß ja kein Wort davon!"
„Ist das Wort Liebe nie zwischen euch gefallen?"
forschte Egbert eindringlich und ungläubig.
„Du bringst mich zur Verzweiflung!" rief sie leiden-
schaftlich. Plötzlich stieß sie einen Schrei aus. Der in
die Goldbläue des proven^alischen Himmels getauchte
Rosengarten von Chateau d'Armont stand plötzlich hin-
gezaubert vor ihren Blicken. Und sie darin, in leuchtende
Spitzengewänder gehüllt, an der Seite Lothar's. Nur
daß sie sich nicht mehr in die Seelennoth jener Stunde
zurückversetzen konnte, also auch nicht mehr wußte, wie
ihr das Versprechen damals so rasch, so unwiderstehlich
über die Lippen geglitten war.
Sie stand vor Egbert wie ein Bild des Schreckens.
„Nun also!" sagte er mit einer ihm selbst un-
gerechtfertigt erscheinenden Bitterkeit des Vorwurfs.
Sie athmete rascher. Ein Wirrwarr von Gedanken
und Gefühlen beschwerte ihre Brust und Stirn. „Es
ist ja doch nicht wahr!" murmelte sie endlich kaum ver-
ständlich.
Es kam ihr keine Sekunde zum Bewußtsein, daß
sie außer ihren selten hohen Reizen eine Million und
mehr zu verschenken hatte. Vor dem zürnenden Blick
dieses Mannes sank alles Außenwerk bei Seite, nur
das Weibliche in ihr, das unbewußt liebende Weib blieb
sieghaft und unbesiegt.
Er begriff ihre Verwirrung nicht. Aber ein Etwas
regte sich in seinem Herzen, das ihn mitfühlend die
Hand ausstrecken ließ.
„Kannst Du mir denn kein Vertrauen schenken? An
jenem Abend Deiner Rückkehr ließest Du mich mehr
von Deinem Vertrauen hoffen."
Wie ein leidendes Kind, dem ein bedauerndes Wort
geschenkt wird, brach Margetli beim Klange dieses
schmerzlich vermißten Tones ihr starres Schweigen.
Seine Hand leidenschaftlich erfassend begann sie zu
weinen — immer lauter und fassungsloser.'
„Ich bitte Dich!" sagte er unschlüssig. „Du bist
ja doch Herrin Deines Thuns."
Sie schüttelte heftig den Kopf. So lange dieser
peinigende Druck auf ihrem Herzen lastete, fehlten ihr
die Worte. Nur eine Weile mußte er sich noch gedulden,
nicht fortgehen wollen, ehe sie gesprochen. Sonst glaubte
sie es nicht ertragen zu können.
Und so hielt sie Egbert's Rechte mit immer festerein
Druck umspannt, bis diese allmälig, von ihren beiden
Händen umschlungen, an ihrer Brust ruhte. Da konnte
sie zu ihm aufsehen, schluchzend noch, und auch so zu
ihm sprechen.
„Ich liebe ihn ja gar nicht. Mag ihn gar nicht
zum Mann. Nur fort wollte ich — wieder zu euch.
Dafür hätte ich Alles gethan, was sie wollten — Alles!