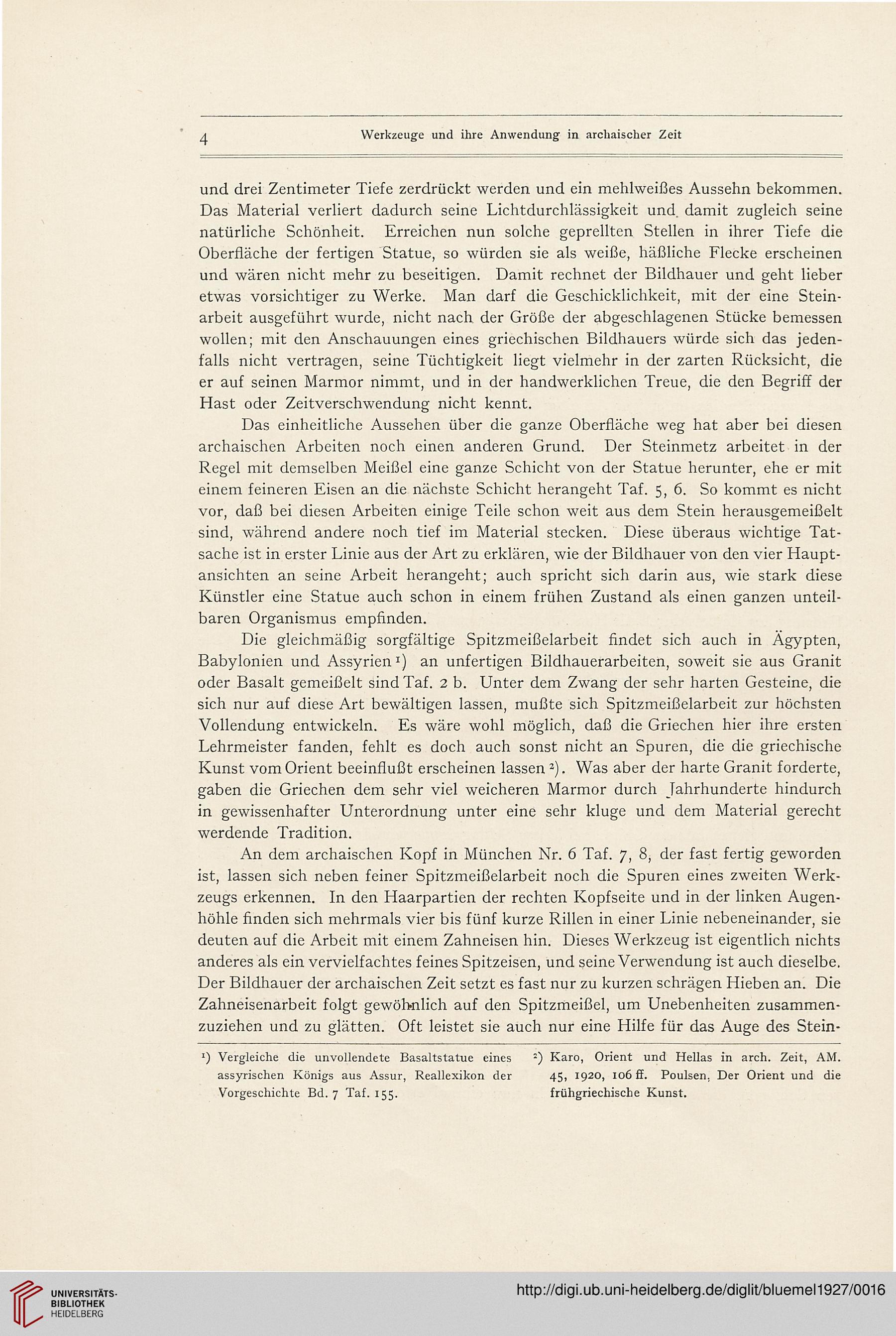Werkzeuge und ihre Anwendung in archaischer Zeit
und drei Zentimeter Tiefe zerdrückt werden und ein mehlweißes Aussehn bekommen.
Das Material verliert dadurch seine Lichtdurchlässigkeit und. damit zugleich seine
natürliche Schönheit. Erreichen nun solche geprellten Stellen in ihrer Tiefe die
Oberfläche der fertigen Statue, so würden sie als weiße, häßliche Flecke erscheinen
und wären nicht mehr zu beseitigen. Damit rechnet der Bildhauer und geht lieber
etwas vorsichtiger zu Werke. Man darf die Geschicklichkeit, mit der eine Stein-
arbeit ausgeführt wurde, nicht nach der Größe der abgeschlagenen Stücke bemessen
wollen; mit den Anschauungen eines griechischen Bildhauers würde sich das jeden-
falls nicht vertragen, seine Tüchtigkeit liegt vielmehr in der zarten Rücksicht, die
er auf seinen Marmor nimmt, und in der handwerklichen Treue, die den Begriff der
Hast oder Zeitverschwendung nicht kennt.
Das einheitliche Aussehen über die ganze Oberfläche weg hat aber bei diesen
archaischen Arbeiten noch einen anderen Grund. Der Steinmetz arbeitet in der
Regel mit demselben Meißel eine ganze Schicht von der Statue herunter, ehe er mit
einem feineren Eisen an die nächste Schicht herangeht Taf. 5, 6. So kommt es nicht
vor, daß bei diesen Arbeiten einige Teile schon weit aus dem Stein herausgemeißelt
sind, während andere noch tief im Material stecken. Diese überaus wichtige Tat-
sache ist in erster Linie aus der Art zu erklären, wie der Bildhauer von den vier Haupt-
ansichten an seine Arbeit herangeht; auch spricht sich darin aus, wie stark diese
Künstler eine Statue auch schon in einem frühen Zustand als einen ganzen unteil-
baren Organismus empfinden.
Die gleichmäßig sorgfältige Spitzmeißelarbeit findet sich auch in Ägypten,
Babylonien und Assyrien*) an unfertigen Bildhauerarbeiten, soweit sie aus Granit
oder Basalt gemeißelt sind Taf. 2 b. Unter dem Zwang der sehr harten Gesteine, die
sich nur auf diese Art bewältigen lassen, mußte sich Spitzmeißelarbeit zur höchsten
Vollendung entwickeln. Es wäre wohl möglich, daß die Griechen hier ihre ersten
Lehrmeister fanden, fehlt es doch auch sonst nicht an Spuren, die die griechische
Kunst vom Orient beeinflußt erscheinen lassen3). Was aber der harte Granit forderte,
gaben die Griechen dem sehr viel weicheren Marmor durch Jahrhunderte hindurch
in gewissenhafter Unterordnung unter eine sehr kluge und dem Material gerecht
werdende Tradition.
An dem archaischen Kopf in München Nr. 6 Taf. 7, 8, der fast fertig geworden
ist, lassen sich neben feiner Spitzmeißelarbeit noch die Spuren eines zweiten Werk-
zeugs erkennen. In den Haarpartien der rechten Kopfseite und in der linken Augen-
höhle finden sich mehrmals vier bis fünf kurze Rillen in einer Linie nebeneinander, sie
deuten auf die Arbeit mit einem Zahneisen hin. Dieses Werkzeug ist eigentlich nichts
anderes als ein vervielfachtes feines Spitzeisen, und seine Verwendung ist auch dieselbe.
Der Bildhauer der archaischen Zeit setzt es fast nur zu kurzen schrägen Hieben an. Die
Zahneisenarbeit folgt gewöhnlich auf den Spitzmeißel, um Unebenheiten zusammen-
zuziehen und zu glätten. Oft leistet sie auch nur eine Hilfe für das Auge des Stein-
■) Vergleiche die unvollendete Basaltstatue eines 2) Karo, Orient und Hellas in arch. Zeit, AM.
assyrischen Königs aus Assur, Reallexikon der 45, 1920, 106 ff. Poulsen, Der Orient und die
Vorgeschichte Bd. 7 Taf. 155. frühgriechische Kunst.
und drei Zentimeter Tiefe zerdrückt werden und ein mehlweißes Aussehn bekommen.
Das Material verliert dadurch seine Lichtdurchlässigkeit und. damit zugleich seine
natürliche Schönheit. Erreichen nun solche geprellten Stellen in ihrer Tiefe die
Oberfläche der fertigen Statue, so würden sie als weiße, häßliche Flecke erscheinen
und wären nicht mehr zu beseitigen. Damit rechnet der Bildhauer und geht lieber
etwas vorsichtiger zu Werke. Man darf die Geschicklichkeit, mit der eine Stein-
arbeit ausgeführt wurde, nicht nach der Größe der abgeschlagenen Stücke bemessen
wollen; mit den Anschauungen eines griechischen Bildhauers würde sich das jeden-
falls nicht vertragen, seine Tüchtigkeit liegt vielmehr in der zarten Rücksicht, die
er auf seinen Marmor nimmt, und in der handwerklichen Treue, die den Begriff der
Hast oder Zeitverschwendung nicht kennt.
Das einheitliche Aussehen über die ganze Oberfläche weg hat aber bei diesen
archaischen Arbeiten noch einen anderen Grund. Der Steinmetz arbeitet in der
Regel mit demselben Meißel eine ganze Schicht von der Statue herunter, ehe er mit
einem feineren Eisen an die nächste Schicht herangeht Taf. 5, 6. So kommt es nicht
vor, daß bei diesen Arbeiten einige Teile schon weit aus dem Stein herausgemeißelt
sind, während andere noch tief im Material stecken. Diese überaus wichtige Tat-
sache ist in erster Linie aus der Art zu erklären, wie der Bildhauer von den vier Haupt-
ansichten an seine Arbeit herangeht; auch spricht sich darin aus, wie stark diese
Künstler eine Statue auch schon in einem frühen Zustand als einen ganzen unteil-
baren Organismus empfinden.
Die gleichmäßig sorgfältige Spitzmeißelarbeit findet sich auch in Ägypten,
Babylonien und Assyrien*) an unfertigen Bildhauerarbeiten, soweit sie aus Granit
oder Basalt gemeißelt sind Taf. 2 b. Unter dem Zwang der sehr harten Gesteine, die
sich nur auf diese Art bewältigen lassen, mußte sich Spitzmeißelarbeit zur höchsten
Vollendung entwickeln. Es wäre wohl möglich, daß die Griechen hier ihre ersten
Lehrmeister fanden, fehlt es doch auch sonst nicht an Spuren, die die griechische
Kunst vom Orient beeinflußt erscheinen lassen3). Was aber der harte Granit forderte,
gaben die Griechen dem sehr viel weicheren Marmor durch Jahrhunderte hindurch
in gewissenhafter Unterordnung unter eine sehr kluge und dem Material gerecht
werdende Tradition.
An dem archaischen Kopf in München Nr. 6 Taf. 7, 8, der fast fertig geworden
ist, lassen sich neben feiner Spitzmeißelarbeit noch die Spuren eines zweiten Werk-
zeugs erkennen. In den Haarpartien der rechten Kopfseite und in der linken Augen-
höhle finden sich mehrmals vier bis fünf kurze Rillen in einer Linie nebeneinander, sie
deuten auf die Arbeit mit einem Zahneisen hin. Dieses Werkzeug ist eigentlich nichts
anderes als ein vervielfachtes feines Spitzeisen, und seine Verwendung ist auch dieselbe.
Der Bildhauer der archaischen Zeit setzt es fast nur zu kurzen schrägen Hieben an. Die
Zahneisenarbeit folgt gewöhnlich auf den Spitzmeißel, um Unebenheiten zusammen-
zuziehen und zu glätten. Oft leistet sie auch nur eine Hilfe für das Auge des Stein-
■) Vergleiche die unvollendete Basaltstatue eines 2) Karo, Orient und Hellas in arch. Zeit, AM.
assyrischen Königs aus Assur, Reallexikon der 45, 1920, 106 ff. Poulsen, Der Orient und die
Vorgeschichte Bd. 7 Taf. 155. frühgriechische Kunst.