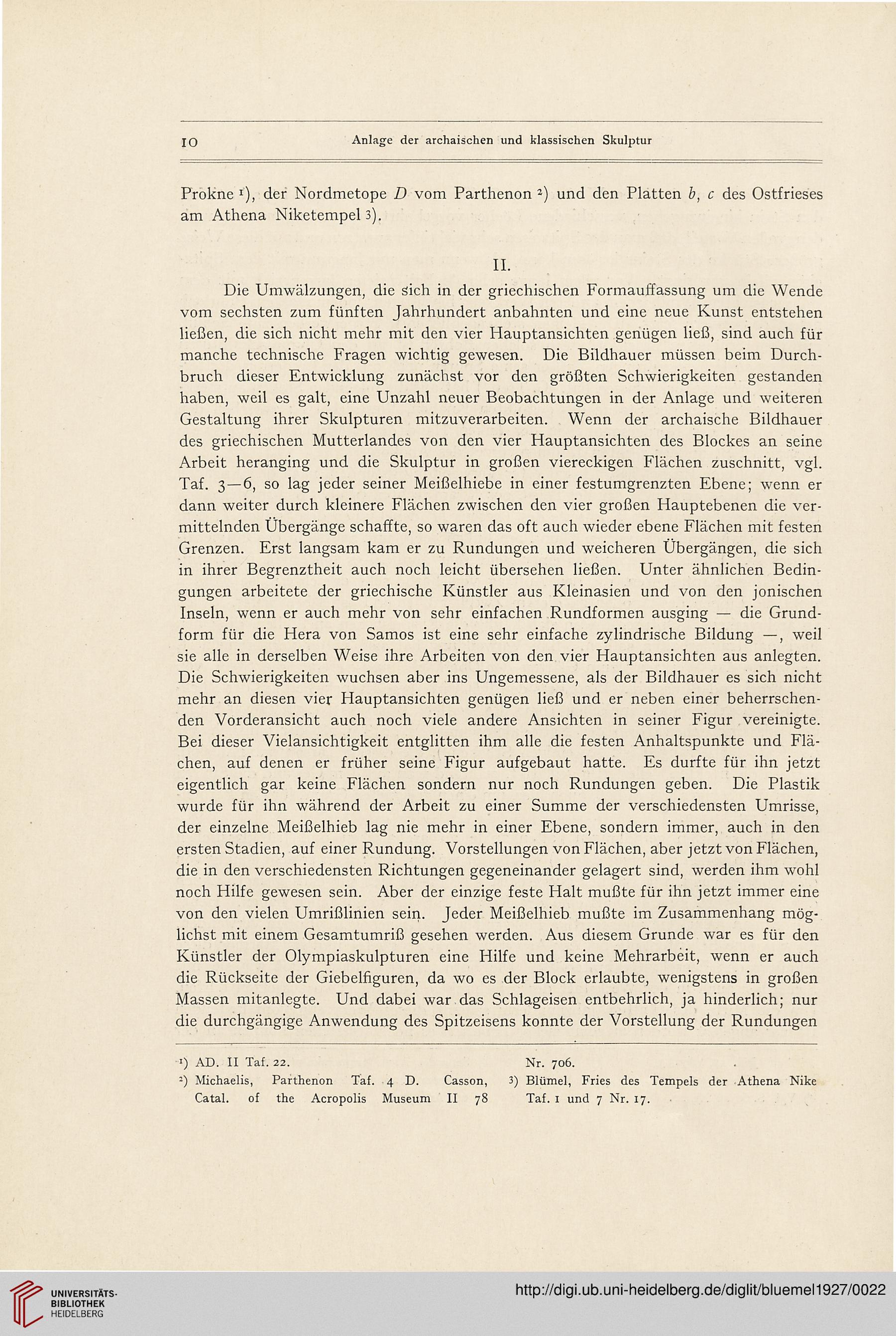IO
Anlage der archaischen und klassischen Skulptur
Prokne *), der Nordmetope D vom Parthenon * 2) und den Platten b, c des Ostfrieses
am Athena Niketempel 3).
II.
Die Umwälzungen, die sich in der griechischen Formauffassung um die Wende
vom sechsten zum fünften Jahrhundert anbahnten und eine neue Kunst entstehen
ließen, die sich nicht mehr mit den vier Hauptansichten genügen ließ, sind auch für
manche technische Fragen wichtig gewesen. Die Bildhauer müssen beim Durch-
bruch dieser Entwicklung zunächst vor den größten Schwierigkeiten gestanden
haben, weil es galt, eine Unzahl neuer Beobachtungen in der Anlage und weiteren
Gestaltung ihrer Skulpturen mitzuverarbeiten. Wenn der archaische Bildhauer
des griechischen Mutterlandes von den vier Hauptansichten des Blockes an seine
Arbeit heranging und die Skulptur in großen viereckigen Flächen Zuschnitt, vgl.
Taf. 3 — 6, so lag jeder seiner Meißelhiebe in einer festumgrenzten Ebene; wenn er
dann weiter durch kleinere Flächen zwischen den vier großen Hauptebenen die ver-
mittelnden Übergänge schaffte, so waren das oft auch wieder ebene Flächen mit festen
Grenzen. Erst langsam kam er zu Rundungen und weicheren Übergängen, die sich
in ihrer Begrenztheit auch noch leicht übersehen ließen. Unter ähnlichen Bedin-
gungen arbeitete der griechische Künstler aus Kleinasien und von den jonischen
Inseln, wenn er auch mehr von sehr einfachen Rundformen ausging — die Grund-
form für die Hera von Samos ist eine sehr einfache zylindrische Bildung —, weil
sie alle in derselben Weise ihre Arbeiten von den vier Hauptansichten aus anlegten.
Die Schwierigkeiten wuchsen aber ins Ungemessene, als der Bildhauer es sich nicht
mehr an diesen vier Plauptansichten genügen ließ und er neben einer beherrschen-
den Vorderansicht auch noch viele andere Ansichten in seiner Figur vereinigte.
Bei dieser Vielansichtigkeit entglitten ihm alle die festen Anhaltspunkte und Flä-
chen, auf denen er früher seine Figur aufgebaut hatte. Es durfte für ihn jetzt
eigentlich gar keine Flächen sondern nur noch Rundungen geben. Die Plastik
wurde für ihn während der Arbeit zu einer Summe der verschiedensten Umrisse,
der einzelne Meißelhieb lag nie mehr in einer Ebene, sondern immer, auch in den
ersten Stadien, auf einer Rundung. Vorstellungen von Flächen, aber jetzt von Flächen,
die in den verschiedensten Richtungen gegeneinander gelagert sind, werden ihm wohl
noch Hilfe gewesen sein. Aber der einzige feste Halt mußte für ihn jetzt immer eine
von den vielen Umrißlinien sein. Jeder Meißelhieb mußte im Zusammenhang mög-
lichst mit einem Gesamtumriß gesehen werden. Aus diesem Grunde war es für den
Künstler der Olympiaskulpturen eine Hilfe und keine Mehrarbeit, wenn er auch
die Rückseite der Giebelfiguren, da wo es der Block erlaubte, wenigstens in großen
Massen mitanlegte. Und dabei war.das Schlageisen entbehrlich, ja hinderlich; nur
die durchgängige Anwendung des Spitzeisens konnte der Vorstellung der Rundungen
x) AD. II Taf. 22. Nr. 706.
2) Michaelis, Parthenon Taf. 4 D. Casson, 3) Blümel, Fries des Tempels der Athena Nike
Catal. of the Acropolis Museum II 78 Taf. 1 und 7 Nr. 17.
Anlage der archaischen und klassischen Skulptur
Prokne *), der Nordmetope D vom Parthenon * 2) und den Platten b, c des Ostfrieses
am Athena Niketempel 3).
II.
Die Umwälzungen, die sich in der griechischen Formauffassung um die Wende
vom sechsten zum fünften Jahrhundert anbahnten und eine neue Kunst entstehen
ließen, die sich nicht mehr mit den vier Hauptansichten genügen ließ, sind auch für
manche technische Fragen wichtig gewesen. Die Bildhauer müssen beim Durch-
bruch dieser Entwicklung zunächst vor den größten Schwierigkeiten gestanden
haben, weil es galt, eine Unzahl neuer Beobachtungen in der Anlage und weiteren
Gestaltung ihrer Skulpturen mitzuverarbeiten. Wenn der archaische Bildhauer
des griechischen Mutterlandes von den vier Hauptansichten des Blockes an seine
Arbeit heranging und die Skulptur in großen viereckigen Flächen Zuschnitt, vgl.
Taf. 3 — 6, so lag jeder seiner Meißelhiebe in einer festumgrenzten Ebene; wenn er
dann weiter durch kleinere Flächen zwischen den vier großen Hauptebenen die ver-
mittelnden Übergänge schaffte, so waren das oft auch wieder ebene Flächen mit festen
Grenzen. Erst langsam kam er zu Rundungen und weicheren Übergängen, die sich
in ihrer Begrenztheit auch noch leicht übersehen ließen. Unter ähnlichen Bedin-
gungen arbeitete der griechische Künstler aus Kleinasien und von den jonischen
Inseln, wenn er auch mehr von sehr einfachen Rundformen ausging — die Grund-
form für die Hera von Samos ist eine sehr einfache zylindrische Bildung —, weil
sie alle in derselben Weise ihre Arbeiten von den vier Hauptansichten aus anlegten.
Die Schwierigkeiten wuchsen aber ins Ungemessene, als der Bildhauer es sich nicht
mehr an diesen vier Plauptansichten genügen ließ und er neben einer beherrschen-
den Vorderansicht auch noch viele andere Ansichten in seiner Figur vereinigte.
Bei dieser Vielansichtigkeit entglitten ihm alle die festen Anhaltspunkte und Flä-
chen, auf denen er früher seine Figur aufgebaut hatte. Es durfte für ihn jetzt
eigentlich gar keine Flächen sondern nur noch Rundungen geben. Die Plastik
wurde für ihn während der Arbeit zu einer Summe der verschiedensten Umrisse,
der einzelne Meißelhieb lag nie mehr in einer Ebene, sondern immer, auch in den
ersten Stadien, auf einer Rundung. Vorstellungen von Flächen, aber jetzt von Flächen,
die in den verschiedensten Richtungen gegeneinander gelagert sind, werden ihm wohl
noch Hilfe gewesen sein. Aber der einzige feste Halt mußte für ihn jetzt immer eine
von den vielen Umrißlinien sein. Jeder Meißelhieb mußte im Zusammenhang mög-
lichst mit einem Gesamtumriß gesehen werden. Aus diesem Grunde war es für den
Künstler der Olympiaskulpturen eine Hilfe und keine Mehrarbeit, wenn er auch
die Rückseite der Giebelfiguren, da wo es der Block erlaubte, wenigstens in großen
Massen mitanlegte. Und dabei war.das Schlageisen entbehrlich, ja hinderlich; nur
die durchgängige Anwendung des Spitzeisens konnte der Vorstellung der Rundungen
x) AD. II Taf. 22. Nr. 706.
2) Michaelis, Parthenon Taf. 4 D. Casson, 3) Blümel, Fries des Tempels der Athena Nike
Catal. of the Acropolis Museum II 78 Taf. 1 und 7 Nr. 17.