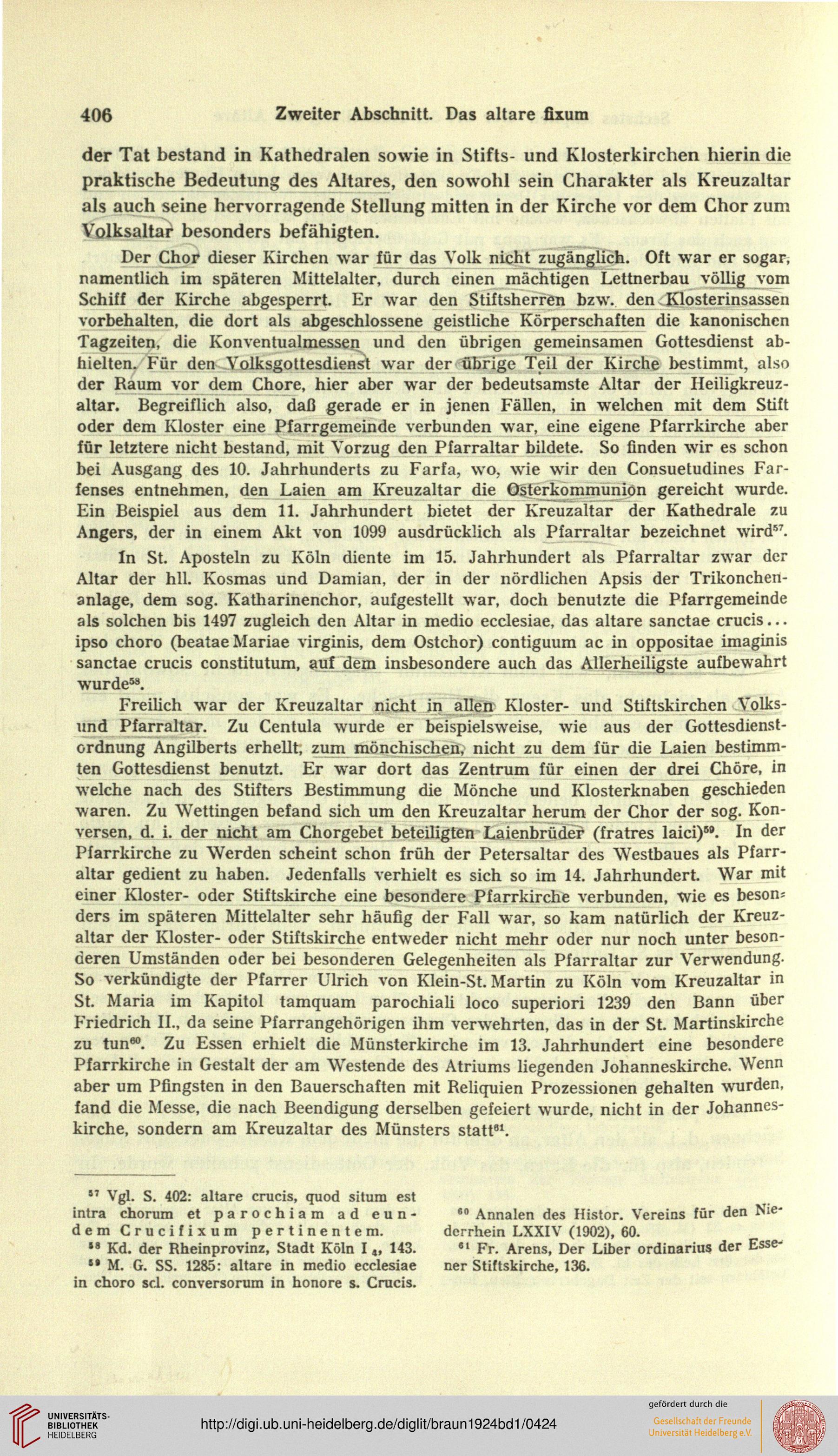406 Zweiter Abschnitt. Das altare fixum
der Tat bestand in Kathedralen sowie in Stifts- und Klosterkirchen hierin die
praktische Bedeutung des Altares, den sowohl sein Charakter als Kreuzaltar
als auch seine hervorragende Stellung mitten in der Kirche vor dem Chor zum
Volksaltar besonders befähigten.
Der Chor dieser Kirchen war für das Volk nicht zugänglich. Oft war er sogar,
namentlich im späteren Mittelalter, durch einen mächtigen Lettnerbau völlig vom
Schiff der Kirche abgesperrt. Er war den Stiftsherren bzw. den Klosterinsassen
vorbehalten, die dort als abgeschlossene geistliche Körperschaften die kanonischen
Tagzeiten, die Konventualmessen und den übrigen gemeinsamen Gottesdienst ab-
hielten. Für den Volksgottesdienst war der übrige Teil der Kirche bestimmt, also
der Raum vor dem Chore, hier aber war der bedeutsamste Altar der Heiligkreuz-
altar. Begreiflich also, daß gerade er in jenen Fällen, in welchen mit dem Stift
oder dem Kloster eine Pfarrgemeinde verbunden war, eine eigene Pfarrkirche aber
für letztere nicht bestand, mit Vorzug den Pfarraltar bildete. So finden wir es schon
bei Ausgang des 10. Jahrhunderts zu Farfa, wo, wie wir den Consuetudines Far-
fenses entnehmen, den Laien am Kreuzaltar die Osterkommunion gereicht wurde.
Ein Beispiel aus dem 11. Jahrhundert bietet der Kreuzaltar der Kathedrale zu
Angers, der in einem Akt von 1099 ausdrücklich als Pfarraltar bezeichnet wird57.
In St. Aposteln zu Köln diente im 15. Jahrhundert als Pfarraltar zwar der
Altar der hll. Kosmas und Damian, der in der nördlichen Apsis der Trikonchen-
anlage, dem sog. Katharinenchor, aufgestellt war, doch benutzte die Pfarrgemeinde
als solchen bis 1497 zugleich den Altar in medio ecclesiae, das altare sanctae crucis...
ipso choro (beatae Mariae virginis, dem Ostchor) contiguum ac in oppositae imaginis
sanctae crucis constitutum, auf dem insbesondere auch das Allerheiligste aufbewahrt
wurde58.
Freilich war der Kreuzaltar nicht in allen Kloster- und Stiftskirchen Volks-
und Pfarraltar. Zu Centula wurde er beispielsweise, wie aus der Gottesdienst-
ordnung Angilberts erhellt, zum mönchischen, nicht zu dem für die Laien bestimm-
ten Gottesdienst benutzt. Er war dort das Zentrum für einen der drei Chöre, in
welche nach des Stifters Bestimmung die Mönche und Klosterknaben geschieden
waren. Zu Wettingen befand sich um den Kreuzaltar herum der Chor der sog. Kon-
versen, d. i. der nicht am Chorgebet beteiligten Laienbrüder (fratres laici)6'. In der
Pfarrkirche zu Werden scheint schon früh der Petersaltar des Westbaues als Pfarr-
altar gedient zu haben. Jedenfalls verhielt es sich so im 14. Jahrhundert. War mit
einer Kloster- oder Stiftskirche eine besondere Pfarrkirche verbunden, wie es beson*
ders im späteren Mittelalter sehr häufig der Fall war, so kam natürlich der Kreuz-
altar der Kloster- oder Stiftskirche entweder nicht mehr oder nur noch unter beson-
deren Umständen oder bei besonderen Gelegenheiten als Pfarraltar zur Verwendung.
So verkündigte der Pfarrer Ulrich von Klein-St. Martin zu Köln vom Kreuzaltar in
St. Maria im Kapitol tamquam parochiali loco superiori 1239 den Bann über
Friedrich IL, da seine Pfarrangehörigen ihm verwehrten, das in der St. Martinskirche
zu tun60. Zu Essen erhielt die Münsterkirche im 13. Jahrhundert eine besondere
Pfarrkirche in Gestalt der am Westende des Atriums liegenden Johanneskirche. Wenn
aber um Pfingsten in den Bauerschaften mit Reliquien Prozessionen gehalten wurden,
fand die Messe, die nach Beendigung derselben gefeiert wurde, nicht in der Johannes-
kirche, sondern am Kreuzaltar des Münsters statt61.
" Vgl. S. 402: altare crucis, quod situra est
intra chorum et parochlam ad eun- 60 Annalen des Histor. Vereins für den Nie-
dem Crucifixum pertinentem. derrhein LXXIV (1902), 60.
18 Kd. der Rheinprovinz, Stadt Köln I „ 143. " Fr. Arens, Der Liber Ordinarius der Esse-
*• M. G. SS. 1285: altare in medio ecclesiae ner Stiftskirche, 136.
in choro sei. conversorum in honore s. Crucis.
der Tat bestand in Kathedralen sowie in Stifts- und Klosterkirchen hierin die
praktische Bedeutung des Altares, den sowohl sein Charakter als Kreuzaltar
als auch seine hervorragende Stellung mitten in der Kirche vor dem Chor zum
Volksaltar besonders befähigten.
Der Chor dieser Kirchen war für das Volk nicht zugänglich. Oft war er sogar,
namentlich im späteren Mittelalter, durch einen mächtigen Lettnerbau völlig vom
Schiff der Kirche abgesperrt. Er war den Stiftsherren bzw. den Klosterinsassen
vorbehalten, die dort als abgeschlossene geistliche Körperschaften die kanonischen
Tagzeiten, die Konventualmessen und den übrigen gemeinsamen Gottesdienst ab-
hielten. Für den Volksgottesdienst war der übrige Teil der Kirche bestimmt, also
der Raum vor dem Chore, hier aber war der bedeutsamste Altar der Heiligkreuz-
altar. Begreiflich also, daß gerade er in jenen Fällen, in welchen mit dem Stift
oder dem Kloster eine Pfarrgemeinde verbunden war, eine eigene Pfarrkirche aber
für letztere nicht bestand, mit Vorzug den Pfarraltar bildete. So finden wir es schon
bei Ausgang des 10. Jahrhunderts zu Farfa, wo, wie wir den Consuetudines Far-
fenses entnehmen, den Laien am Kreuzaltar die Osterkommunion gereicht wurde.
Ein Beispiel aus dem 11. Jahrhundert bietet der Kreuzaltar der Kathedrale zu
Angers, der in einem Akt von 1099 ausdrücklich als Pfarraltar bezeichnet wird57.
In St. Aposteln zu Köln diente im 15. Jahrhundert als Pfarraltar zwar der
Altar der hll. Kosmas und Damian, der in der nördlichen Apsis der Trikonchen-
anlage, dem sog. Katharinenchor, aufgestellt war, doch benutzte die Pfarrgemeinde
als solchen bis 1497 zugleich den Altar in medio ecclesiae, das altare sanctae crucis...
ipso choro (beatae Mariae virginis, dem Ostchor) contiguum ac in oppositae imaginis
sanctae crucis constitutum, auf dem insbesondere auch das Allerheiligste aufbewahrt
wurde58.
Freilich war der Kreuzaltar nicht in allen Kloster- und Stiftskirchen Volks-
und Pfarraltar. Zu Centula wurde er beispielsweise, wie aus der Gottesdienst-
ordnung Angilberts erhellt, zum mönchischen, nicht zu dem für die Laien bestimm-
ten Gottesdienst benutzt. Er war dort das Zentrum für einen der drei Chöre, in
welche nach des Stifters Bestimmung die Mönche und Klosterknaben geschieden
waren. Zu Wettingen befand sich um den Kreuzaltar herum der Chor der sog. Kon-
versen, d. i. der nicht am Chorgebet beteiligten Laienbrüder (fratres laici)6'. In der
Pfarrkirche zu Werden scheint schon früh der Petersaltar des Westbaues als Pfarr-
altar gedient zu haben. Jedenfalls verhielt es sich so im 14. Jahrhundert. War mit
einer Kloster- oder Stiftskirche eine besondere Pfarrkirche verbunden, wie es beson*
ders im späteren Mittelalter sehr häufig der Fall war, so kam natürlich der Kreuz-
altar der Kloster- oder Stiftskirche entweder nicht mehr oder nur noch unter beson-
deren Umständen oder bei besonderen Gelegenheiten als Pfarraltar zur Verwendung.
So verkündigte der Pfarrer Ulrich von Klein-St. Martin zu Köln vom Kreuzaltar in
St. Maria im Kapitol tamquam parochiali loco superiori 1239 den Bann über
Friedrich IL, da seine Pfarrangehörigen ihm verwehrten, das in der St. Martinskirche
zu tun60. Zu Essen erhielt die Münsterkirche im 13. Jahrhundert eine besondere
Pfarrkirche in Gestalt der am Westende des Atriums liegenden Johanneskirche. Wenn
aber um Pfingsten in den Bauerschaften mit Reliquien Prozessionen gehalten wurden,
fand die Messe, die nach Beendigung derselben gefeiert wurde, nicht in der Johannes-
kirche, sondern am Kreuzaltar des Münsters statt61.
" Vgl. S. 402: altare crucis, quod situra est
intra chorum et parochlam ad eun- 60 Annalen des Histor. Vereins für den Nie-
dem Crucifixum pertinentem. derrhein LXXIV (1902), 60.
18 Kd. der Rheinprovinz, Stadt Köln I „ 143. " Fr. Arens, Der Liber Ordinarius der Esse-
*• M. G. SS. 1285: altare in medio ecclesiae ner Stiftskirche, 136.
in choro sei. conversorum in honore s. Crucis.