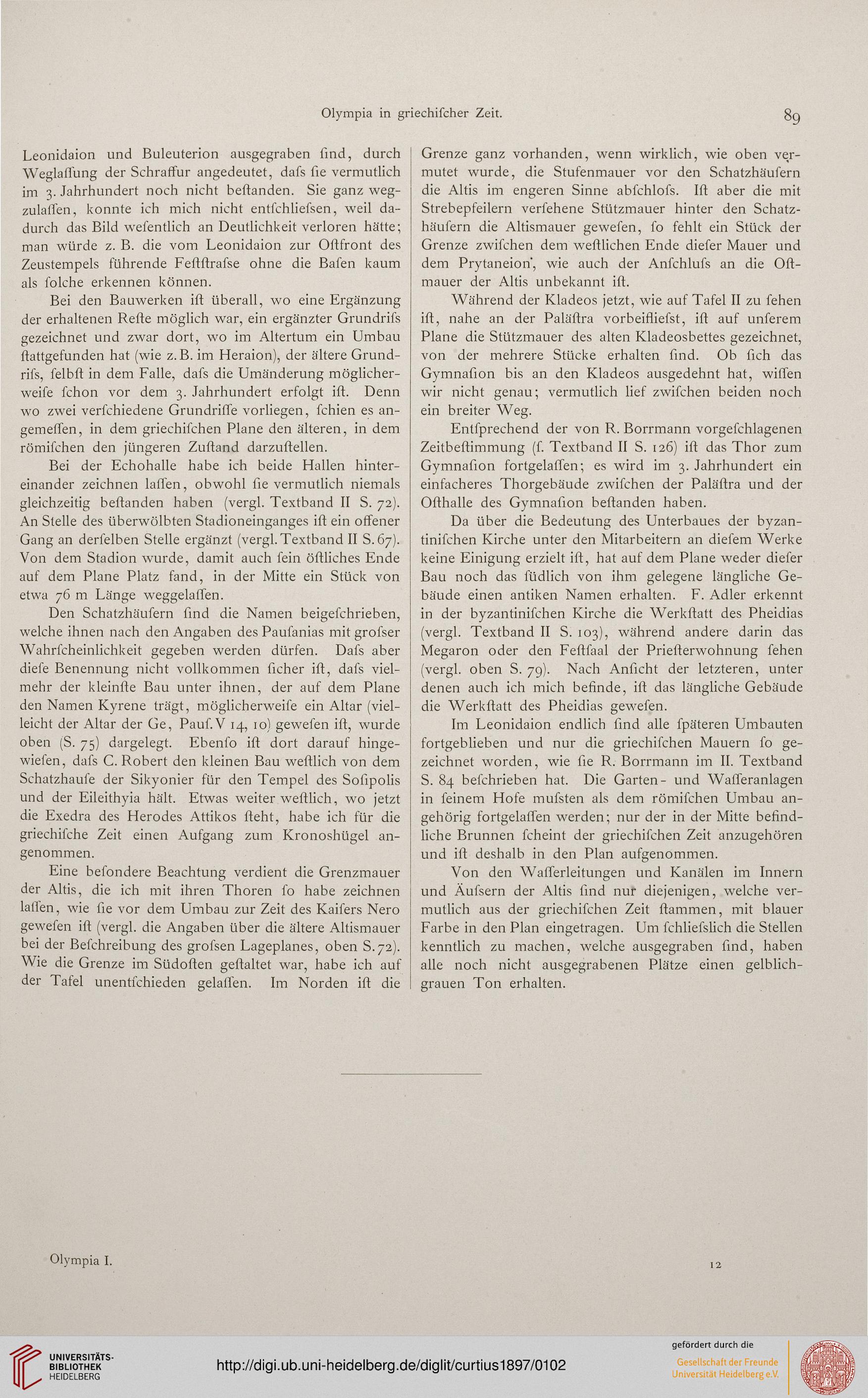Olympia in griechischer Zeit.
89
Leonidaion und Buleuterion ausgegraben sind, durch
Weglaslüng der Schraffur angedeutet, dass sie vermutlich
im 3. Jahrhundert noch nicht bestanden. Sie ganz weg-
zulassen, konnte ich mich nicht entschliessen, weil da-
durch das Bild wesentlich an Deutlichkeit verloren hätte;
man würde z. B. die vom Leonidaion zur Ostfront des
Zeustempels führende Feststrasse ohne die Basen kaum
als solche erkennen können.
Bei den Bauwerken ist überall, wo eine Ergänzung
der erhaltenen Rette möglich war, ein ergänzter Grundriss
gezeichnet und zwar dort, wo im Altertum ein Umbau
stattgefunden hat (wie z.B. im Heraion), der ältere Grund-
riss, selbst in dem Falle, dass die Umänderung möglicher-
weise schon vor dem 3. Jahrhundert erfolgt ist. Denn
wo zwei verschiedene Grundrisfe vorliegen, schien es an-
gemessen, in dem griechischen Plane den älteren, in dem
römischen den jüngeren Zustand darzustellen.
Bei der Echohalle habe ich beide Hallen hinter-
einander zeichnen lassen, obwohl sie vermutlich niemals
gleichzeitig bestanden haben (vergl. Textband II S. 72).
An Stelle des überwölbten Stadioneinganges ist ein osfener
Gang an derselben Stelle ergänzt (vergl. Textband II S.67).
Von dem Stadion wurde, damit auch sein östliches Ende
auf dem Plane Platz fand, in der Mitte ein Stück von
etwa 76 m Länge weggelassen.
Den Schatzhäusern sind die Namen beigeschrieben,
welche ihnen nach den Angaben des Pausanias mit grosser
Wahrscheinlichkeit gegeben werden dürfen. Dass aber
diese Benennung nicht vollkommen sicher ist, dass viel-
mehr der kleinste Bau unter ihnen, der auf dem Plane
den Namen Kyrene trägt, möglicherweise ein Altar (viel-
leicht der Altar der Ge, Paus.V 14, 10) gewesen ist, wurde
oben (S. 75) dargelegt. Ebenso ist dort darauf hinge-
wiesen, dass C. Robert den kleinen Bau weltlich von dem
Schatzhause der Sikyonier für den Tempel des Sosipolis
und der Eileithyia hält. Etwas weiter weltlich, wo jetzt
die Exedra des Herodes Attikos steht, habe ich für die
griechische Zeit einen Aufgang zum Kronoshügel an-
genommen.
Eine besondere Beachtung verdient die Grenzmauer
der Altis, die ich mit ihren Thoren so habe zeichnen
lallen, wie sie vor dem Umbau zur Zeit des Kaisers Nero
gewesen ist (vergl. die Angaben über die ältere Altismauer
bei der Beschreibung des grossen Lageplanes, oben S.72).
Wie die Grenze im Südosten gestaltet war, habe ich auf
der Tafel unentschieden gelalsen. Im Norden ist die
Grenze ganz vorhanden, wenn wirklich, wie oben ver-
mutet wurde, die Stufenmauer vor den Schatzhäusern
die Altis im engeren Sinne abschloss. Ist aber die mit
Strebepfeilern versehene Stützmauer hinter den Schatz-
häusern die Altismauer gewesen, so fehlt ein Stück der
Grenze zwischen dem weltlichen Ende dieser Mauer und
dem Prytaneion", wie auch der Anschluss an die Ost-
mauer der Altis unbekannt ist.
Während der Kladeos jetzt, wie auf Tafel II zu sehen
ist, nahe an der Palästra vorbeifliesst, ist auf unserem
Plane die Stützmauer des alten Kladeosbettes gezeichnet,
von der mehrere Stücke erhalten sind. Ob sich das
Gymnasion bis an den Kladeos ausgedehnt hat, wissen
wir nicht genau; vermutlich lief zwischen beiden noch
ein breiter Weg.
Entsprechend der von R. Borrmann vorgeschlagenen
Zeitbestimmung (s. Textband II S. 126) ist das Thor zum
Gymnasion fortgelalsen; es wird im 3. Jahrhundert ein
einfacheres Thorgebäude zwischen der Palästra und der
Osthalle des Gymnasion bestanden haben.
Da über die Bedeutung des Unterbaues der byzan-
tinischen Kirche unter den Mitarbeitern an diesem Werke
keine Einigung erzielt ist, hat auf dem Plane weder dieser
Bau noch das südlich von ihm gelegene längliche Ge-
bäude einen antiken Namen erhalten. F. Adler erkennt
in der byzantinischen Kirche die Werkltatt des Pheidias
(vergl. Textband II S. 103), während andere darin das
Megaron oder den Festsaal der Priesterwohnung sehen
(vergl. oben S. 79). Nach Ansicht der letzteren, unter
denen auch ich mich befinde, ist das längliche Gebäude
die Werkstatt des Pheidias gewesen.
Im Leonidaion endlich sind alle späteren Umbauten
fortgeblieben und nur die griechischen Mauern so ge-
zeichnet worden, wie sie R. Borrmann im II. Textband
S. 84 beschrieben hat. Die Garten- und Wasseranlagen
in seinem Hofe mussten als dem römischen Umbau an-
gehörig fortgelalsen werden; nur der in der Mitte befind-
liche Brunnen scheint der griechischen Zeit anzugehören
und ist deshalb in den Plan aufgenommen.
Von den WalTerleitungen und Kanälen im Innern
und Äussern der Altis sind nur diejenigen, welche ver-
mutlich aus der griechischen Zeit slammen, mit blauer
Farbe in den Plan eingetragen. Um schliesslich die Stellen
kenntlich zu machen, welche ausgegraben sind, haben
alle noch nicht ausgegrabenen Plätze einen gelblich-
grauen Ton erhalten.
Olympia I.
89
Leonidaion und Buleuterion ausgegraben sind, durch
Weglaslüng der Schraffur angedeutet, dass sie vermutlich
im 3. Jahrhundert noch nicht bestanden. Sie ganz weg-
zulassen, konnte ich mich nicht entschliessen, weil da-
durch das Bild wesentlich an Deutlichkeit verloren hätte;
man würde z. B. die vom Leonidaion zur Ostfront des
Zeustempels führende Feststrasse ohne die Basen kaum
als solche erkennen können.
Bei den Bauwerken ist überall, wo eine Ergänzung
der erhaltenen Rette möglich war, ein ergänzter Grundriss
gezeichnet und zwar dort, wo im Altertum ein Umbau
stattgefunden hat (wie z.B. im Heraion), der ältere Grund-
riss, selbst in dem Falle, dass die Umänderung möglicher-
weise schon vor dem 3. Jahrhundert erfolgt ist. Denn
wo zwei verschiedene Grundrisfe vorliegen, schien es an-
gemessen, in dem griechischen Plane den älteren, in dem
römischen den jüngeren Zustand darzustellen.
Bei der Echohalle habe ich beide Hallen hinter-
einander zeichnen lassen, obwohl sie vermutlich niemals
gleichzeitig bestanden haben (vergl. Textband II S. 72).
An Stelle des überwölbten Stadioneinganges ist ein osfener
Gang an derselben Stelle ergänzt (vergl. Textband II S.67).
Von dem Stadion wurde, damit auch sein östliches Ende
auf dem Plane Platz fand, in der Mitte ein Stück von
etwa 76 m Länge weggelassen.
Den Schatzhäusern sind die Namen beigeschrieben,
welche ihnen nach den Angaben des Pausanias mit grosser
Wahrscheinlichkeit gegeben werden dürfen. Dass aber
diese Benennung nicht vollkommen sicher ist, dass viel-
mehr der kleinste Bau unter ihnen, der auf dem Plane
den Namen Kyrene trägt, möglicherweise ein Altar (viel-
leicht der Altar der Ge, Paus.V 14, 10) gewesen ist, wurde
oben (S. 75) dargelegt. Ebenso ist dort darauf hinge-
wiesen, dass C. Robert den kleinen Bau weltlich von dem
Schatzhause der Sikyonier für den Tempel des Sosipolis
und der Eileithyia hält. Etwas weiter weltlich, wo jetzt
die Exedra des Herodes Attikos steht, habe ich für die
griechische Zeit einen Aufgang zum Kronoshügel an-
genommen.
Eine besondere Beachtung verdient die Grenzmauer
der Altis, die ich mit ihren Thoren so habe zeichnen
lallen, wie sie vor dem Umbau zur Zeit des Kaisers Nero
gewesen ist (vergl. die Angaben über die ältere Altismauer
bei der Beschreibung des grossen Lageplanes, oben S.72).
Wie die Grenze im Südosten gestaltet war, habe ich auf
der Tafel unentschieden gelalsen. Im Norden ist die
Grenze ganz vorhanden, wenn wirklich, wie oben ver-
mutet wurde, die Stufenmauer vor den Schatzhäusern
die Altis im engeren Sinne abschloss. Ist aber die mit
Strebepfeilern versehene Stützmauer hinter den Schatz-
häusern die Altismauer gewesen, so fehlt ein Stück der
Grenze zwischen dem weltlichen Ende dieser Mauer und
dem Prytaneion", wie auch der Anschluss an die Ost-
mauer der Altis unbekannt ist.
Während der Kladeos jetzt, wie auf Tafel II zu sehen
ist, nahe an der Palästra vorbeifliesst, ist auf unserem
Plane die Stützmauer des alten Kladeosbettes gezeichnet,
von der mehrere Stücke erhalten sind. Ob sich das
Gymnasion bis an den Kladeos ausgedehnt hat, wissen
wir nicht genau; vermutlich lief zwischen beiden noch
ein breiter Weg.
Entsprechend der von R. Borrmann vorgeschlagenen
Zeitbestimmung (s. Textband II S. 126) ist das Thor zum
Gymnasion fortgelalsen; es wird im 3. Jahrhundert ein
einfacheres Thorgebäude zwischen der Palästra und der
Osthalle des Gymnasion bestanden haben.
Da über die Bedeutung des Unterbaues der byzan-
tinischen Kirche unter den Mitarbeitern an diesem Werke
keine Einigung erzielt ist, hat auf dem Plane weder dieser
Bau noch das südlich von ihm gelegene längliche Ge-
bäude einen antiken Namen erhalten. F. Adler erkennt
in der byzantinischen Kirche die Werkltatt des Pheidias
(vergl. Textband II S. 103), während andere darin das
Megaron oder den Festsaal der Priesterwohnung sehen
(vergl. oben S. 79). Nach Ansicht der letzteren, unter
denen auch ich mich befinde, ist das längliche Gebäude
die Werkstatt des Pheidias gewesen.
Im Leonidaion endlich sind alle späteren Umbauten
fortgeblieben und nur die griechischen Mauern so ge-
zeichnet worden, wie sie R. Borrmann im II. Textband
S. 84 beschrieben hat. Die Garten- und Wasseranlagen
in seinem Hofe mussten als dem römischen Umbau an-
gehörig fortgelalsen werden; nur der in der Mitte befind-
liche Brunnen scheint der griechischen Zeit anzugehören
und ist deshalb in den Plan aufgenommen.
Von den WalTerleitungen und Kanälen im Innern
und Äussern der Altis sind nur diejenigen, welche ver-
mutlich aus der griechischen Zeit slammen, mit blauer
Farbe in den Plan eingetragen. Um schliesslich die Stellen
kenntlich zu machen, welche ausgegraben sind, haben
alle noch nicht ausgegrabenen Plätze einen gelblich-
grauen Ton erhalten.
Olympia I.