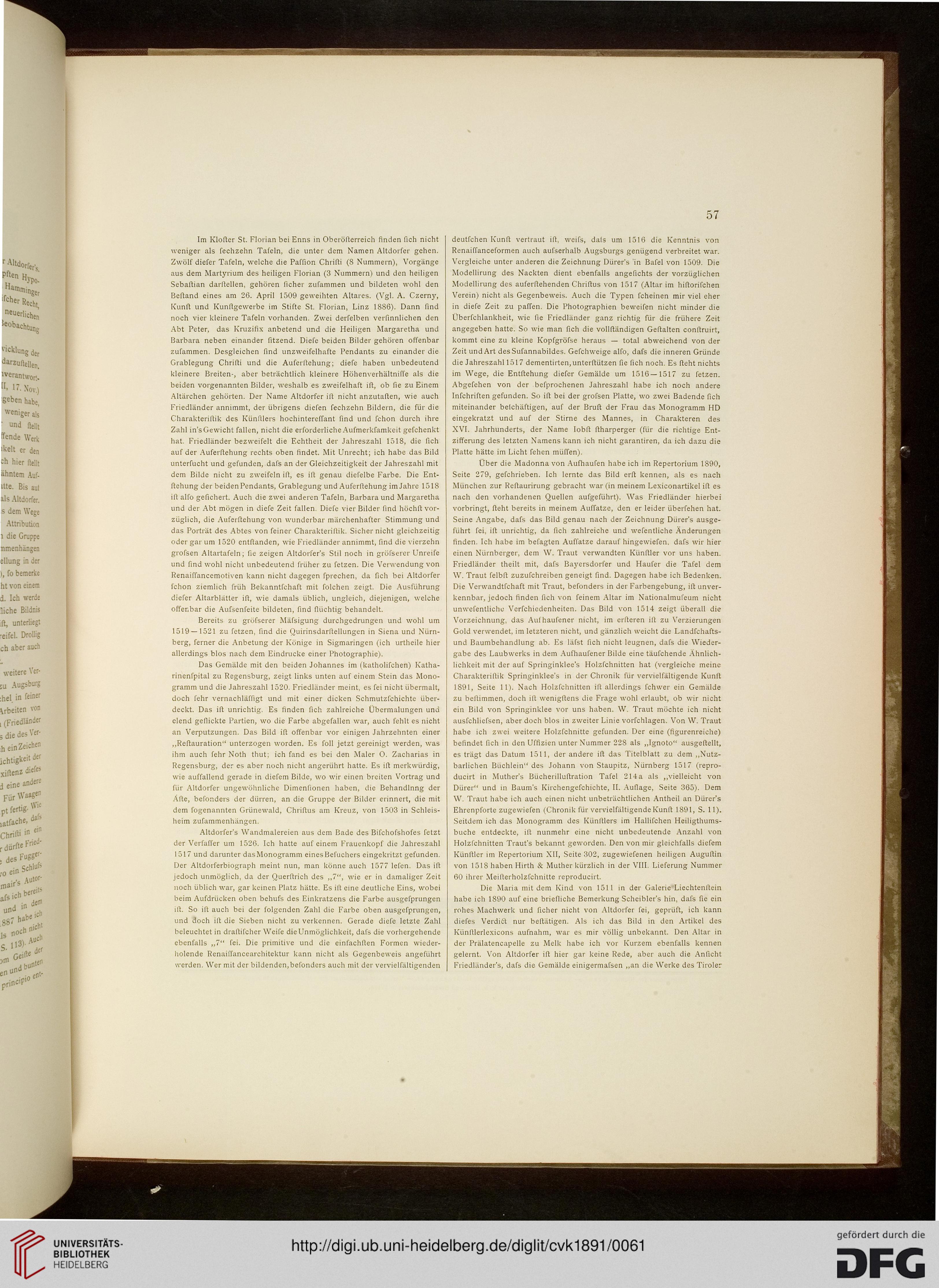57
*imnger
Im Kloster St. Florian bei Enns in Oberösterreich finden sich nicht
weniger als sechzehn Taseln, die unter dem Namen Altdorser gehen.
Zwölf dieser Tafeln, welche die Passion Christi (S Nummern), Vorgänge
aus dem Martyrium des heiligen Florian (3 Nummern) und den heiligen
Sebastian darsteilen, gehören sicher zusammen und bildeten wohl den
Bestand eines am 26. April 1509 geweihten Altares. (Vgl A. Czerny,
Kunst und Kunssgewerbe im Stiste St. Florian, Linz 1886). Dann sind
noch vier kleinere Tafeln vorhanden. Zwei derselben versinnücben den
Abt Peter, das Kruzifix anbetend und die Heiligen Margaretha und
Barbara neben einander sitzend. Diese beiden Bilder gehören osfenbar
zusammen. Desgleichen sind unzweiselhaste Pendants zu einander die
Grablegung Christi und die Auferstehung; diese haben unbedeutend
kleinere Breiten-, aber beträchtlich kleinere Höhenverhältnisse als die
beiden vorgenannten Bilder, weshalb es zweiselhast ist, ob sie zu Einem
Altärchen gehörten. Der Name Altdorfer ist nicht anzutasten, wie auch
Friedländer annimmt, der übrigens diesen sechzehn Bildern, die sür die
Charakteristik des Künsilers hochinteressant sind und schon durch ihre
Zahl in's Gewicht sallen, nicht die ersorderliche Aufmerksamkeit geschenkt
hat. Friedländer bezweifelt die Echtheit der Jahreszahl 1518, die sich
auf der Auserstehung rechts oben findet. Mit Unrecht; ich habe das Bild
untersucht und gefunden, dass an der Gleichzeitigkeit der Jahreszahl mit
dem Bilde nicht zu zweifeln ist, es ist genau dieselbe Farbe. Die Ent-
stehung der beiden Pendants, Grablegung und Auferstehung im Jahre 1518
ist also gesichert. Auch die zwei anderen Taseln, Barbara und Margaretha
und der Abt mögen in diese Zeit sallen. Diese vier Bilder sind höchst vor-
züglich, die Auferstehung von wunderbar märchenhafter Stimmung und
das Porträt des Abtes von feiner Charakteristik, Sicher nicht gleichzeitig
oder gar um 1520 entstanden, wie Friedländer annimmt, sind die vierzehn
grossen Altartaseln; sie zeigen Altdorser's Stil noch in grösserer Unreife
und sind wohl nicht unbedeutend früher zu setzen. Die Verwendung von
Renaissancemotiven kann nicht dagegen sprechen, da sich bei Altdorfer
schon ziemlich früh Bekanntschast mit solchen zeigt. Die Ausführung
dieser Altarblätter ist, wie damals üblich, ungleich, diejenigen, welche
ossenbar die Aussenseite bildeten, sind flüchtig behandelt.
Bereits zu grösserer Massigung durchgedrungen und wohl um
1519 — 1521 zu setzen, sind die Quirinsdarstellungen in Siena und Nürn-
berg, ferner die Anbetung der Könige in Sigmaringen (ich urtheile hier
allerdings blos nach dem Eindrucke einer Photographie).
Das Gemälde mit den beiden Johannes im (katholischen) Katba-
rinenspital zu Regensburg, zeigt links unten auf einem Stein das Mono-
gramm und die Jahreszahl 1520. Friedländer meint, es sei nicht übermalt,
doch sehr vernachlässigt und mit einer dicken Schmutzschichte über-
deckt. Das ist unrichtig. Es finden sich zahlreiche Übermalungen und
elend geslickte Partien, wo die Farbe abgefallen war, auch fehlt es nicht
an Verputzungen. Das Bild ist osfenbar vor einigen Jahrzehnten einer
„Restauration" unterzogen worden. Es soll jetzt gereinigt werden, was
ihm auch sehr Noth thut; ich sand es bei den Maler 0. Zacharias in
Regensburg, der es aber noch nicht angerührt hatte. Es ist merkwürdig,
wie ausfallend gerade in diesem Bilde, wo wir einen breiten Vortrag und
sür Altdorfer ungewöhnliche Dimensionen haben, die Behandlung der
Äste, besonders der dürren, an die Gruppe der Bilder erinnert, die mit
dem sogenannten Grünewald, Christus am Kreuz, von 1503 in Schleis-
heim zusammenhängen.
Altdorfer's Wandmalereien aus dem Bade des Bischofshofes setzt
der Verfasser um 1526. Ich hatte auf einem Frauenkopf die Jahreszahl
1517 und darunter dasMonogramm einesBesuchers eingekritzt gefunden.
Der Altdorserbiograph meint nun, man könne auch 1577 lesen. Das ist
jedoch unmöglich, da der Querstrich des „7", wie er in damaliger Zeit
noch üblich war, gar keinen Platz hätte. Es ist eine deutliche Eins, wobei
beim Aufdrücken oben behuss des Einkratzens die Farbe ausgesprungen
ist. So ist auch bei der solgenden Zahl die Farbe oben ausgesprungen,
und doch ist die Sieben nicht zu verkennen. Gerade diese letzte Zahl
beleuchtet in drastischer Weise die Unmöglichkeit, dass die vorhergehende
ebenfalls „7" sei. Die primitive und die einfachsten Formen wieder-
holende Renaissancearchitektur kann nicht als Gegenbeweis angeführt
werden. Wer mit der bildenden,besonders auch mit der vervielsältigenden
deutschen Kunst vertraut ist, weiss, dass um 1516 die Kenntnis von
Renaissancesormen auch ausserhalb Augsburgs genügend verbreitet war.
Vergleiche unter anderen die Zeichnung Dürer's "in Basel von 1509. Die
Modellirung des Nackten dient ebenfalls angesichts der vorzüglichen
Modellirung des auferstehenden Christus von 1517 (Altar im histonschen
Verein) nicht als Gegenbeweis. Auch die Typen scheinen mir viel eher
in diese Zeit zu passen. Die Photographien beweisen nicht minder die
Überschlankheit, wie sie Friedländer ganz richtig für die frühere Zeit
angegeben hatte. So wie man sich die vollstandigen Gestalten construirt,
kommt eine zu kleine KopsgrÖsse heraus — total abweichend von der
Zeit undArt desSusannabildes. Geschweige also, dass die inneren Gründe
die Jahreszahl 1517 dementirten,unterstützen sie sich noch. Es sleht nichts
im Wege, die Entstehung dieser Gemälde um 1516—1517 zu setzen.
Abgesehen von der besprochenen Jahreszahl habe ich noch andere
Inschristen gesunden. So ist bei der grossen Platte, wo zwei Badende sich
miteinander belcbäftigen, auf der Brust der Frau das Monogramm HD
eingekratzt und auf der Stirne des Mannes, in Charakteren des
XVI. Jahrhunderts, der Name lobst stharperger (für die richtige Ent-
zisferung des letzten Namens kann ich nicht garantiren, da ich dazu die
Platte hätte im Licht sehen mussen).
Über die Madonna von Aushäusen habe ich im Repertorium 1890,
Seite 279, geschrieben. Ich lernte das Bild erst kennen, als es nach
München zur Restaurirung gebracht war (in meinem Lesiconartikel ist es
nach den vorhandenen Quellen aufgeführt). Was Friedländer hierbei
vorbringt, steht bereits in meinem Aussatze, den er leider übersehen hat.
Seine Angabe, dass das Bild genau nach der Zeichnung Dürer's ausge-
führt sei, ist unrichtig, da sich zahlreiche und wesentliche Änderungen
finden. Ich habe im besagten Aufsatze darauf hingewiesen, dass wir hier
einen Nürnberger, dem W. Traut verwandten Künstler vor uns haben.
Friedländer theilt mit, dass Bayersdorfer und Hauser die Tasel dem
W. Traut selbst zuzuschreiben geneigt sind. Dagegen habe ich Bedenken.
Die Verwandtschaft mit Traut, besonders in der Farbengebung, ist unver-
kennbar, jedoch finden sich von seinem Altar im Nationalmuseum nicht
unwesentlichc Verschiedenheiten. Das Bild von 1514 zeigt überall die
Vorzeichnung, das Aul hausener nicht, im ersteren ist zu Verzierungen
Gold verwendet, im letzteren nicht, und gänzlich weicht die Landschafts-
und Baumbehandlung ab. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Wieder-
gabe des Laubwerks in dem Aufhausener Bilde eine täuschende Ähnlich-
hchkeit mit der auf Springinklee's Holzschnitten hat (vergleiche meine
Charakteristik Springinklee's in der Chronik sür vervielfältigende Kunst
1891, Seite 11). Nach Holzschnitten ist allerdings schwer ein Gemälde
zu bestimmen, doch ist wenigstens die Frage wohl erlaubt, ob wir nicht
ein Büd von Springinklee vor uns haben. W. Traut möchte ich nicht
ausschliessen, aber doch blos in zweiter Linie vorschlagen. Von W. Traut
habe ich zwei weitere Holzschnitte gefunden. Der eine (figurenreiche)
befindet sich in den Usfizien unter Nummer 228 als „Ignoto" ausgestellt,
es trägt das Datum 1511, der andere ist das Titelblatt zu dem „Nutz-
barlichen Büchlein" des Johann von Staupitz, Nürnberg 1517 (repro-
ducirt in Muther's Bücherillustration Tafel 214a als ,,vielleicht von
Dürer" und in Baum's Kirchengeschichte, IL Aullage, Seite 365). Dem
W. Traut habe ich auch einen nicht unbeträchtlichen Antheil an Dürer's
Ehrenpsorte zugewiesen (Chronik für vervielfältigende Kunst 1891, S. 11).
Seitdem ich das Monogramm des Künstters im Hallischen Heiligthums-
buche entdeckte, ist nunmehr eine nicht unbedeutende Anzahl von
Holzschnitten Traut's bekannt geworden. Den von mir gleichfalls diesem
Künstler im Repertorium XII, Seite 302, zugewiesenen heiligen Augustin
von 151S haben Hirth & Muther kürzlich in der VIII. Lieserung Nummer
60 ihrer Meisterholzschnitte reproducirt.
Die Maria mit dem Kind von 1511 in der Galerie Liechtenstein
habe ich 1890 auf eine briesliche Bemerkung Scheibler's hin, dass sie ein
rohes Machwerk und sicher nicht von Altdorfer sei, geprüst, ich kann
dieses Verdiit nur bestätigen. Als ich das Bild in den Artikel des
Künstlerlexicons aufnahm, war es mir völlig unbekannt. Den Altar in
der Prälatencapelle zu Melk habe ich vor Kurzem ebensalls kennen
gelernt. Von Altdorfer ist hier gar keine Rede, aber auch die Ansicht
Friedländer's, dass die Gemälde einigermassen „an die Werke des Tiroler
*imnger
Im Kloster St. Florian bei Enns in Oberösterreich finden sich nicht
weniger als sechzehn Taseln, die unter dem Namen Altdorser gehen.
Zwölf dieser Tafeln, welche die Passion Christi (S Nummern), Vorgänge
aus dem Martyrium des heiligen Florian (3 Nummern) und den heiligen
Sebastian darsteilen, gehören sicher zusammen und bildeten wohl den
Bestand eines am 26. April 1509 geweihten Altares. (Vgl A. Czerny,
Kunst und Kunssgewerbe im Stiste St. Florian, Linz 1886). Dann sind
noch vier kleinere Tafeln vorhanden. Zwei derselben versinnücben den
Abt Peter, das Kruzifix anbetend und die Heiligen Margaretha und
Barbara neben einander sitzend. Diese beiden Bilder gehören osfenbar
zusammen. Desgleichen sind unzweiselhaste Pendants zu einander die
Grablegung Christi und die Auferstehung; diese haben unbedeutend
kleinere Breiten-, aber beträchtlich kleinere Höhenverhältnisse als die
beiden vorgenannten Bilder, weshalb es zweiselhast ist, ob sie zu Einem
Altärchen gehörten. Der Name Altdorfer ist nicht anzutasten, wie auch
Friedländer annimmt, der übrigens diesen sechzehn Bildern, die sür die
Charakteristik des Künsilers hochinteressant sind und schon durch ihre
Zahl in's Gewicht sallen, nicht die ersorderliche Aufmerksamkeit geschenkt
hat. Friedländer bezweifelt die Echtheit der Jahreszahl 1518, die sich
auf der Auserstehung rechts oben findet. Mit Unrecht; ich habe das Bild
untersucht und gefunden, dass an der Gleichzeitigkeit der Jahreszahl mit
dem Bilde nicht zu zweifeln ist, es ist genau dieselbe Farbe. Die Ent-
stehung der beiden Pendants, Grablegung und Auferstehung im Jahre 1518
ist also gesichert. Auch die zwei anderen Taseln, Barbara und Margaretha
und der Abt mögen in diese Zeit sallen. Diese vier Bilder sind höchst vor-
züglich, die Auferstehung von wunderbar märchenhafter Stimmung und
das Porträt des Abtes von feiner Charakteristik, Sicher nicht gleichzeitig
oder gar um 1520 entstanden, wie Friedländer annimmt, sind die vierzehn
grossen Altartaseln; sie zeigen Altdorser's Stil noch in grösserer Unreife
und sind wohl nicht unbedeutend früher zu setzen. Die Verwendung von
Renaissancemotiven kann nicht dagegen sprechen, da sich bei Altdorfer
schon ziemlich früh Bekanntschast mit solchen zeigt. Die Ausführung
dieser Altarblätter ist, wie damals üblich, ungleich, diejenigen, welche
ossenbar die Aussenseite bildeten, sind flüchtig behandelt.
Bereits zu grösserer Massigung durchgedrungen und wohl um
1519 — 1521 zu setzen, sind die Quirinsdarstellungen in Siena und Nürn-
berg, ferner die Anbetung der Könige in Sigmaringen (ich urtheile hier
allerdings blos nach dem Eindrucke einer Photographie).
Das Gemälde mit den beiden Johannes im (katholischen) Katba-
rinenspital zu Regensburg, zeigt links unten auf einem Stein das Mono-
gramm und die Jahreszahl 1520. Friedländer meint, es sei nicht übermalt,
doch sehr vernachlässigt und mit einer dicken Schmutzschichte über-
deckt. Das ist unrichtig. Es finden sich zahlreiche Übermalungen und
elend geslickte Partien, wo die Farbe abgefallen war, auch fehlt es nicht
an Verputzungen. Das Bild ist osfenbar vor einigen Jahrzehnten einer
„Restauration" unterzogen worden. Es soll jetzt gereinigt werden, was
ihm auch sehr Noth thut; ich sand es bei den Maler 0. Zacharias in
Regensburg, der es aber noch nicht angerührt hatte. Es ist merkwürdig,
wie ausfallend gerade in diesem Bilde, wo wir einen breiten Vortrag und
sür Altdorfer ungewöhnliche Dimensionen haben, die Behandlung der
Äste, besonders der dürren, an die Gruppe der Bilder erinnert, die mit
dem sogenannten Grünewald, Christus am Kreuz, von 1503 in Schleis-
heim zusammenhängen.
Altdorfer's Wandmalereien aus dem Bade des Bischofshofes setzt
der Verfasser um 1526. Ich hatte auf einem Frauenkopf die Jahreszahl
1517 und darunter dasMonogramm einesBesuchers eingekritzt gefunden.
Der Altdorserbiograph meint nun, man könne auch 1577 lesen. Das ist
jedoch unmöglich, da der Querstrich des „7", wie er in damaliger Zeit
noch üblich war, gar keinen Platz hätte. Es ist eine deutliche Eins, wobei
beim Aufdrücken oben behuss des Einkratzens die Farbe ausgesprungen
ist. So ist auch bei der solgenden Zahl die Farbe oben ausgesprungen,
und doch ist die Sieben nicht zu verkennen. Gerade diese letzte Zahl
beleuchtet in drastischer Weise die Unmöglichkeit, dass die vorhergehende
ebenfalls „7" sei. Die primitive und die einfachsten Formen wieder-
holende Renaissancearchitektur kann nicht als Gegenbeweis angeführt
werden. Wer mit der bildenden,besonders auch mit der vervielsältigenden
deutschen Kunst vertraut ist, weiss, dass um 1516 die Kenntnis von
Renaissancesormen auch ausserhalb Augsburgs genügend verbreitet war.
Vergleiche unter anderen die Zeichnung Dürer's "in Basel von 1509. Die
Modellirung des Nackten dient ebenfalls angesichts der vorzüglichen
Modellirung des auferstehenden Christus von 1517 (Altar im histonschen
Verein) nicht als Gegenbeweis. Auch die Typen scheinen mir viel eher
in diese Zeit zu passen. Die Photographien beweisen nicht minder die
Überschlankheit, wie sie Friedländer ganz richtig für die frühere Zeit
angegeben hatte. So wie man sich die vollstandigen Gestalten construirt,
kommt eine zu kleine KopsgrÖsse heraus — total abweichend von der
Zeit undArt desSusannabildes. Geschweige also, dass die inneren Gründe
die Jahreszahl 1517 dementirten,unterstützen sie sich noch. Es sleht nichts
im Wege, die Entstehung dieser Gemälde um 1516—1517 zu setzen.
Abgesehen von der besprochenen Jahreszahl habe ich noch andere
Inschristen gesunden. So ist bei der grossen Platte, wo zwei Badende sich
miteinander belcbäftigen, auf der Brust der Frau das Monogramm HD
eingekratzt und auf der Stirne des Mannes, in Charakteren des
XVI. Jahrhunderts, der Name lobst stharperger (für die richtige Ent-
zisferung des letzten Namens kann ich nicht garantiren, da ich dazu die
Platte hätte im Licht sehen mussen).
Über die Madonna von Aushäusen habe ich im Repertorium 1890,
Seite 279, geschrieben. Ich lernte das Bild erst kennen, als es nach
München zur Restaurirung gebracht war (in meinem Lesiconartikel ist es
nach den vorhandenen Quellen aufgeführt). Was Friedländer hierbei
vorbringt, steht bereits in meinem Aussatze, den er leider übersehen hat.
Seine Angabe, dass das Bild genau nach der Zeichnung Dürer's ausge-
führt sei, ist unrichtig, da sich zahlreiche und wesentliche Änderungen
finden. Ich habe im besagten Aufsatze darauf hingewiesen, dass wir hier
einen Nürnberger, dem W. Traut verwandten Künstler vor uns haben.
Friedländer theilt mit, dass Bayersdorfer und Hauser die Tasel dem
W. Traut selbst zuzuschreiben geneigt sind. Dagegen habe ich Bedenken.
Die Verwandtschaft mit Traut, besonders in der Farbengebung, ist unver-
kennbar, jedoch finden sich von seinem Altar im Nationalmuseum nicht
unwesentlichc Verschiedenheiten. Das Bild von 1514 zeigt überall die
Vorzeichnung, das Aul hausener nicht, im ersteren ist zu Verzierungen
Gold verwendet, im letzteren nicht, und gänzlich weicht die Landschafts-
und Baumbehandlung ab. Es lässt sich nicht leugnen, dass die Wieder-
gabe des Laubwerks in dem Aufhausener Bilde eine täuschende Ähnlich-
hchkeit mit der auf Springinklee's Holzschnitten hat (vergleiche meine
Charakteristik Springinklee's in der Chronik sür vervielfältigende Kunst
1891, Seite 11). Nach Holzschnitten ist allerdings schwer ein Gemälde
zu bestimmen, doch ist wenigstens die Frage wohl erlaubt, ob wir nicht
ein Büd von Springinklee vor uns haben. W. Traut möchte ich nicht
ausschliessen, aber doch blos in zweiter Linie vorschlagen. Von W. Traut
habe ich zwei weitere Holzschnitte gefunden. Der eine (figurenreiche)
befindet sich in den Usfizien unter Nummer 228 als „Ignoto" ausgestellt,
es trägt das Datum 1511, der andere ist das Titelblatt zu dem „Nutz-
barlichen Büchlein" des Johann von Staupitz, Nürnberg 1517 (repro-
ducirt in Muther's Bücherillustration Tafel 214a als ,,vielleicht von
Dürer" und in Baum's Kirchengeschichte, IL Aullage, Seite 365). Dem
W. Traut habe ich auch einen nicht unbeträchtlichen Antheil an Dürer's
Ehrenpsorte zugewiesen (Chronik für vervielfältigende Kunst 1891, S. 11).
Seitdem ich das Monogramm des Künstters im Hallischen Heiligthums-
buche entdeckte, ist nunmehr eine nicht unbedeutende Anzahl von
Holzschnitten Traut's bekannt geworden. Den von mir gleichfalls diesem
Künstler im Repertorium XII, Seite 302, zugewiesenen heiligen Augustin
von 151S haben Hirth & Muther kürzlich in der VIII. Lieserung Nummer
60 ihrer Meisterholzschnitte reproducirt.
Die Maria mit dem Kind von 1511 in der Galerie Liechtenstein
habe ich 1890 auf eine briesliche Bemerkung Scheibler's hin, dass sie ein
rohes Machwerk und sicher nicht von Altdorfer sei, geprüst, ich kann
dieses Verdiit nur bestätigen. Als ich das Bild in den Artikel des
Künstlerlexicons aufnahm, war es mir völlig unbekannt. Den Altar in
der Prälatencapelle zu Melk habe ich vor Kurzem ebensalls kennen
gelernt. Von Altdorfer ist hier gar keine Rede, aber auch die Ansicht
Friedländer's, dass die Gemälde einigermassen „an die Werke des Tiroler