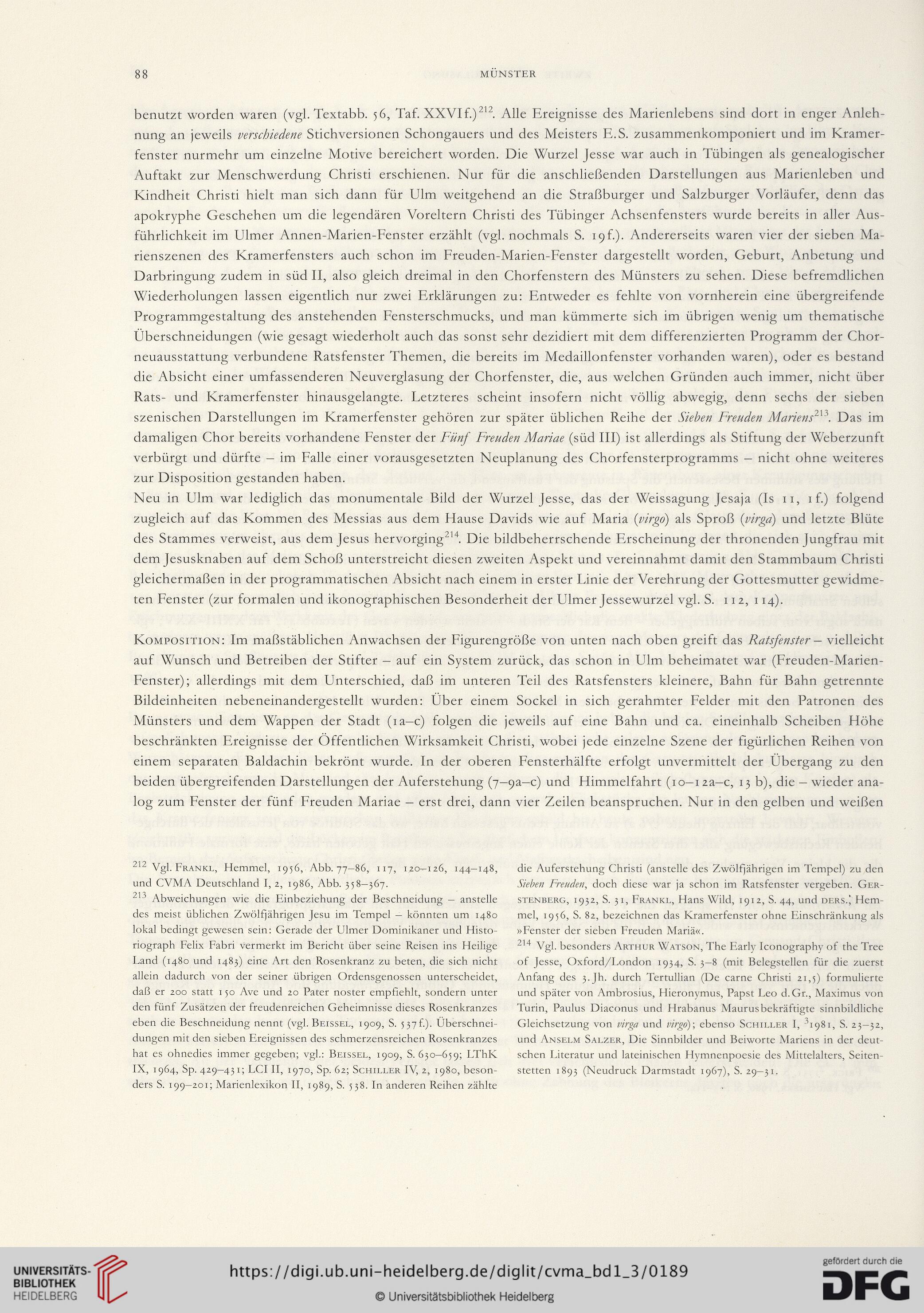88
MÜNSTER
benutzt worden waren (vgl. Textabb. 56, Taf. XXVI f.)212 Alle Ereignisse des Marienlebens sind dort in enger Anleh-
nung an jeweils verschiedene Stichversionen Schongauers und des Meisters E.S. zusammenkomponiert und im Kramer-
fenster nurmehr um einzelne Motive bereichert worden. Die Wurzel Jesse war auch in Tübingen als genealogischer
Auftakt zur Menschwerdung Christi erschienen. Nur für die anschließenden Darstellungen aus Marienleben und
Kindheit Christi hielt man sich dann für Ulm weitgehend an die Straßburger und Salzburger Vorläufer, denn das
apokryphe Geschehen um die legendären Voreltern Christi des Tübinger Achsenfensters wurde bereits in aller Aus-
führlichkeit im Ulmer Annen-Marien-Fenster erzählt (vgl. nochmals S. 19h). Andererseits waren vier der sieben Ma-
rienszenen des Kramerfensters auch schon im Freuden-Marien-Fenster dargestellt worden, Geburt, Anbetung und
Darbringung zudem in süd II, also gleich dreimal in den Chorfenstern des Münsters zu sehen. Diese befremdlichen
Wiederholungen lassen eigentlich nur zwei Erklärungen zu: Entweder es fehlte von vornherein eine übergreifende
Programmgestaltung des anstehenden Fensterschmucks, und man kümmerte sich im übrigen wenig um thematische
Überschneidungen (wie gesagt wiederholt auch das sonst sehr dezidiert mit dem differenzierten Programm der Chor-
neuausstattung verbundene Ratsfenster Themen, die bereits im Medaillonfenster vorhanden waren), oder es bestand
die Absicht einer umfassenderen Neuverglasung der Chorfenster, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht über
Rats- und Kramerfenster hinausgelangte. Letzteres scheint insofern nicht völlig abwegig, denn sechs der sieben
szenischen Darstellungen im Kramerfenster gehören zur später üblichen Reihe der Sieben Freuden Mariens1^ ’. Das im
damaligen Chor bereits vorhandene Fenster der Fünf Freuden Mariae (süd III) ist allerdings als Stiftung der Weberzunft
verbürgt und dürfte — im Falle einer vorausgesetzten Neuplanung des Chorfensterprogramms — nicht ohne weiteres
zur Disposition gestanden haben.
Neu in Ulm war lediglich das monumentale Bild der Wurzel Jesse, das der Weissagung Jesaja (Is 11, 1 f.) folgend
zugleich auf das Kommen des Messias aus dem Hause Davids wie auf Maria (yirgo) als Sproß {virgd) und letzte Blüte
des Stammes verweist, aus dem Jesus hervorging214. Die bildbeherrschende Erscheinung der thronenden Jungfrau mit
dem Jesusknaben auf dem Schoß unterstreicht diesen zweiten Aspekt und vereinnahmt damit den Stammbaum Christi
gleichermaßen in der programmatischen Absicht nach einem in erster Linie der Verehrung der Gottesmutter gewidme-
ten Fenster (zur formalen und ikonographischen Besonderheit der Ulmer Jessewurzel vgl. S. 112,114).
Komposition: Im maßstäblichen Anwachsen der Figurengröße von unten nach oben greift das Ratsfenster — vielleicht
auf Wunsch und Betreiben der Stifter — auf ein System zurück, das schon in Ulm beheimatet war (Freuden-Marien-
Fenster); allerdings mit dem Unterschied, daß im unteren Teil des Ratsfensters kleinere, Bahn für Bahn getrennte
Bildeinheiten nebeneinandergestellt wurden: Über einem Sockel in sich gerahmter Felder mit den Patronen des
Münsters und dem Wappen der Stadt (1a—c) folgen die jeweils auf eine Bahn und ca. eineinhalb Scheiben Höhe
beschränkten Ereignisse der Öffentlichen Wirksamkeit Christi, wobei jede einzelne Szene der figürlichen Reihen von
einem separaten Baldachin bekrönt wurde. In der oberen Fensterhälfte erfolgt unvermittelt der Übergang zu den
beiden übergreifenden Darstellungen der Auferstehung (7—9a—c) und Himmelfahrt (10—12a—c, 13 b), die — wieder ana-
log zum Fenster der fünf Freuden Mariae — erst drei, dann vier Zeilen beanspruchen. Nur in den gelben und weißen
212 Vgl. Frankl, Hemmel, 1956, Abb. 77—86, 117, 120—126, 144—148,
und CVMA Deutschland I, 2, 1986, Abb. 358—367.
213 Abweichungen wie die Einbeziehung der Beschneidung — anstelle
des meist üblichen Zwölfjährigen Jesu im Tempel — könnten um 1480
lokal bedingt gewesen sein: Gerade der Ulmer Dominikaner und Histo-
riograph Felix Fabri vermerkt im Bericht über seine Reisen ins Heilige
Land (1480 und 1483) eine Art den Rosenkranz zu beten, die sich nicht
allein dadurch von der seiner übrigen Ordensgenossen unterscheidet,
daß er 200 statt 150 Ave und 20 Pater noster empfiehlt, sondern unter
den fünf Zusätzen der freudenreichen Geheimnisse dieses Rosenkranzes
eben die Beschneidung nennt (vgl. Beissel, 1909, S. 5 37 £.). Überschnei-
dungen mit den sieben Ereignissen des schmerzensreichen Rosenkranzes
hat es ohnedies immer gegeben; vgl.: Beissel, 1909, S. 630-659; LThK
IX, 1964, Sp. 429—431; LCIII, 1970, Sp. 62; Schiller IV, 2, 1980, beson-
ders S. 199-201; Marienlexikon II, 1989, S. 538. In anderen Reihen zählte
die Auferstehung Christi (anstelle des Zwölfjährigen im Tempel) zu den
Sieben Freuden, doch diese war ja schon im Ratsfenster vergeben. Ger-
stenberg, 1932, S. 31, Frankl, Hans Wild, 1912, S. 44, und dersJ Hem-
mel, 1956, S. 82, bezeichnen das Kramerfenster ohne Einschränkung als
»Fenster der sieben Freuden Mariä«.
214 Vgl. besonders Arthur Watson, The Early Iconography of the Tree
of Jesse, Oxford/London 1934, S. 3—8 (mit Belegstellen für die zuerst
Anfang des 3. Jh. durch Tertullian (De carne Christi 21,5) formulierte
und später von Ambrosius, Hieronymus, Papst Leo d. Gr., Maximus von
Turin, Paulus Diaconus und Hrabanus Maurus bekräftigte sinnbildliche
Gleichsetzung von virga und virgd)', ebenso Schiller I, L981, S. 23—32,
und Anselm Salzer, Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deut-
schen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters, Seiten-
stetten 1893 (Neudruck Darmstadt 1967), S. 29—31.
MÜNSTER
benutzt worden waren (vgl. Textabb. 56, Taf. XXVI f.)212 Alle Ereignisse des Marienlebens sind dort in enger Anleh-
nung an jeweils verschiedene Stichversionen Schongauers und des Meisters E.S. zusammenkomponiert und im Kramer-
fenster nurmehr um einzelne Motive bereichert worden. Die Wurzel Jesse war auch in Tübingen als genealogischer
Auftakt zur Menschwerdung Christi erschienen. Nur für die anschließenden Darstellungen aus Marienleben und
Kindheit Christi hielt man sich dann für Ulm weitgehend an die Straßburger und Salzburger Vorläufer, denn das
apokryphe Geschehen um die legendären Voreltern Christi des Tübinger Achsenfensters wurde bereits in aller Aus-
führlichkeit im Ulmer Annen-Marien-Fenster erzählt (vgl. nochmals S. 19h). Andererseits waren vier der sieben Ma-
rienszenen des Kramerfensters auch schon im Freuden-Marien-Fenster dargestellt worden, Geburt, Anbetung und
Darbringung zudem in süd II, also gleich dreimal in den Chorfenstern des Münsters zu sehen. Diese befremdlichen
Wiederholungen lassen eigentlich nur zwei Erklärungen zu: Entweder es fehlte von vornherein eine übergreifende
Programmgestaltung des anstehenden Fensterschmucks, und man kümmerte sich im übrigen wenig um thematische
Überschneidungen (wie gesagt wiederholt auch das sonst sehr dezidiert mit dem differenzierten Programm der Chor-
neuausstattung verbundene Ratsfenster Themen, die bereits im Medaillonfenster vorhanden waren), oder es bestand
die Absicht einer umfassenderen Neuverglasung der Chorfenster, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht über
Rats- und Kramerfenster hinausgelangte. Letzteres scheint insofern nicht völlig abwegig, denn sechs der sieben
szenischen Darstellungen im Kramerfenster gehören zur später üblichen Reihe der Sieben Freuden Mariens1^ ’. Das im
damaligen Chor bereits vorhandene Fenster der Fünf Freuden Mariae (süd III) ist allerdings als Stiftung der Weberzunft
verbürgt und dürfte — im Falle einer vorausgesetzten Neuplanung des Chorfensterprogramms — nicht ohne weiteres
zur Disposition gestanden haben.
Neu in Ulm war lediglich das monumentale Bild der Wurzel Jesse, das der Weissagung Jesaja (Is 11, 1 f.) folgend
zugleich auf das Kommen des Messias aus dem Hause Davids wie auf Maria (yirgo) als Sproß {virgd) und letzte Blüte
des Stammes verweist, aus dem Jesus hervorging214. Die bildbeherrschende Erscheinung der thronenden Jungfrau mit
dem Jesusknaben auf dem Schoß unterstreicht diesen zweiten Aspekt und vereinnahmt damit den Stammbaum Christi
gleichermaßen in der programmatischen Absicht nach einem in erster Linie der Verehrung der Gottesmutter gewidme-
ten Fenster (zur formalen und ikonographischen Besonderheit der Ulmer Jessewurzel vgl. S. 112,114).
Komposition: Im maßstäblichen Anwachsen der Figurengröße von unten nach oben greift das Ratsfenster — vielleicht
auf Wunsch und Betreiben der Stifter — auf ein System zurück, das schon in Ulm beheimatet war (Freuden-Marien-
Fenster); allerdings mit dem Unterschied, daß im unteren Teil des Ratsfensters kleinere, Bahn für Bahn getrennte
Bildeinheiten nebeneinandergestellt wurden: Über einem Sockel in sich gerahmter Felder mit den Patronen des
Münsters und dem Wappen der Stadt (1a—c) folgen die jeweils auf eine Bahn und ca. eineinhalb Scheiben Höhe
beschränkten Ereignisse der Öffentlichen Wirksamkeit Christi, wobei jede einzelne Szene der figürlichen Reihen von
einem separaten Baldachin bekrönt wurde. In der oberen Fensterhälfte erfolgt unvermittelt der Übergang zu den
beiden übergreifenden Darstellungen der Auferstehung (7—9a—c) und Himmelfahrt (10—12a—c, 13 b), die — wieder ana-
log zum Fenster der fünf Freuden Mariae — erst drei, dann vier Zeilen beanspruchen. Nur in den gelben und weißen
212 Vgl. Frankl, Hemmel, 1956, Abb. 77—86, 117, 120—126, 144—148,
und CVMA Deutschland I, 2, 1986, Abb. 358—367.
213 Abweichungen wie die Einbeziehung der Beschneidung — anstelle
des meist üblichen Zwölfjährigen Jesu im Tempel — könnten um 1480
lokal bedingt gewesen sein: Gerade der Ulmer Dominikaner und Histo-
riograph Felix Fabri vermerkt im Bericht über seine Reisen ins Heilige
Land (1480 und 1483) eine Art den Rosenkranz zu beten, die sich nicht
allein dadurch von der seiner übrigen Ordensgenossen unterscheidet,
daß er 200 statt 150 Ave und 20 Pater noster empfiehlt, sondern unter
den fünf Zusätzen der freudenreichen Geheimnisse dieses Rosenkranzes
eben die Beschneidung nennt (vgl. Beissel, 1909, S. 5 37 £.). Überschnei-
dungen mit den sieben Ereignissen des schmerzensreichen Rosenkranzes
hat es ohnedies immer gegeben; vgl.: Beissel, 1909, S. 630-659; LThK
IX, 1964, Sp. 429—431; LCIII, 1970, Sp. 62; Schiller IV, 2, 1980, beson-
ders S. 199-201; Marienlexikon II, 1989, S. 538. In anderen Reihen zählte
die Auferstehung Christi (anstelle des Zwölfjährigen im Tempel) zu den
Sieben Freuden, doch diese war ja schon im Ratsfenster vergeben. Ger-
stenberg, 1932, S. 31, Frankl, Hans Wild, 1912, S. 44, und dersJ Hem-
mel, 1956, S. 82, bezeichnen das Kramerfenster ohne Einschränkung als
»Fenster der sieben Freuden Mariä«.
214 Vgl. besonders Arthur Watson, The Early Iconography of the Tree
of Jesse, Oxford/London 1934, S. 3—8 (mit Belegstellen für die zuerst
Anfang des 3. Jh. durch Tertullian (De carne Christi 21,5) formulierte
und später von Ambrosius, Hieronymus, Papst Leo d. Gr., Maximus von
Turin, Paulus Diaconus und Hrabanus Maurus bekräftigte sinnbildliche
Gleichsetzung von virga und virgd)', ebenso Schiller I, L981, S. 23—32,
und Anselm Salzer, Die Sinnbilder und Beiworte Mariens in der deut-
schen Literatur und lateinischen Hymnenpoesie des Mittelalters, Seiten-
stetten 1893 (Neudruck Darmstadt 1967), S. 29—31.