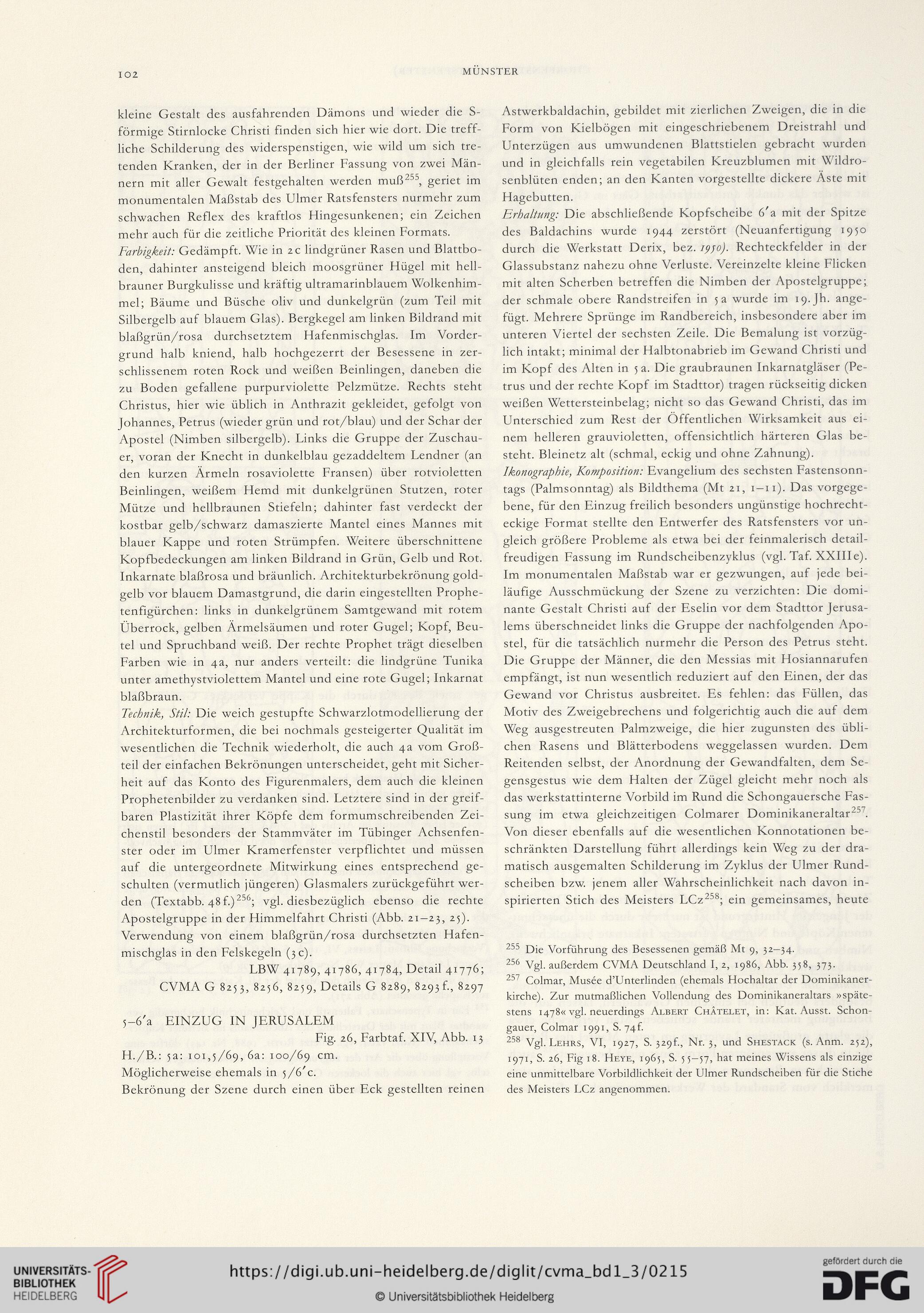102
MÜNSTER
kleine Gestalt des ausfahrenden Dämons und wieder die S-
förmige Stirnlocke Christi finden sich hier wie dort. Die treff-
liche Schilderung des widerspenstigen, wie wild um sich tre-
tenden Kranken, der in der Berliner Fassung von zwei Män-
nern mit aller Gewalt festgehalten werden muß2"’5, geriet im
monumentalen Maßstab des Ulmer Ratsfensters nurmehr zum
schwachen Reflex des kraftlos Hingesunkenen; ein Zeichen
mehr auch für die zeitliche Priorität des kleinen Formats.
Farbigkeit: Gedämpft. Wie in 2 c lindgrüner Rasen und Blattbo-
den, dahinter ansteigend bleich moosgrüner Hügel mit hell-
brauner Burgkulisse und kräftig ultramarinblauem Wolkenhim-
mel; Bäume und Büsche oliv und dunkelgrün (zum Teil mit
Silbergelb auf blauem Glas). Bergkegel am linken Bildrand mit
blaßgrün/rosa durchsetztem Hafenmischglas. Im Vorder-
grund halb kniend, halb hochgezerrt der Besessene in zer-
schlissenem roten Rock und weißen Beinlingen, daneben die
zu Boden gefallene purpurviolette Pelzmütze. Rechts steht
Christus, hier wie üblich in Anthrazit gekleidet, gefolgt von
Johannes, Petrus (wieder grün und rot/blau) und der Schar der
Apostel (Nimben silbergelb). Links die Gruppe der Zuschau-
er, voran der Knecht in dunkelblau gezaddeltem Lendner (an
den kurzen Ärmeln rosaviolette Fransen) über rotvioletten
Beinlingen, weißem Hemd mit dunkelgrünen Stutzen, roter
Mütze und hellbraunen Stiefeln; dahinter fast verdeckt der
kostbar gelb/schwarz damaszierte Mantel eines Mannes mit
blauer Kappe und roten Strümpfen. Weitere überschnittene
Kopfbedeckungen am linken Bildrand in Grün, Gelb und Rot.
Inkarnate blaßrosa und bräunlich. Architekturbekrönung gold-
gelb vor blauem Damastgrund, die darin eingestellten Prophe-
tenfigürchen: links in dunkelgrünem Samtgewand mit rotem
Überrock, gelben Ärmelsäumen und roter Gugel; Kopf, Beu-
tel und Spruchband weiß. Der rechte Prophet trägt dieselben
Farben wie in 4a, nur anders verteilt: die lindgrüne Tunika
unter amethystviolettem Mantel und eine rote Gugel; Inkarnat
blaßbraun.
Technik, Stil: Die weich gestupfte Schwarzlotmodellierung der
Architekturformen, die bei nochmals gesteigerter Qualität im
wesentlichen die Technik wiederholt, die auch 4a vom Groß-
teil der einfachen Bekrönungen unterscheidet, geht mit Sicher-
heit auf das Konto des Figurenmalers, dem auch die kleinen
Prophetenbilder zu verdanken sind. Letztere sind in der greif-
baren Plastizität ihrer Köpfe dem formumschreibenden Zei-
chenstil besonders der Stammväter im Tübinger Achsenfen-
ster oder im Ulmer Kramerfenster verpflichtet und müssen
auf die untergeordnete Mitwirkung eines entsprechend ge-
schulten (vermutlich jüngeren) Glasmalers zurückgeführt wer-
den (Textabb. 48 f.)256; vgl. diesbezüglich ebenso die rechte
Apostelgruppe in der Himmelfahrt Christi (Abb. 21—23, 2?)-
Verwendung von einem blaßgrün/rosa durchsetzten Hafen-
mischglas in den Felskegeln (3 c).
LBW 41789, 41786, 41784, Detail 41776;
CVMA G 825 3, 8256, 8259, Details G 8289, 8293 f., 8297
5-6'a EINZUG IN JERUSALEM
Fig. 26, Farbtaf. XIV, Abb. 13
H./B.: 5a: 101,5/69,63: 100/69 cm.
Möglicherweise ehemals in 5/6'c.
Bekrönung der Szene durch einen über Eck gestellten reinen
Astwerkbaldachin, gebildet mit zierlichen Zweigen, die in die
Form von Kielbögen mit eingeschriebenem Dreistrahl und
Unterzügen aus umwundenen Blattstielen gebracht wurden
und in gleichfalls rein vegetabilen Kreuzblumen mit Wildro-
senblüten enden; an den Kanten vorgestellte dickere Äste mit
Hagebutten.
Erhaltung: Die abschließende Kopfscheibe 6'a mit der Spitze
des Baldachins wurde 1944 zerstört (Neuanfertigung 1950
durch die Werkstatt Derix, bez. 1950). Rechteckfelder in der
Glassubstanz nahezu ohne Verluste. Vereinzelte kleine Flicken
mit alten Scherben betreffen die Nimben der Apostelgruppe;
der schmale obere Randstreifen in 5 a wurde im 19. Jh. ange-
fügt. Mehrere Sprünge im Randbereich, insbesondere aber im
unteren Viertel der sechsten Zeile. Die Bemalung ist vorzüg-
lich intakt; minimal der Halbtonabrieb im Gewand Christi und
im Kopf des Alten in 5 a. Die graubraunen Inkarnatgläser (Pe-
trus und der rechte Kopf im Stadttor) tragen rückseitig dicken
weißen Wettersteinbelag; nicht so das Gewand Christi, das im
Unterschied zum Rest der Öffentlichen Wirksamkeit aus ei-
nem helleren grauvioletten, offensichtlich härteren Glas be-
steht. Bleinetz alt (schmal, eckig und ohne Zahnung).
Ikonographie, Komposition: Evangelium des sechsten Fastensonn-
tags (Palmsonntag) als Bildthema (Mt 21, 1—11). Das vorgege-
bene, für den Einzug freilich besonders ungünstige hochrecht-
eckige Format stellte den Entwerfer des Ratsfensters vor un-
gleich größere Probleme als etwa bei der feinmalerisch detail-
freudigen Fassung im Rundscheibenzyklus (vgl. Taf. XXIII e).
Im monumentalen Maßstab war er gezwungen, auf jede bei-
läufige Ausschmückung der Szene zu verzichten: Die domi-
nante Gestalt Christi auf der Eselin vor dem Stadttor Jerusa-
lems überschneidet links die Gruppe der nachfolgenden Apo-
stel, für die tatsächlich nurmehr die Person des Petrus steht.
Die Gruppe der Männer, die den Messias mit Hosiannarufen
empfängt, ist nun wesentlich reduziert auf den Einen, der das
Gewand vor Christus ausbreitet. Es fehlen: das Füllen, das
Motiv des Zweigebrechens und folgerichtig auch die auf dem
Weg ausgestreuten Palmzweige, die hier zugunsten des übli-
chen Rasens und Blätterbodens weggelassen wurden. Dem
Reitenden selbst, der Anordnung der Gewandfalten, dem Se-
gensgestus wie dem Halten der Zügel gleicht mehr noch als
das werkstattinterne Vorbild im Rund die Schongauersche Fas-
sung im etwa gleichzeitigen Colmarer Dominikaneraltar2°7.
Von dieser ebenfalls auf die wesentlichen Konnotationen be-
schränkten Darstellung führt allerdings kein Weg zu der dra-
matisch ausgemalten Schilderung im Zyklus der Ulmer Rund-
scheiben bzw. jenem aller Wahrscheinlichkeit nach davon in-
spirierten Stich des Meisters LCz258; ein gemeinsames, heute
255 Die Vorführung des Besessenen gemäß Mt 9, 32—34.
256 Vgl. außerdem CVMA Deutschland I, 2, 1986, Abb. 358, 373.
2o7 Colmar, Musee d’Unterlinden (ehemals Hochaltar der Dominikaner-
kirche). Zur mutmaßlichen Vollendung des Dominikaneraltars »späte-
stens 1478« vgl. neuerdings Albert Chätelet, in: Kat. Ausst. Schon-
gauer, Colmar 1991, S. 74 f.
258 Vgl. Lehrs, VI, 1927, S. 329h, Nr. 3, und Shestack (s. Anm. 252),
1971, S. 26, Fig 18. Heye, 1965, S. 55—57, hat meines Wissens als einzige
eine unmittelbare Vorbildlichkeit der Ulmer Rundscheiben für die Stiche
des Meisters LCz angenommen.
MÜNSTER
kleine Gestalt des ausfahrenden Dämons und wieder die S-
förmige Stirnlocke Christi finden sich hier wie dort. Die treff-
liche Schilderung des widerspenstigen, wie wild um sich tre-
tenden Kranken, der in der Berliner Fassung von zwei Män-
nern mit aller Gewalt festgehalten werden muß2"’5, geriet im
monumentalen Maßstab des Ulmer Ratsfensters nurmehr zum
schwachen Reflex des kraftlos Hingesunkenen; ein Zeichen
mehr auch für die zeitliche Priorität des kleinen Formats.
Farbigkeit: Gedämpft. Wie in 2 c lindgrüner Rasen und Blattbo-
den, dahinter ansteigend bleich moosgrüner Hügel mit hell-
brauner Burgkulisse und kräftig ultramarinblauem Wolkenhim-
mel; Bäume und Büsche oliv und dunkelgrün (zum Teil mit
Silbergelb auf blauem Glas). Bergkegel am linken Bildrand mit
blaßgrün/rosa durchsetztem Hafenmischglas. Im Vorder-
grund halb kniend, halb hochgezerrt der Besessene in zer-
schlissenem roten Rock und weißen Beinlingen, daneben die
zu Boden gefallene purpurviolette Pelzmütze. Rechts steht
Christus, hier wie üblich in Anthrazit gekleidet, gefolgt von
Johannes, Petrus (wieder grün und rot/blau) und der Schar der
Apostel (Nimben silbergelb). Links die Gruppe der Zuschau-
er, voran der Knecht in dunkelblau gezaddeltem Lendner (an
den kurzen Ärmeln rosaviolette Fransen) über rotvioletten
Beinlingen, weißem Hemd mit dunkelgrünen Stutzen, roter
Mütze und hellbraunen Stiefeln; dahinter fast verdeckt der
kostbar gelb/schwarz damaszierte Mantel eines Mannes mit
blauer Kappe und roten Strümpfen. Weitere überschnittene
Kopfbedeckungen am linken Bildrand in Grün, Gelb und Rot.
Inkarnate blaßrosa und bräunlich. Architekturbekrönung gold-
gelb vor blauem Damastgrund, die darin eingestellten Prophe-
tenfigürchen: links in dunkelgrünem Samtgewand mit rotem
Überrock, gelben Ärmelsäumen und roter Gugel; Kopf, Beu-
tel und Spruchband weiß. Der rechte Prophet trägt dieselben
Farben wie in 4a, nur anders verteilt: die lindgrüne Tunika
unter amethystviolettem Mantel und eine rote Gugel; Inkarnat
blaßbraun.
Technik, Stil: Die weich gestupfte Schwarzlotmodellierung der
Architekturformen, die bei nochmals gesteigerter Qualität im
wesentlichen die Technik wiederholt, die auch 4a vom Groß-
teil der einfachen Bekrönungen unterscheidet, geht mit Sicher-
heit auf das Konto des Figurenmalers, dem auch die kleinen
Prophetenbilder zu verdanken sind. Letztere sind in der greif-
baren Plastizität ihrer Köpfe dem formumschreibenden Zei-
chenstil besonders der Stammväter im Tübinger Achsenfen-
ster oder im Ulmer Kramerfenster verpflichtet und müssen
auf die untergeordnete Mitwirkung eines entsprechend ge-
schulten (vermutlich jüngeren) Glasmalers zurückgeführt wer-
den (Textabb. 48 f.)256; vgl. diesbezüglich ebenso die rechte
Apostelgruppe in der Himmelfahrt Christi (Abb. 21—23, 2?)-
Verwendung von einem blaßgrün/rosa durchsetzten Hafen-
mischglas in den Felskegeln (3 c).
LBW 41789, 41786, 41784, Detail 41776;
CVMA G 825 3, 8256, 8259, Details G 8289, 8293 f., 8297
5-6'a EINZUG IN JERUSALEM
Fig. 26, Farbtaf. XIV, Abb. 13
H./B.: 5a: 101,5/69,63: 100/69 cm.
Möglicherweise ehemals in 5/6'c.
Bekrönung der Szene durch einen über Eck gestellten reinen
Astwerkbaldachin, gebildet mit zierlichen Zweigen, die in die
Form von Kielbögen mit eingeschriebenem Dreistrahl und
Unterzügen aus umwundenen Blattstielen gebracht wurden
und in gleichfalls rein vegetabilen Kreuzblumen mit Wildro-
senblüten enden; an den Kanten vorgestellte dickere Äste mit
Hagebutten.
Erhaltung: Die abschließende Kopfscheibe 6'a mit der Spitze
des Baldachins wurde 1944 zerstört (Neuanfertigung 1950
durch die Werkstatt Derix, bez. 1950). Rechteckfelder in der
Glassubstanz nahezu ohne Verluste. Vereinzelte kleine Flicken
mit alten Scherben betreffen die Nimben der Apostelgruppe;
der schmale obere Randstreifen in 5 a wurde im 19. Jh. ange-
fügt. Mehrere Sprünge im Randbereich, insbesondere aber im
unteren Viertel der sechsten Zeile. Die Bemalung ist vorzüg-
lich intakt; minimal der Halbtonabrieb im Gewand Christi und
im Kopf des Alten in 5 a. Die graubraunen Inkarnatgläser (Pe-
trus und der rechte Kopf im Stadttor) tragen rückseitig dicken
weißen Wettersteinbelag; nicht so das Gewand Christi, das im
Unterschied zum Rest der Öffentlichen Wirksamkeit aus ei-
nem helleren grauvioletten, offensichtlich härteren Glas be-
steht. Bleinetz alt (schmal, eckig und ohne Zahnung).
Ikonographie, Komposition: Evangelium des sechsten Fastensonn-
tags (Palmsonntag) als Bildthema (Mt 21, 1—11). Das vorgege-
bene, für den Einzug freilich besonders ungünstige hochrecht-
eckige Format stellte den Entwerfer des Ratsfensters vor un-
gleich größere Probleme als etwa bei der feinmalerisch detail-
freudigen Fassung im Rundscheibenzyklus (vgl. Taf. XXIII e).
Im monumentalen Maßstab war er gezwungen, auf jede bei-
läufige Ausschmückung der Szene zu verzichten: Die domi-
nante Gestalt Christi auf der Eselin vor dem Stadttor Jerusa-
lems überschneidet links die Gruppe der nachfolgenden Apo-
stel, für die tatsächlich nurmehr die Person des Petrus steht.
Die Gruppe der Männer, die den Messias mit Hosiannarufen
empfängt, ist nun wesentlich reduziert auf den Einen, der das
Gewand vor Christus ausbreitet. Es fehlen: das Füllen, das
Motiv des Zweigebrechens und folgerichtig auch die auf dem
Weg ausgestreuten Palmzweige, die hier zugunsten des übli-
chen Rasens und Blätterbodens weggelassen wurden. Dem
Reitenden selbst, der Anordnung der Gewandfalten, dem Se-
gensgestus wie dem Halten der Zügel gleicht mehr noch als
das werkstattinterne Vorbild im Rund die Schongauersche Fas-
sung im etwa gleichzeitigen Colmarer Dominikaneraltar2°7.
Von dieser ebenfalls auf die wesentlichen Konnotationen be-
schränkten Darstellung führt allerdings kein Weg zu der dra-
matisch ausgemalten Schilderung im Zyklus der Ulmer Rund-
scheiben bzw. jenem aller Wahrscheinlichkeit nach davon in-
spirierten Stich des Meisters LCz258; ein gemeinsames, heute
255 Die Vorführung des Besessenen gemäß Mt 9, 32—34.
256 Vgl. außerdem CVMA Deutschland I, 2, 1986, Abb. 358, 373.
2o7 Colmar, Musee d’Unterlinden (ehemals Hochaltar der Dominikaner-
kirche). Zur mutmaßlichen Vollendung des Dominikaneraltars »späte-
stens 1478« vgl. neuerdings Albert Chätelet, in: Kat. Ausst. Schon-
gauer, Colmar 1991, S. 74 f.
258 Vgl. Lehrs, VI, 1927, S. 329h, Nr. 3, und Shestack (s. Anm. 252),
1971, S. 26, Fig 18. Heye, 1965, S. 55—57, hat meines Wissens als einzige
eine unmittelbare Vorbildlichkeit der Ulmer Rundscheiben für die Stiche
des Meisters LCz angenommen.