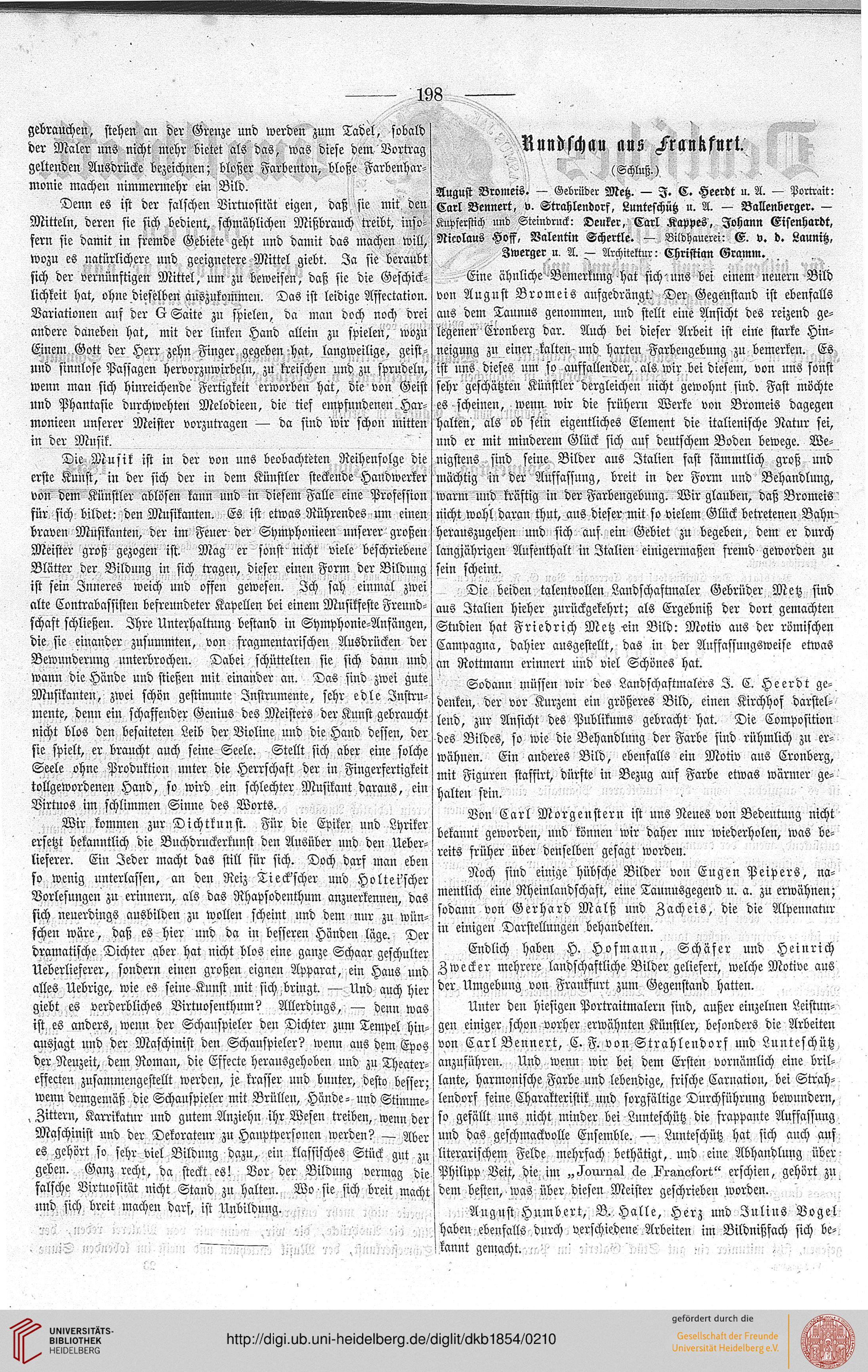\
- 198
gebrauchen, stehen an der Grenze und werden zum Tadel, sobald
der Maler uns nicht mehr bietet als das, was diese dem Vortrag
geltenden Ausdrücke bezeichnen; bloßer Farbenton, bloße Farbenhar-
monie machen nimmermehr ein Bild.
Denn es ist der falschen Virtuosität eigen, daß sie mit. den
Mitteln, deren sie sich bedient, schmählichen Mißbrauch treibt, inso-
fern sie damit in fremde Gebiete geht und damit das machen will,
wozu es natürlichere und geeignetere Mittel giebt. Ja sie beraubt
sich der vernünftigen Mittel, um zu beweisen, daß sie die Geschick-
lichkeit hat, ohne dieselben auszukommen. Das ist leidige Affectation.
Variationen aus der 6 Saite zu spielen, da man doch noch drei
andere daneben hat, mit der linken Hand allein zu spielen, wozu
Einem Gott der Herr zehn Finger gegeben hat, langweilige, geist-
nnd sinnlose Passagen hervorzuwirbeln, zu kreischen und zu sprudeln,
wenn man sich hinreichende Fertigkeit erworben hat, die von Geist
und Phantasie durchwehten Melodiken, die tief empfundenen. Har-
moniken unserer Meister vorzutragen — da sind wir schon mitten
in der Musik.
Die Musik ist in der von uns beobachteten Reihenfolge die
erste Kunst, in der sich der in dem Künstler steckende Handwerker
von dem Künstler ablösen kann und in diesem Falle eine Prosession
für sich bildet: den Musikanten. Es ist etwas Rührendes um einen
braven Musikanten, der im Feuer der Symphonieen unserer großen
Meister groß gezogen ist. Mag er sonst nicht viele beschriebene
Blätter der Bildung in sich tragen, dieser einen Form der Bildung
ist sein Inneres weich und offen gewesen. Ich sah einmal zwei
alte Contrabassisten befreundeter Kapellen bei einem Musikfeste Freund-
schaft schließen. Ihre Unterhaltung bestand in Symphonie-Anfängen,
die sie einander zusummten, von ftagmentarischen Ausdrücken der
Bewunderung imterbrochen. Dabei schüttelten sie sich dann und
wann die Hände und stießen mit einander an. Das sind zwei gute
Musikanten, zwei schön gestimmte Instrumente, sehr edle Jnstru-
mente, denn ein schaffender Genius des Meisters der Kunst gebraucht
nicht blos den besaiteten Leib der Violine und die Hand dessen, der
sie spielt, er braucht auch seine Seele. Stellt sich aber eine solche
Seele ohne Produktion unter die Herrschaft der in Fingerfertigkeit
tollgewordenen Hand, so wird ein schlechter Musikant daraus, ein
Virtuos im schlimmen Sinne des Worts.
Wir kommen zur Dichtkunst. Für die Epiker und Lyriker
ersetzt bekanntlich die Buchdruckerkunst den Ausüber und den Ueber-
lieferer. Ein Jeder macht das still fiir sich. Doch darf man eben
so wenig unterlassen, an den Reiz Tieck'scher und Holtei'scher
Vorlesungen zu erinnern, als das Rhapsodenthum anzuerkennen, das
sich neuerdings ausbilden zu wollen scheint und dem nur zu wün-
scheu wäre, daß es hier und da in besseren Händen läge. Der
dramatische Dichter aber hat nicht blos eine ganze Schaar geschulter
Ueberlieserer, sondern einen großen eignen Apparat, ein Haus und
alles Uebrige, wie es seine Kunst mit sich bringt. — Und auch hier
giebt es verderbliches Virtuosenthnm? Allerdings, — denn was
ist es anders, wenn der Schauspieler den Dichter zum Tempel hin-
ausjagt und der Maschinist den Schauspieler? wenn aus dem Epos
der Neuzeit, dem Roman, die Effecte herausgehoben und zu Theater-
effecten zusammengestellt werden, je krasser und bunter, desto besser;
wenn demgemäß die Schauspieler mit Brüllen, Hände- und Stimme-
, Zittern, Karrikatur und gutem Anziehn ihr Wesen treiben, wenn der
Maschinist und der Dekorateur zu Hauptpersonen werden? — Aber
es gehört so sehr viel Bildung dazu, ein klassisches Stück gut zu
geben. Ganz recht, da steckt es! Vor der Bildung vermag die
falsche Virtuosität nicht Stand zu halten. Wo ■ sie sich breit macht
und sich, breit machen darf, ist Unbildung.
Rundschau aus Frankfurt.
' ; (Schluß.)
August Bromeis. — Gebrüder Metz. — I. C. Heerdt u. A. — Portrait:
Carl Bennert, v. Strahlendorf, Lunteschütz u. A. — Ballenberger. —
Kupferstich und Steindruck: Deuker, Carl Kappes', Johann Eisenhardt,
Nicolaus Hoff, Valentin Schertle. — Bildhauerei: E. v. d. Launitz,
Zwerger u. A. — Architektur: Christian Gramm.
Eine ähnliche Bemerkung hat sich'uns bei einem neuern Bild
von August Bromeis aufgedrängt.' Der Gegenstand ist ebenfalls
aus den: Taunus genommen, und stellt eine Ansicht des reizend ge-
legenen Cronb erg dar. Auch bei dieser Arbeit ist eine starke Hin-
neigung zu einer kalten-und harten Farbengebung zu bemerken. Es
ist uns dieses um so auffallender,' als wir bei diesem, von uns sonst
sehr geschätzten Künstler dergleichen nicht gewohnt sind. Fast möchte
es scheinen, wenn wir die frühern Werke von Bromeis dagegen
halten, als ob sein eigentliches Element die italienische Natur sei,
und er mit minderem Glück sich aus deutschem Boden bewege. We-
nigstens sind seine Bilder aus Italien fast sämmtlich groß und
mächtig in der Auffassung, breit in der Form und Behandlung,
warm und kräftig in der Farbengebung. Wir glauben, daß Bromeis
nicht wohl daran thut, aus dieser mit so vielem Glück betretenen Bahn-
herauszugehen und sich auf. ein Gebiet zu begeben, dem er durch
langjährigen Aufenthalt in Italien einigermaßen fremd geworden zu
sein scheint.
Die beiden talentvollen Landschafttnaler Gebrüder Metz sind
aus Italien hieher zurückgekehrt; als Ergebnis; der dort gemachten
Studien hat Friedrich Metz -ein Bild: Mottv aus der römischen
Campagna, dahier ausgestellt, das in der Ausfaffungsweise etwas
an Rottmcmn erinnert und viel Schönes hat.
Sodann müssen wir des Landschaftmalers I. C. Heerdt ge-
denken, der vor Kurzen: ein größeres Bild, einen Kirchhof darstel-
lend, zur Ansicht des Publikums gebracht- hat. Die Composition
des Bildes, so wie die Behandlung der Farbe sind rühmlich zu er-
wähnen. Ein anderes Bild, ebenfalls ein Motiv aus Cronberg,
mit Figuren stasfirt, dürfte in Bezug aus Farbe etwas wärmer ge-
halten sein. -
Bon Carl Morgenstern ist uns Neues von Bedeutung nicht
bekannt geworden, und können wir daher nur wiederholen, was be-
reits früher über denselben gesagt worden.
Noch sind einige hübsche Bilder von Eugen Peipers, na-
mentlich eine Rheinlandschäft, eine Taunusgegend u. a. zu erwähnen;
sodann von Gerhard Malß und Zach eis, die die Alpennatnr
in einigen Darstellungen behandelten.
Endlich haben H. H o fm ann, Schäfer und Heinrich
ZWecker mehrere landschaftliche Bilder geliefert, welche Motive aus
der Umgebung von Frankfurt zum Gegenstand hatten.
Unter den hiesigen Portraitmalern sind, außer einzelnen Leistun-
gen einiger schon vorher erwähnten Künstler, besonders die Arbeiten
von Carl Bennert, C. F. von Strahlendors und Lunteschütz
anzuführen. Und wenn wir bei dem Ersten vornämlich eine bril-
lante, harmonische Farbe und lebendige, frische Carnation, bei Strah-
lendorf seine Charakteristik und sorgfältige Durchführung bewundern,
so gefällt uns nicht minder bei Lunteschütz die ftappante Auffassung
und das geschmackvolle Ensemble. — Lunteschütz hat sich auch auf
literarischem Felde mehrfach bethätigt, und eine Abhandlung über
Philipp Veit, die im „Journal de .Francfort“ erschien, gehört zu
dem besten, was über diesen Meister geschrieben worden.
August Humbert, B.. Halle, Herz und Julius Vogel
haben ebenfalls durch verschiedene Arbeiten im Bildnißfach sich be-,
kannt gemacht.-'-/ mi •' )nfi m 'somn im W