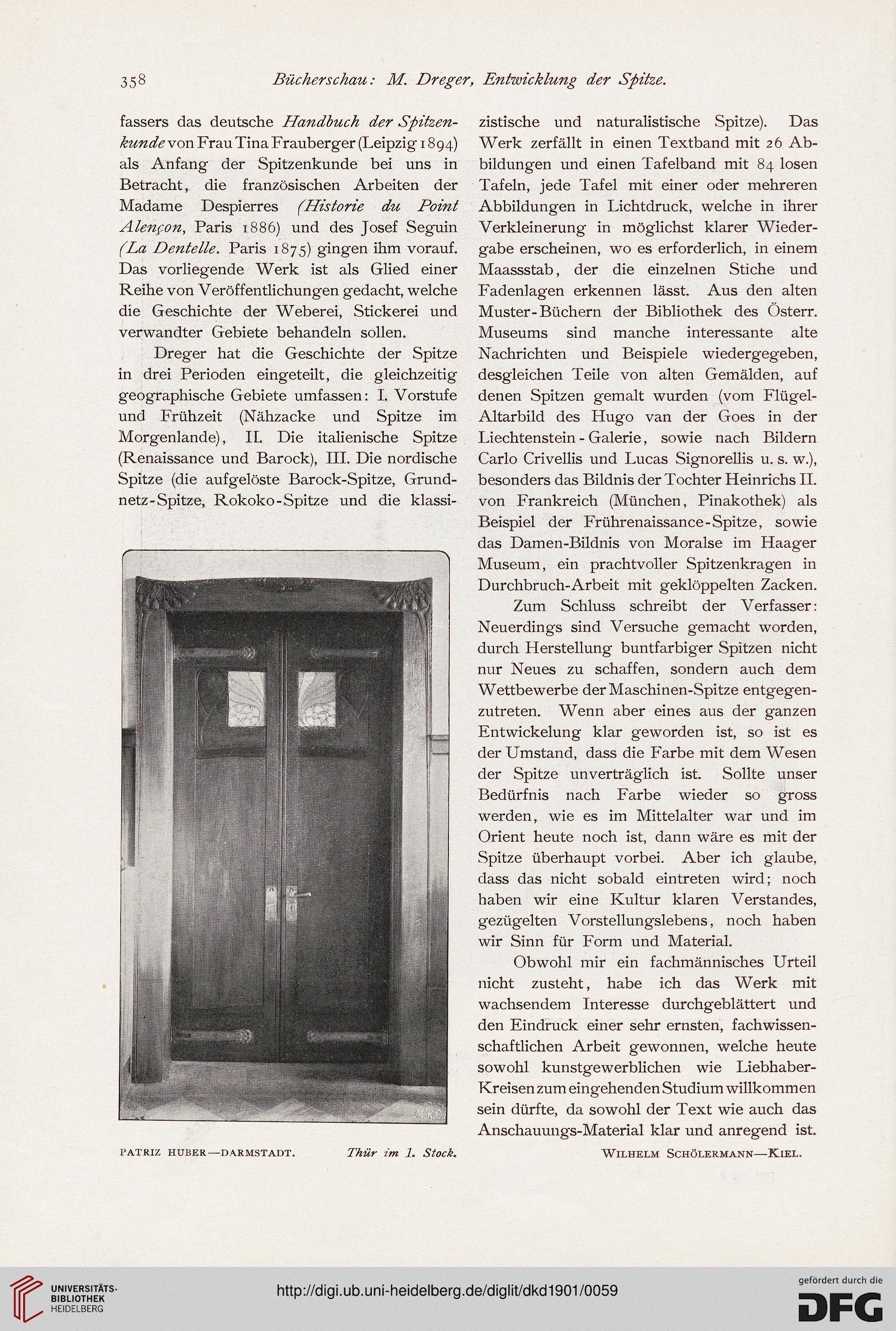358
Bücherschau: M. Dreger, Entwicklung der Spitze.
fassers das deutsche Handbuch der Spitzen-
kunde von Frau Tina Frauberger (Leipzig 1894)
als Anfang der Spitzenkunde bei uns in
Betracht, die französischen Arbeiten der
Madame Despierres (Historie du Point
Alenfon, Paris 1886) und des Josef Seguin
(La Deutelte. Paris 1875) gingen ihm vorauf.
Das vorliegende Werk ist als Glied einer
Reihe von Veröffentlichungen gedacht, welche
die Geschichte der Weberei, Stickerei und
verwandter Gebiete behandeln sollen.
Dreger hat die Geschichte der Spitze
in drei Perioden eingeteilt, die gleichzeitig
geographische Gebiete umfassen: I. Vorstufe
und Frühzeit (Nähzacke und Spitze im
Morgenlande), IL Die italienische Spitze
(Renaissance und Barock), III. Die nordische
Spitze (die aufgelöste Barock-Spitze, Grund-
netz-Spitze, Rokoko-Spitze und die klassi-
i'atriz huber—darmstadt. Thür im 1. Stock.
zistische und naturalistische Spitze). Das
Werk zerfällt in einen Textband mit 26 Ab-
bildungen und einen Tafelband mit 84 losen
Tafeln, jede Tafel mit einer oder mehreren
Abbildungen in Lichtdruck, welche in ihrer
Verkleinerung in möglichst klarer Wieder-
gabe erscheinen, wo es erforderlich, in einem
Maassstab, der die einzelnen Stiche und
Fadenlagen erkennen lässt. Aus den alten
Muster-Büchern der Bibliothek des Österr.
Museums sind manche interessante alte
Nachrichten und Beispiele wiedergegeben,
desgleichen Teile von alten Gemälden, auf
denen Spitzen gemalt wurden (vom Flügel-
Altarbild des Hugo van der Goes in der
Liechtenstein - Galerie, sowie nach Bildern
Carlo Crivellis und Lucas Signorellis u. s. w.),
besonders das Bildnis der Tochter Heinrichs II.
von Frankreich (München, Pinakothek) als
Beispiel der Frührenaissance-Spitze, sowie
das Damen-Bildnis von Moralse im Haager
Museum, ein prachtvoller Spitzenkragen in
Durchbruch-Arbeit mit geklöppelten Zacken.
Zum Schluss schreibt der Verfasser:
Neuerdings sind Versuche gemacht worden,
durch Herstellung buntfarbiger Spitzen nicht
nur Neues zu schaffen, sondern auch dem
Wettbewerbe der Maschinen-Spitze entgegen-
zutreten. Wenn aber eines aus der ganzen
Entwickelung klar geworden ist, so ist es
der Umstand, dass die Farbe mit dem Wesen
der Spitze unverträglich ist. Sollte unser
Bedürfnis nach Farbe wieder so gross
werden, wie es im Mittelalter war und im
Orient heute noch ist, dann wäre es mit der
Spitze überhaupt vorbei. Aber ich glaube,
dass das nicht sobald eintreten wird; noch
haben wir eine Kultur klaren Verstandes,
gezügelten Vorstellungslebens, noch haben
wir Sinn für Form und Material.
Obwohl mir ein fachmännisches Urteil
nicht zusteht, habe ich das Werk mit
wachsendem Interesse durchgeblättert und
den Eindruck einer sehr ernsten, fachwissen-
schaftlichen Arbeit gewonnen, welche heute
sowohl kunstgewerblichen wie Liebhaber-
Kreisen zum eingehenden Studium willkommen
sein dürfte, da sowohl der Text wie auch das
Anschauungs-Material klar und anregend ist.
Wilhelm Schölermann—Kiel.
Bücherschau: M. Dreger, Entwicklung der Spitze.
fassers das deutsche Handbuch der Spitzen-
kunde von Frau Tina Frauberger (Leipzig 1894)
als Anfang der Spitzenkunde bei uns in
Betracht, die französischen Arbeiten der
Madame Despierres (Historie du Point
Alenfon, Paris 1886) und des Josef Seguin
(La Deutelte. Paris 1875) gingen ihm vorauf.
Das vorliegende Werk ist als Glied einer
Reihe von Veröffentlichungen gedacht, welche
die Geschichte der Weberei, Stickerei und
verwandter Gebiete behandeln sollen.
Dreger hat die Geschichte der Spitze
in drei Perioden eingeteilt, die gleichzeitig
geographische Gebiete umfassen: I. Vorstufe
und Frühzeit (Nähzacke und Spitze im
Morgenlande), IL Die italienische Spitze
(Renaissance und Barock), III. Die nordische
Spitze (die aufgelöste Barock-Spitze, Grund-
netz-Spitze, Rokoko-Spitze und die klassi-
i'atriz huber—darmstadt. Thür im 1. Stock.
zistische und naturalistische Spitze). Das
Werk zerfällt in einen Textband mit 26 Ab-
bildungen und einen Tafelband mit 84 losen
Tafeln, jede Tafel mit einer oder mehreren
Abbildungen in Lichtdruck, welche in ihrer
Verkleinerung in möglichst klarer Wieder-
gabe erscheinen, wo es erforderlich, in einem
Maassstab, der die einzelnen Stiche und
Fadenlagen erkennen lässt. Aus den alten
Muster-Büchern der Bibliothek des Österr.
Museums sind manche interessante alte
Nachrichten und Beispiele wiedergegeben,
desgleichen Teile von alten Gemälden, auf
denen Spitzen gemalt wurden (vom Flügel-
Altarbild des Hugo van der Goes in der
Liechtenstein - Galerie, sowie nach Bildern
Carlo Crivellis und Lucas Signorellis u. s. w.),
besonders das Bildnis der Tochter Heinrichs II.
von Frankreich (München, Pinakothek) als
Beispiel der Frührenaissance-Spitze, sowie
das Damen-Bildnis von Moralse im Haager
Museum, ein prachtvoller Spitzenkragen in
Durchbruch-Arbeit mit geklöppelten Zacken.
Zum Schluss schreibt der Verfasser:
Neuerdings sind Versuche gemacht worden,
durch Herstellung buntfarbiger Spitzen nicht
nur Neues zu schaffen, sondern auch dem
Wettbewerbe der Maschinen-Spitze entgegen-
zutreten. Wenn aber eines aus der ganzen
Entwickelung klar geworden ist, so ist es
der Umstand, dass die Farbe mit dem Wesen
der Spitze unverträglich ist. Sollte unser
Bedürfnis nach Farbe wieder so gross
werden, wie es im Mittelalter war und im
Orient heute noch ist, dann wäre es mit der
Spitze überhaupt vorbei. Aber ich glaube,
dass das nicht sobald eintreten wird; noch
haben wir eine Kultur klaren Verstandes,
gezügelten Vorstellungslebens, noch haben
wir Sinn für Form und Material.
Obwohl mir ein fachmännisches Urteil
nicht zusteht, habe ich das Werk mit
wachsendem Interesse durchgeblättert und
den Eindruck einer sehr ernsten, fachwissen-
schaftlichen Arbeit gewonnen, welche heute
sowohl kunstgewerblichen wie Liebhaber-
Kreisen zum eingehenden Studium willkommen
sein dürfte, da sowohl der Text wie auch das
Anschauungs-Material klar und anregend ist.
Wilhelm Schölermann—Kiel.