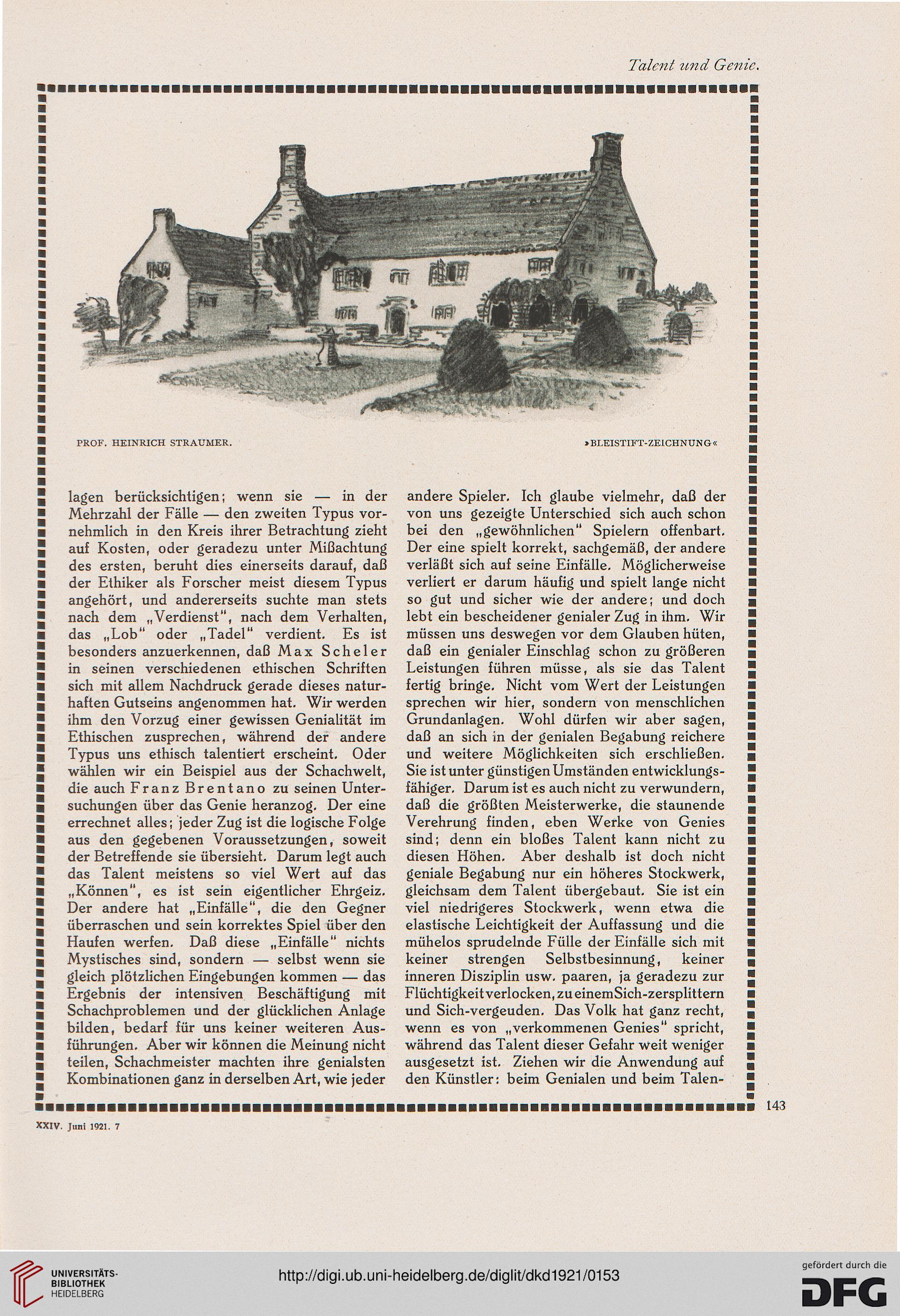Talent und Genie.
lagen berücksichtigen; wenn sie — in der
Mehrzahl der Fälle — den zweiten Typus vor-
nehmlich in den Kreis ihrer Betrachtung zieht
auf Kosten, oder geradezu unter Mißachtung
des ersten, beruht dies einerseits darauf, daß
der Ethiker als Forscher meist diesem Typus
angehört, und andererseits suchte man stets
nach dem „Verdienst", nach dem Verhalten,
das „Lob" oder „Tadel" verdient. Es ist
besonders anzuerkennen, daß Max Scheler
in seinen verschiedenen ethischen Schriften
sich mit allem Nachdruck gerade dieses natur-
haften Gutseins angenommen hat. Wir werden
ihm den Vorzug einer gewissen Genialität im
Ethischen zusprechen, während der andere
Typus uns ethisch talentiert erscheint. Oder
wählen wir ein Beispiel aus der Schachwelt,
die auch Franz Brentano zu seinen Unter-
suchungen über das Genie heranzog. Der eine
errechnet alles; jeder Zug ist die logische Folge
aus den gegebenen Voraussetzungen, soweit
der Betreffende sie übersieht. Darum legt auch
das Talent meistens so viel Wert auf das
„Können", es ist sein eigentlicher Ehrgeiz.
Der andere hat „Einfälle", die den Gegner
überraschen und sein korrektes Spiel über den
Haufen werfen. Daß diese „Einfälle" nichts
Mystisches sind, sondern — selbst wenn sie
gleich plötzlichen Eingebungen kommen — das
Ergebnis der intensiven Beschäftigung mit
Schachproblemen und der glücklichen Anlage
bilden, bedarf für uns keiner weiteren Aus-
führungen. Aber wir können die Meinung nicht
teilen, Schachmeister machten ihre genialsten
Kombinationen ganz in derselben Art, wie jeder
andere Spieler. Ich glaube vielmehr, daß der
von uns gezeigte Unterschied sich auch schon
bei den „gewöhnlichen" Spielern offenbart.
Der eine spielt korrekt, sachgemäß, der andere
verläßt sich auf seine Einfälle. Möglicherweise
verliert er darum häufig und spielt lange nicht
so gut und sicher wie der andere; und doch
lebt ein bescheidener genialer Zug in ihm. Wir
müssen uns deswegen vor dem Glauben hüten,
daß ein genialer Einschlag schon zu größeren
Leistungen führen müsse, als sie das Talent
fertig bringe. Nicht vom Wert der Leistungen
sprechen wir hier, sondern von menschlichen
Grundanlagen. Wohl dürfen wir aber sagen,
daß an sich in der genialen Begabung reichere
und weitere Möglichkeiten sich erschließen.
Sie ist unter günstigen Umständen entwicklungs-
fähiger. Darum ist es auch nicht zu verwundern,
daß die größten Meisterwerke, die staunende
Verehrung finden, eben Werke von Genies
sind; denn ein bloßes Talent kann nicht zu
diesen Höhen. Aber deshalb ist doch nicht
geniale Begabung nur ein höheres Stockwerk,
gleichsam dem Talent übergebaut. Sie ist ein
viel niedrigeres Stockwerk, wenn etwa die
elastische Leichtigkeit der Auffassung und die
mühelos sprudelnde Fülle der Einfälle sich mit
keiner strengen Selbstbesinnung, keiner
inneren Disziplin usw. paaren, ja geradezu zur
Flüchtigkeit verlocken, zu einemSich-zersplittern
und Sich-vergeuden. Das Volk hat ganz recht,
wenn es von „verkommenen Genies" spricht,
während das Talent dieser Gefahr weit weniger
ausgesetzt ist. Ziehen wir die Anwendung auf
den Künstler: beim Genialen und beim Talen-
XXIV. Juni 1921. 7
lagen berücksichtigen; wenn sie — in der
Mehrzahl der Fälle — den zweiten Typus vor-
nehmlich in den Kreis ihrer Betrachtung zieht
auf Kosten, oder geradezu unter Mißachtung
des ersten, beruht dies einerseits darauf, daß
der Ethiker als Forscher meist diesem Typus
angehört, und andererseits suchte man stets
nach dem „Verdienst", nach dem Verhalten,
das „Lob" oder „Tadel" verdient. Es ist
besonders anzuerkennen, daß Max Scheler
in seinen verschiedenen ethischen Schriften
sich mit allem Nachdruck gerade dieses natur-
haften Gutseins angenommen hat. Wir werden
ihm den Vorzug einer gewissen Genialität im
Ethischen zusprechen, während der andere
Typus uns ethisch talentiert erscheint. Oder
wählen wir ein Beispiel aus der Schachwelt,
die auch Franz Brentano zu seinen Unter-
suchungen über das Genie heranzog. Der eine
errechnet alles; jeder Zug ist die logische Folge
aus den gegebenen Voraussetzungen, soweit
der Betreffende sie übersieht. Darum legt auch
das Talent meistens so viel Wert auf das
„Können", es ist sein eigentlicher Ehrgeiz.
Der andere hat „Einfälle", die den Gegner
überraschen und sein korrektes Spiel über den
Haufen werfen. Daß diese „Einfälle" nichts
Mystisches sind, sondern — selbst wenn sie
gleich plötzlichen Eingebungen kommen — das
Ergebnis der intensiven Beschäftigung mit
Schachproblemen und der glücklichen Anlage
bilden, bedarf für uns keiner weiteren Aus-
führungen. Aber wir können die Meinung nicht
teilen, Schachmeister machten ihre genialsten
Kombinationen ganz in derselben Art, wie jeder
andere Spieler. Ich glaube vielmehr, daß der
von uns gezeigte Unterschied sich auch schon
bei den „gewöhnlichen" Spielern offenbart.
Der eine spielt korrekt, sachgemäß, der andere
verläßt sich auf seine Einfälle. Möglicherweise
verliert er darum häufig und spielt lange nicht
so gut und sicher wie der andere; und doch
lebt ein bescheidener genialer Zug in ihm. Wir
müssen uns deswegen vor dem Glauben hüten,
daß ein genialer Einschlag schon zu größeren
Leistungen führen müsse, als sie das Talent
fertig bringe. Nicht vom Wert der Leistungen
sprechen wir hier, sondern von menschlichen
Grundanlagen. Wohl dürfen wir aber sagen,
daß an sich in der genialen Begabung reichere
und weitere Möglichkeiten sich erschließen.
Sie ist unter günstigen Umständen entwicklungs-
fähiger. Darum ist es auch nicht zu verwundern,
daß die größten Meisterwerke, die staunende
Verehrung finden, eben Werke von Genies
sind; denn ein bloßes Talent kann nicht zu
diesen Höhen. Aber deshalb ist doch nicht
geniale Begabung nur ein höheres Stockwerk,
gleichsam dem Talent übergebaut. Sie ist ein
viel niedrigeres Stockwerk, wenn etwa die
elastische Leichtigkeit der Auffassung und die
mühelos sprudelnde Fülle der Einfälle sich mit
keiner strengen Selbstbesinnung, keiner
inneren Disziplin usw. paaren, ja geradezu zur
Flüchtigkeit verlocken, zu einemSich-zersplittern
und Sich-vergeuden. Das Volk hat ganz recht,
wenn es von „verkommenen Genies" spricht,
während das Talent dieser Gefahr weit weniger
ausgesetzt ist. Ziehen wir die Anwendung auf
den Künstler: beim Genialen und beim Talen-
XXIV. Juni 1921. 7