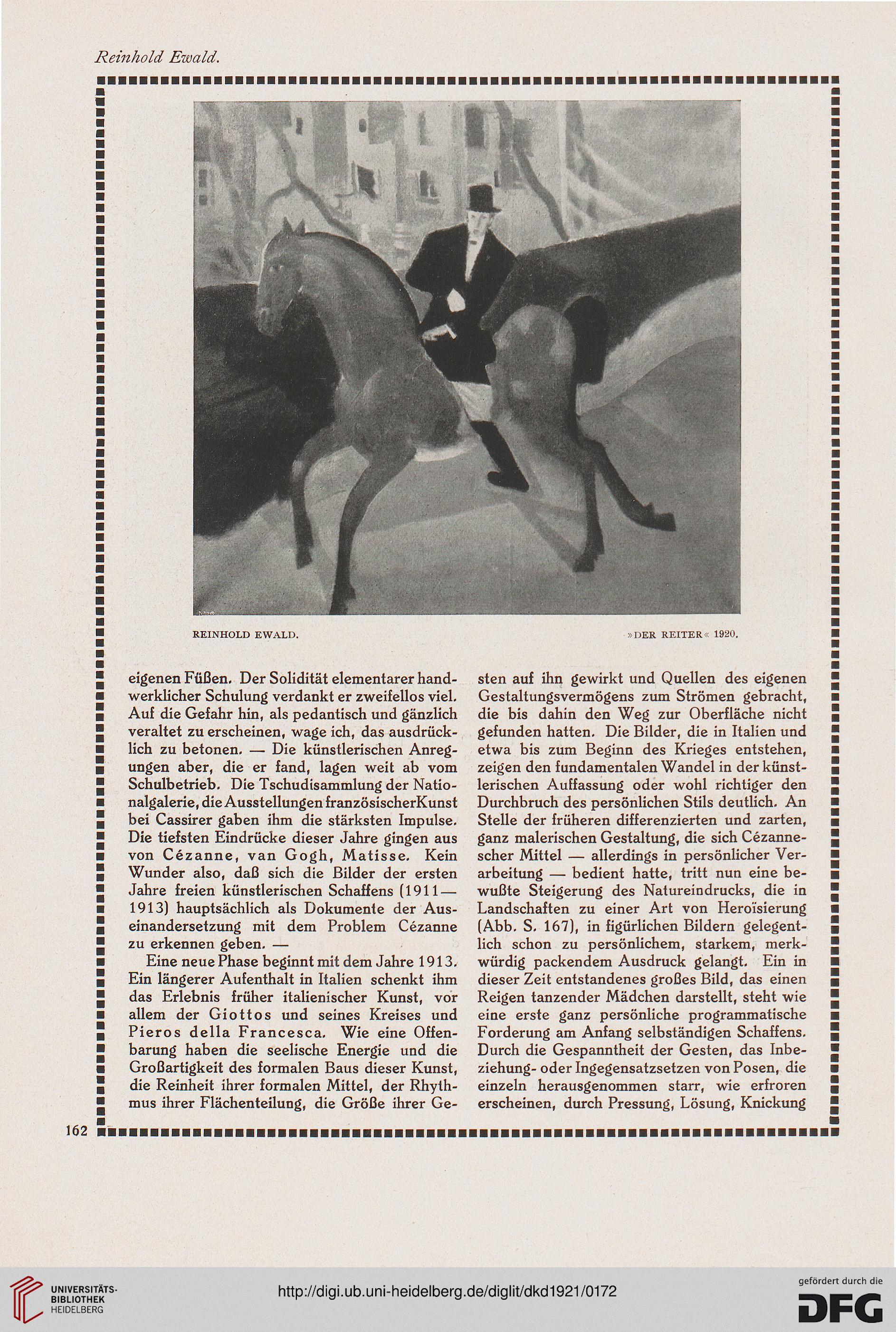Reinhold Ewald,
REINHOLD EWALD.
DER REITER« 1920.
eigenen Füßen. Der Solidität elementarer hand-
werklicher Schulung verdankt er zweifellos viel.
Auf die Gefahr hin, als pedantisch und gänzlich
veraltet zu erscheinen, wage ich, das ausdrück-
lich zu betonen. — Die künstlerischen Anreg-
ungen aber, die er fand, lagen weit ab vom
Schulbetrieb. Die Tschudisammlung der Natio-
nalgalerie, die Ausstellungen französischerKunst
bei Cassirer gaben ihm die stärksten Impulse.
Die tiefsten Eindrücke dieser Jahre gingen aus
von Cezanne, van Gogh, Matisse. Kein
Wunder also, daß sich die Bilder der ersten
Jahre freien künstlerischen Schaffens (1911 —
1913) hauptsächlich als Dokumente der Aus-
einandersetzung mit dem Problem Cezanne
zu erkennen geben. —
Eine neue Phase beginnt mit dem Jahre 1913.
Ein längerer Aufenthalt in Italien schenkt ihm
das Erlebnis früher italienischer Kunst, vor
allem der Giottos und seines Kreises und
Pieros della Francesca. Wie eine Offen-
barung haben die seelische Energie und die
Großartigkeit des formalen Baus dieser Kunst,
die Reinheit ihrer formalen Mittel, der Rhyth-
mus ihrer Flächenteilung, die Größe ihrer Ge-
sten auf ihn gewirkt und Quellen des eigenen
Gestaltungsvermögens zum Strömen gebracht,
die bis dahin den Weg zur Oberfläche nicht
gefunden hatten. Die Bilder, die in Italien und
etwa bis zum Beginn des Krieges entstehen,
zeigen den fundamentalen Wandel in der künst-
lerischen Auffassung oder wohl richtiger den
Durchbruch des persönlichen Stils deutlich. An
Stelle der früheren differenzierten und zarten,
ganz malerischen Gestaltung, die sich Cezanne-
scher Mittel — allerdings in persönlicher Ver-
arbeitung — bedient hatte, tritt nun eine be-
wußte Steigerung des Natureindrucks, die in
Landschaften zu einer Art von Heroi'sierung
(Abb. S. 167), in figürlichen Bildern gelegent-
lich schon zu persönlichem, starkem, merk-
würdig packendem Ausdruck gelangt. Ein in
dieser Zeit entstandenes großes Bild, das einen
Reigen tanzender Mädchen darstellt, steht wie
eine erste ganz persönliche programmatische
Forderung am Anfang selbständigen Schaffens.
Durch die Gespanntheit der Gesten, das Inbe-
ziehung- oder Ingegensatzsetzen von Posen, die
einzeln herausgenommen starr, wie erfroren
erscheinen, durch Pressung, Lösung, Knickung
REINHOLD EWALD.
DER REITER« 1920.
eigenen Füßen. Der Solidität elementarer hand-
werklicher Schulung verdankt er zweifellos viel.
Auf die Gefahr hin, als pedantisch und gänzlich
veraltet zu erscheinen, wage ich, das ausdrück-
lich zu betonen. — Die künstlerischen Anreg-
ungen aber, die er fand, lagen weit ab vom
Schulbetrieb. Die Tschudisammlung der Natio-
nalgalerie, die Ausstellungen französischerKunst
bei Cassirer gaben ihm die stärksten Impulse.
Die tiefsten Eindrücke dieser Jahre gingen aus
von Cezanne, van Gogh, Matisse. Kein
Wunder also, daß sich die Bilder der ersten
Jahre freien künstlerischen Schaffens (1911 —
1913) hauptsächlich als Dokumente der Aus-
einandersetzung mit dem Problem Cezanne
zu erkennen geben. —
Eine neue Phase beginnt mit dem Jahre 1913.
Ein längerer Aufenthalt in Italien schenkt ihm
das Erlebnis früher italienischer Kunst, vor
allem der Giottos und seines Kreises und
Pieros della Francesca. Wie eine Offen-
barung haben die seelische Energie und die
Großartigkeit des formalen Baus dieser Kunst,
die Reinheit ihrer formalen Mittel, der Rhyth-
mus ihrer Flächenteilung, die Größe ihrer Ge-
sten auf ihn gewirkt und Quellen des eigenen
Gestaltungsvermögens zum Strömen gebracht,
die bis dahin den Weg zur Oberfläche nicht
gefunden hatten. Die Bilder, die in Italien und
etwa bis zum Beginn des Krieges entstehen,
zeigen den fundamentalen Wandel in der künst-
lerischen Auffassung oder wohl richtiger den
Durchbruch des persönlichen Stils deutlich. An
Stelle der früheren differenzierten und zarten,
ganz malerischen Gestaltung, die sich Cezanne-
scher Mittel — allerdings in persönlicher Ver-
arbeitung — bedient hatte, tritt nun eine be-
wußte Steigerung des Natureindrucks, die in
Landschaften zu einer Art von Heroi'sierung
(Abb. S. 167), in figürlichen Bildern gelegent-
lich schon zu persönlichem, starkem, merk-
würdig packendem Ausdruck gelangt. Ein in
dieser Zeit entstandenes großes Bild, das einen
Reigen tanzender Mädchen darstellt, steht wie
eine erste ganz persönliche programmatische
Forderung am Anfang selbständigen Schaffens.
Durch die Gespanntheit der Gesten, das Inbe-
ziehung- oder Ingegensatzsetzen von Posen, die
einzeln herausgenommen starr, wie erfroren
erscheinen, durch Pressung, Lösung, Knickung