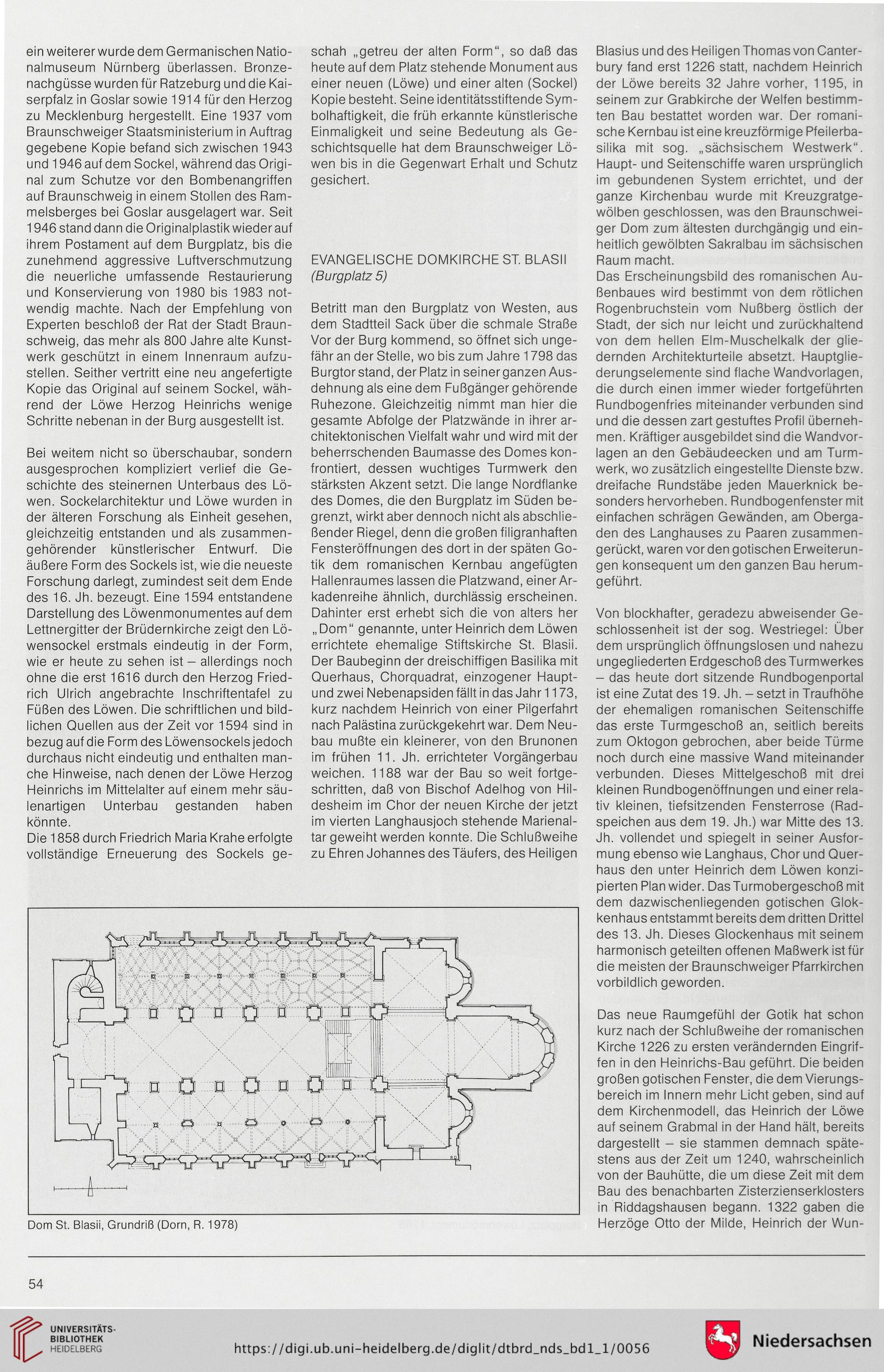ein weiterer wurde dem Germanischen Natio-
nalmuseum Nürnberg überlassen. Bronze-
nachgüsse wurden für Ratzeburg und die Kai-
serpfalz in Goslar sowie 1914 für den Herzog
zu Mecklenburg hergestellt. Eine 1937 vom
Braunschweiger Staatsministerium in Auftrag
gegebene Kopie befand sich zwischen 1943
und 1946 auf dem Sockel, während das Origi-
nal zum Schutze vor den Bombenangriffen
auf Braunschweig in einem Stollen des Ram-
meisberges bei Goslar ausgelagert war. Seit
1946 stand dann die Originalplastik wieder auf
ihrem Postament auf dem Burgplatz, bis die
zunehmend aggressive Luftverschmutzung
die neuerliche umfassende Restaurierung
und Konservierung von 1980 bis 1983 not-
wendig machte. Nach der Empfehlung von
Experten beschloß der Rat der Stadt Braun-
schweig, das mehr als 800 Jahre alte Kunst-
werk geschützt in einem Innenraum aufzu-
stellen. Seither vertritt eine neu angefertigte
Kopie das Original auf seinem Sockel, wäh-
rend der Löwe Herzog Heinrichs wenige
Schritte nebenan in der Burg ausgestellt ist.
Bei weitem nicht so überschaubar, sondern
ausgesprochen kompliziert verlief die Ge-
schichte des steinernen Unterbaus des Lö-
wen. Sockelarchitektur und Löwe wurden in
der älteren Forschung als Einheit gesehen,
gleichzeitig entstanden und als zusammen-
gehörender künstlerischer Entwurf. Die
äußere Form des Sockels ist, wie die neueste
Forschung darlegt, zumindest seit dem Ende
des 16. Jh. bezeugt. Eine 1594 entstandene
Darstellung des Löwenmonumentes auf dem
Lettnergitter der Brüdernkirche zeigt den Lö-
wensockel erstmals eindeutig in der Form,
wie er heute zu sehen ist - allerdings noch
ohne die erst 1616 durch den Herzog Fried-
rich Ulrich angebrachte Inschriftentafel zu
Füßen des Löwen. Die schriftlichen und bild-
lichen Quellen aus der Zeit vor 1594 sind in
bezug auf die Form des Löwensockelsjedoch
durchaus nicht eindeutig und enthalten man-
che Hinweise, nach denen der Löwe Herzog
Heinrichs im Mittelalter auf einem mehr säu-
lenartigen Unterbau gestanden haben
könnte.
Die 1858 durch Friedrich Maria Krähe erfolgte
vollständige Erneuerung des Sockels ge-
schah „getreu der alten Form“, so daß das
heute auf dem Platz stehende Monument aus
einer neuen (Löwe) und einer alten (Sockel)
Kopie besteht. Seine identitätsstiftende Sym-
bolhaftigkeit, die früh erkannte künstlerische
Einmaligkeit und seine Bedeutung als Ge-
schichtsquelle hat dem Braunschweiger Lö-
wen bis in die Gegenwart Erhalt und Schutz
gesichert.
EVANGELISCHE DOMKIRCHE ST. BLASII
(Burgplatz 5)
Betritt man den Burgplatz von Westen, aus
dem Stadtteil Sack über die schmale Straße
Vor der Burg kommend, so öffnet sich unge-
fähr an der Stelle, wo bis zum Jahre 1798 das
Burgtor stand, der Platz in seiner ganzen Aus-
dehnung als eine dem Fußgänger gehörende
Ruhezone. Gleichzeitig nimmt man hier die
gesamte Abfolge der Platzwände in ihrer ar-
chitektonischen Vielfalt wahr und wird mit der
beherrschenden Baumasse des Domes kon-
frontiert, dessen wuchtiges Turmwerk den
stärksten Akzent setzt. Die lange Nordflanke
des Domes, die den Burgplatz im Süden be-
grenzt, wirkt aber dennoch nicht als abschlie-
ßender Riegel, denn die großen filigranhaften
Fensteröffnungen des dort in der späten Go-
tik dem romanischen Kernbau angefügten
Hallenraumes lassen die Platzwand, einer Ar-
kadenreihe ähnlich, durchlässig erscheinen.
Dahinter erst erhebt sich die von alters her
„ Dom “ genannte, unter Heinrich dem Löwen
errichtete ehemalige Stiftskirche St. Blasii.
Der Baubeginn der dreischiffigen Basilika mit
Querhaus, Chorquadrat, einzogener Haupt-
und zwei Nebenapsiden fällt in das Jahr 1173,
kurz nachdem Heinrich von einer Pilgerfahrt
nach Palästina zurückgekehrt war. Dem Neu-
bau mußte ein kleinerer, von den Brunonen
im frühen 11. Jh. errichteter Vorgängerbau
weichen. 1188 war der Bau so weit fortge-
schritten, daß von Bischof Adelhog von Hil-
desheim im Chor der neuen Kirche der jetzt
im vierten Langhausjoch stehende Marienal-
tar geweiht werden konnte. Die Schlußweihe
zu Ehren Johannes des Täufers, des Heiligen
Dom St. Blasii, Grundriß (Dom, R. 1978)
Blasius und des Heiligen Thomas von Canter-
bury fand erst 1226 statt, nachdem Heinrich
der Löwe bereits 32 Jahre vorher, 1195, in
seinem zur Grabkirche der Welfen bestimm-
ten Bau bestattet worden war. Der romani-
sche Kernbau ist eine kreuzförmige Pfeilerba-
silika mit sog. „sächsischem Westwerk“.
Haupt- und Seitenschiffe waren ursprünglich
im gebundenen System errichtet, und der
ganze Kirchenbau wurde mit Kreuzgratge-
wölben geschlossen, was den Braunschwei-
ger Dom zum ältesten durchgängig und ein-
heitlich gewölbten Sakralbau im sächsischen
Raum macht.
Das Erscheinungsbild des romanischen Au-
ßenbaues wird bestimmt von dem rötlichen
Rogenbruchstein vom Nußberg östlich der
Stadt, der sich nur leicht und zurückhaltend
von dem hellen Elm-Muschelkalk der glie-
dernden Architekturteile absetzt. Hauptglie-
derungselemente sind flache Wandvorlagen,
die durch einen immer wieder fortgeführten
Rundbogenfries miteinander verbunden sind
und die dessen zart gestuftes Profil überneh-
men. Kräftiger ausgebildet sind die Wandvor-
lagen an den Gebäudeecken und am Turm-
werk, wo zusätzlich eingestellte Dienste bzw.
dreifache Rundstäbe jeden Mauerknick be-
sonders hervorheben. Rundbogenfenster mit
einfachen schrägen Gewänden, am Oberga-
den des Langhauses zu Paaren zusammen-
gerückt, waren vor den gotischen Erweiterun-
gen konsequent um den ganzen Bau herum-
geführt.
Von blockhafter, geradezu abweisender Ge-
schlossenheit ist der sog. Westriegel: Über
dem ursprünglich öffnungslosen und nahezu
ungegliederten Erdgeschoß des Turmwerkes
- das heute dort sitzende Rundbogenportal
ist eine Zutat des 19. Jh. - setzt in Traufhöhe
der ehemaligen romanischen Seitenschiffe
das erste Turmgeschoß an, seitlich bereits
zum Oktogon gebrochen, aber beide Türme
noch durch eine massive Wand miteinander
verbunden. Dieses Mittelgeschoß mit drei
kleinen Rundbogenöffnungen und einer rela-
tiv kleinen, tiefsitzenden Fensterrose (Rad-
speichen aus dem 19. Jh.) war Mitte des 13.
Jh. vollendet und spiegelt in seiner Ausfor-
mung ebenso wie Langhaus, Chor und Quer-
haus den unter Heinrich dem Löwen konzi-
pierten Plan wider. DasTurmobergeschoß mit
dem dazwischenliegenden gotischen Glok-
kenhaus entstammt bereits dem dritten Drittel
des 13. Jh. Dieses Glockenhaus mit seinem
harmonisch geteilten offenen Maßwerk ist für
die meisten der Braunschweiger Pfarrkirchen
vorbildlich geworden.
Das neue Raumgefühl der Gotik hat schon
kurz nach der Schlußweihe der romanischen
Kirche 1226 zu ersten verändernden Eingrif-
fen in den Heinrichs-Bau geführt. Die beiden
großen gotischen Fenster, die dem Vierungs-
bereich im Innern mehr Licht geben, sind auf
dem Kirchenmodell, das Heinrich der Löwe
auf seinem Grabmal in der Hand hält, bereits
dargestellt - sie stammen demnach späte-
stens aus der Zeit um 1240, wahrscheinlich
von der Bauhütte, die um diese Zeit mit dem
Bau des benachbarten Zisterzienserklosters
in Riddagshausen begann. 1322 gaben die
Herzöge Otto der Milde, Heinrich der Wun-
54
nalmuseum Nürnberg überlassen. Bronze-
nachgüsse wurden für Ratzeburg und die Kai-
serpfalz in Goslar sowie 1914 für den Herzog
zu Mecklenburg hergestellt. Eine 1937 vom
Braunschweiger Staatsministerium in Auftrag
gegebene Kopie befand sich zwischen 1943
und 1946 auf dem Sockel, während das Origi-
nal zum Schutze vor den Bombenangriffen
auf Braunschweig in einem Stollen des Ram-
meisberges bei Goslar ausgelagert war. Seit
1946 stand dann die Originalplastik wieder auf
ihrem Postament auf dem Burgplatz, bis die
zunehmend aggressive Luftverschmutzung
die neuerliche umfassende Restaurierung
und Konservierung von 1980 bis 1983 not-
wendig machte. Nach der Empfehlung von
Experten beschloß der Rat der Stadt Braun-
schweig, das mehr als 800 Jahre alte Kunst-
werk geschützt in einem Innenraum aufzu-
stellen. Seither vertritt eine neu angefertigte
Kopie das Original auf seinem Sockel, wäh-
rend der Löwe Herzog Heinrichs wenige
Schritte nebenan in der Burg ausgestellt ist.
Bei weitem nicht so überschaubar, sondern
ausgesprochen kompliziert verlief die Ge-
schichte des steinernen Unterbaus des Lö-
wen. Sockelarchitektur und Löwe wurden in
der älteren Forschung als Einheit gesehen,
gleichzeitig entstanden und als zusammen-
gehörender künstlerischer Entwurf. Die
äußere Form des Sockels ist, wie die neueste
Forschung darlegt, zumindest seit dem Ende
des 16. Jh. bezeugt. Eine 1594 entstandene
Darstellung des Löwenmonumentes auf dem
Lettnergitter der Brüdernkirche zeigt den Lö-
wensockel erstmals eindeutig in der Form,
wie er heute zu sehen ist - allerdings noch
ohne die erst 1616 durch den Herzog Fried-
rich Ulrich angebrachte Inschriftentafel zu
Füßen des Löwen. Die schriftlichen und bild-
lichen Quellen aus der Zeit vor 1594 sind in
bezug auf die Form des Löwensockelsjedoch
durchaus nicht eindeutig und enthalten man-
che Hinweise, nach denen der Löwe Herzog
Heinrichs im Mittelalter auf einem mehr säu-
lenartigen Unterbau gestanden haben
könnte.
Die 1858 durch Friedrich Maria Krähe erfolgte
vollständige Erneuerung des Sockels ge-
schah „getreu der alten Form“, so daß das
heute auf dem Platz stehende Monument aus
einer neuen (Löwe) und einer alten (Sockel)
Kopie besteht. Seine identitätsstiftende Sym-
bolhaftigkeit, die früh erkannte künstlerische
Einmaligkeit und seine Bedeutung als Ge-
schichtsquelle hat dem Braunschweiger Lö-
wen bis in die Gegenwart Erhalt und Schutz
gesichert.
EVANGELISCHE DOMKIRCHE ST. BLASII
(Burgplatz 5)
Betritt man den Burgplatz von Westen, aus
dem Stadtteil Sack über die schmale Straße
Vor der Burg kommend, so öffnet sich unge-
fähr an der Stelle, wo bis zum Jahre 1798 das
Burgtor stand, der Platz in seiner ganzen Aus-
dehnung als eine dem Fußgänger gehörende
Ruhezone. Gleichzeitig nimmt man hier die
gesamte Abfolge der Platzwände in ihrer ar-
chitektonischen Vielfalt wahr und wird mit der
beherrschenden Baumasse des Domes kon-
frontiert, dessen wuchtiges Turmwerk den
stärksten Akzent setzt. Die lange Nordflanke
des Domes, die den Burgplatz im Süden be-
grenzt, wirkt aber dennoch nicht als abschlie-
ßender Riegel, denn die großen filigranhaften
Fensteröffnungen des dort in der späten Go-
tik dem romanischen Kernbau angefügten
Hallenraumes lassen die Platzwand, einer Ar-
kadenreihe ähnlich, durchlässig erscheinen.
Dahinter erst erhebt sich die von alters her
„ Dom “ genannte, unter Heinrich dem Löwen
errichtete ehemalige Stiftskirche St. Blasii.
Der Baubeginn der dreischiffigen Basilika mit
Querhaus, Chorquadrat, einzogener Haupt-
und zwei Nebenapsiden fällt in das Jahr 1173,
kurz nachdem Heinrich von einer Pilgerfahrt
nach Palästina zurückgekehrt war. Dem Neu-
bau mußte ein kleinerer, von den Brunonen
im frühen 11. Jh. errichteter Vorgängerbau
weichen. 1188 war der Bau so weit fortge-
schritten, daß von Bischof Adelhog von Hil-
desheim im Chor der neuen Kirche der jetzt
im vierten Langhausjoch stehende Marienal-
tar geweiht werden konnte. Die Schlußweihe
zu Ehren Johannes des Täufers, des Heiligen
Dom St. Blasii, Grundriß (Dom, R. 1978)
Blasius und des Heiligen Thomas von Canter-
bury fand erst 1226 statt, nachdem Heinrich
der Löwe bereits 32 Jahre vorher, 1195, in
seinem zur Grabkirche der Welfen bestimm-
ten Bau bestattet worden war. Der romani-
sche Kernbau ist eine kreuzförmige Pfeilerba-
silika mit sog. „sächsischem Westwerk“.
Haupt- und Seitenschiffe waren ursprünglich
im gebundenen System errichtet, und der
ganze Kirchenbau wurde mit Kreuzgratge-
wölben geschlossen, was den Braunschwei-
ger Dom zum ältesten durchgängig und ein-
heitlich gewölbten Sakralbau im sächsischen
Raum macht.
Das Erscheinungsbild des romanischen Au-
ßenbaues wird bestimmt von dem rötlichen
Rogenbruchstein vom Nußberg östlich der
Stadt, der sich nur leicht und zurückhaltend
von dem hellen Elm-Muschelkalk der glie-
dernden Architekturteile absetzt. Hauptglie-
derungselemente sind flache Wandvorlagen,
die durch einen immer wieder fortgeführten
Rundbogenfries miteinander verbunden sind
und die dessen zart gestuftes Profil überneh-
men. Kräftiger ausgebildet sind die Wandvor-
lagen an den Gebäudeecken und am Turm-
werk, wo zusätzlich eingestellte Dienste bzw.
dreifache Rundstäbe jeden Mauerknick be-
sonders hervorheben. Rundbogenfenster mit
einfachen schrägen Gewänden, am Oberga-
den des Langhauses zu Paaren zusammen-
gerückt, waren vor den gotischen Erweiterun-
gen konsequent um den ganzen Bau herum-
geführt.
Von blockhafter, geradezu abweisender Ge-
schlossenheit ist der sog. Westriegel: Über
dem ursprünglich öffnungslosen und nahezu
ungegliederten Erdgeschoß des Turmwerkes
- das heute dort sitzende Rundbogenportal
ist eine Zutat des 19. Jh. - setzt in Traufhöhe
der ehemaligen romanischen Seitenschiffe
das erste Turmgeschoß an, seitlich bereits
zum Oktogon gebrochen, aber beide Türme
noch durch eine massive Wand miteinander
verbunden. Dieses Mittelgeschoß mit drei
kleinen Rundbogenöffnungen und einer rela-
tiv kleinen, tiefsitzenden Fensterrose (Rad-
speichen aus dem 19. Jh.) war Mitte des 13.
Jh. vollendet und spiegelt in seiner Ausfor-
mung ebenso wie Langhaus, Chor und Quer-
haus den unter Heinrich dem Löwen konzi-
pierten Plan wider. DasTurmobergeschoß mit
dem dazwischenliegenden gotischen Glok-
kenhaus entstammt bereits dem dritten Drittel
des 13. Jh. Dieses Glockenhaus mit seinem
harmonisch geteilten offenen Maßwerk ist für
die meisten der Braunschweiger Pfarrkirchen
vorbildlich geworden.
Das neue Raumgefühl der Gotik hat schon
kurz nach der Schlußweihe der romanischen
Kirche 1226 zu ersten verändernden Eingrif-
fen in den Heinrichs-Bau geführt. Die beiden
großen gotischen Fenster, die dem Vierungs-
bereich im Innern mehr Licht geben, sind auf
dem Kirchenmodell, das Heinrich der Löwe
auf seinem Grabmal in der Hand hält, bereits
dargestellt - sie stammen demnach späte-
stens aus der Zeit um 1240, wahrscheinlich
von der Bauhütte, die um diese Zeit mit dem
Bau des benachbarten Zisterzienserklosters
in Riddagshausen begann. 1322 gaben die
Herzöge Otto der Milde, Heinrich der Wun-
54