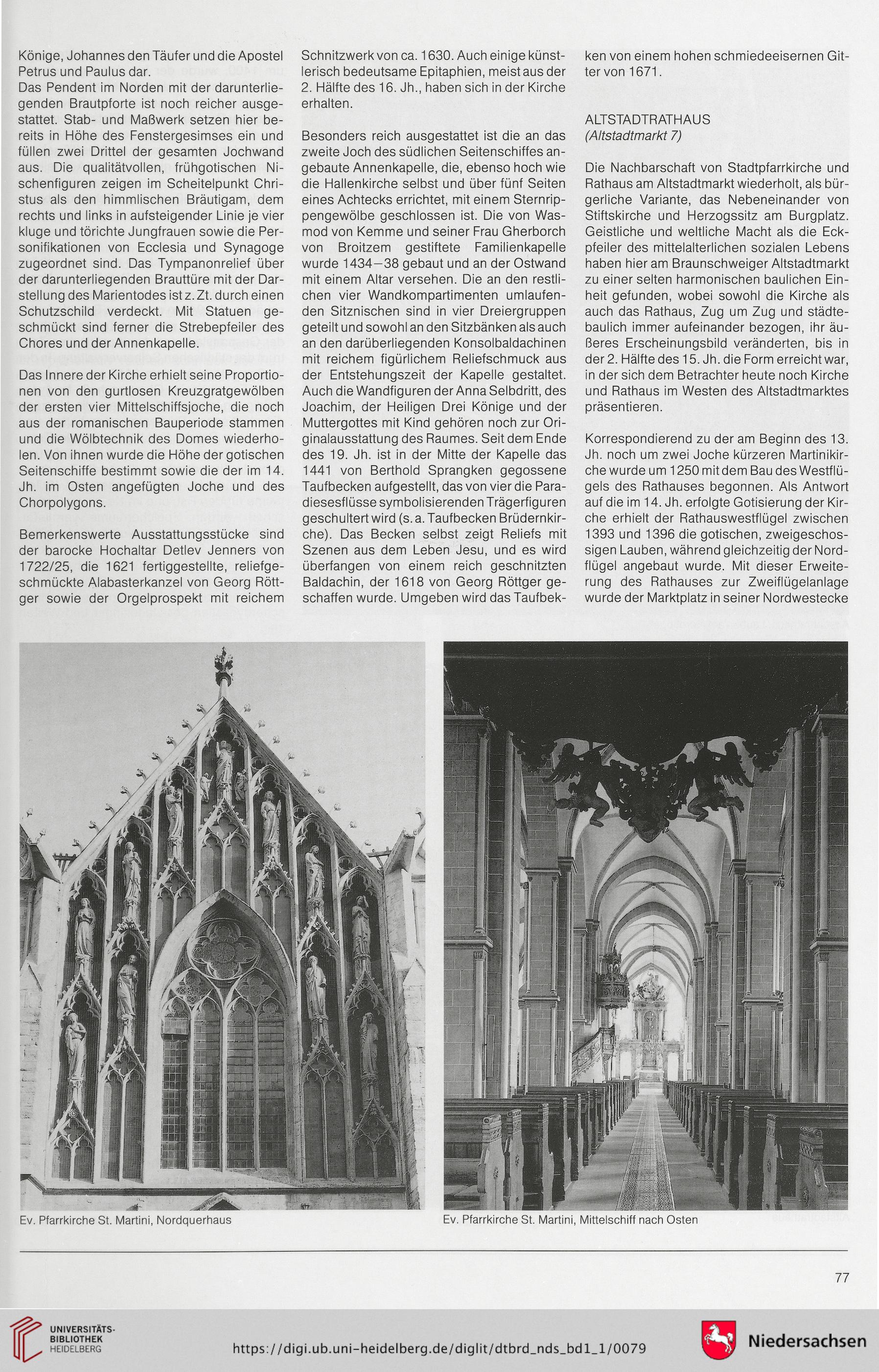Könige, Johannes den Täufer und die Apostel
Petrus und Paulus dar.
Das Pendent im Norden mit der darunterlie-
genden Brautpforte ist noch reicher ausge-
stattet. Stab- und Maßwerk setzen hier be-
reits in Höhe des Fenstergesimses ein und
füllen zwei Drittel der gesamten Jochwand
aus. Die qualitätvollen, frühgotischen Ni-
schenfiguren zeigen im Scheitelpunkt Chri-
stus als den himmlischen Bräutigam, dem
rechts und links in aufsteigender Linie je vier
kluge und törichte Jungfrauen sowie die Per-
sonifikationen von Ecclesia und Synagoge
zugeordnet sind. Das Tympanonrelief über
der darunterliegenden Brauttüre mit der Dar-
stellung des Marientodes istz.Zt. durch einen
Schutzschild verdeckt. Mit Statuen ge-
schmückt sind ferner die Strebepfeiler des
Chores und der Annenkapelle.
Das Innere der Kirche erhielt seine Proportio-
nen von den gurtlosen Kreuzgratgewölben
der ersten vier Mittelschiffsjoche, die noch
aus der romanischen Bauperiode stammen
und die Wölbtechnik des Domes wiederho-
len. Von ihnen wurde die Höhe der gotischen
Seitenschiffe bestimmt sowie die der im 14.
Jh. im Osten angefügten Joche und des
Chorpolygons.
Bemerkenswerte Ausstattungsstücke sind
der barocke Hochaltar Detlev Jenners von
1722/25, die 1621 fertiggestellte, reliefge-
schmückte Alabasterkanzel von Georg Rött-
ger sowie der Orgelprospekt mit reichem
Schnitzwerk von ca. 1630. Auch einige künst-
lerisch bedeutsame Epitaphien, meist aus der
2. Hälfte des 16. Jh., haben sich in der Kirche
erhalten.
Besonders reich ausgestattet ist die an das
zweite Joch des südlichen Seitenschiffes an-
gebaute Annenkapelle, die, ebenso hoch wie
die Hallenkirche selbst und über fünf Seiten
eines Achtecks errichtet, mit einem Sternrip-
pengewölbe geschlossen ist. Die von Was-
mod von Kemme und seiner Frau Gherborch
von Broitzem gestiftete Familienkapelle
wurde 1434-38 gebaut und an der Ostwand
mit einem Altar versehen. Die an den restli-
chen vier Wandkompartimenten umlaufen-
den Sitznischen sind in vier Dreiergruppen
geteilt und sowohl an den Sitzbänken als auch
an den darüberliegenden Konsolbaldachinen
mit reichem figürlichem Reliefschmuck aus
der Entstehungszeit der Kapelle gestaltet.
Auch die Wandfiguren der Anna Selbdritt, des
Joachim, der Heiligen Drei Könige und der
Muttergottes mit Kind gehören noch zur Ori-
ginalausstattung des Raumes. Seit dem Ende
des 19. Jh. ist in der Mitte der Kapelle das
1441 von Berthold Sprangken gegossene
Taufbecken aufgestellt, das von vier die Para-
diesesflüsse symbolisierenden T rägerfiguren
geschultert wird (s.a. Taufbecken Brüdernkir-
che). Das Becken selbst zeigt Reliefs mit
Szenen aus dem Leben Jesu, und es wird
überfangen von einem reich geschnitzten
Baldachin, der 1618 von Georg Röttger ge-
schaffen wurde. Umgeben wird das Taufbek-
ken von einem hohen schmiedeeisernen Git-
ter von 1671.
ALTSTADTRATHAUS
(Altstadtmarkt 7)
Die Nachbarschaft von Stadtpfarrkirche und
Rathaus am Altstadtmarktwiederholt, als bür-
gerliche Variante, das Nebeneinander von
Stiftskirche und Herzogssitz am Burgplatz.
Geistliche und weltliche Macht als die Eck-
pfeiler des mittelalterlichen sozialen Lebens
haben hier am Braunschweiger Altstadtmarkt
zu einer selten harmonischen baulichen Ein-
heit gefunden, wobei sowohl die Kirche als
auch das Rathaus, Zug um Zug und städte-
baulich immer aufeinander bezogen, ihr äu-
ßeres Erscheinungsbild veränderten, bis in
der 2. Hälfte des 15. Jh. die Form erreicht war,
in der sich dem Betrachter heute noch Kirche
und Rathaus im Westen des Altstadtmarktes
präsentieren.
Korrespondierend zu der am Beginn des 13.
Jh. noch um zwei Joche kürzeren Martinikir-
che wurde um 1250 mit dem Bau des Westflü-
gels des Rathauses begonnen. Als Antwort
auf die im 14. Jh. erfolgte Gotisierung der Kir-
che erhielt der Rathauswestflügel zwischen
1393 und 1396 die gotischen, zweigeschos-
sigen Lauben, während gleichzeitig der Nord-
flügel angebaut wurde. Mit dieser Erweite-
rung des Rathauses zur Zweiflügelanlage
wurde der Marktplatz in seiner Nordwestecke
Ev. Pfarrkirche St. Martini, Nordquerhaus
Ev. Pfarrkirche St. Martini, Mittelschiff nach Osten
77
Petrus und Paulus dar.
Das Pendent im Norden mit der darunterlie-
genden Brautpforte ist noch reicher ausge-
stattet. Stab- und Maßwerk setzen hier be-
reits in Höhe des Fenstergesimses ein und
füllen zwei Drittel der gesamten Jochwand
aus. Die qualitätvollen, frühgotischen Ni-
schenfiguren zeigen im Scheitelpunkt Chri-
stus als den himmlischen Bräutigam, dem
rechts und links in aufsteigender Linie je vier
kluge und törichte Jungfrauen sowie die Per-
sonifikationen von Ecclesia und Synagoge
zugeordnet sind. Das Tympanonrelief über
der darunterliegenden Brauttüre mit der Dar-
stellung des Marientodes istz.Zt. durch einen
Schutzschild verdeckt. Mit Statuen ge-
schmückt sind ferner die Strebepfeiler des
Chores und der Annenkapelle.
Das Innere der Kirche erhielt seine Proportio-
nen von den gurtlosen Kreuzgratgewölben
der ersten vier Mittelschiffsjoche, die noch
aus der romanischen Bauperiode stammen
und die Wölbtechnik des Domes wiederho-
len. Von ihnen wurde die Höhe der gotischen
Seitenschiffe bestimmt sowie die der im 14.
Jh. im Osten angefügten Joche und des
Chorpolygons.
Bemerkenswerte Ausstattungsstücke sind
der barocke Hochaltar Detlev Jenners von
1722/25, die 1621 fertiggestellte, reliefge-
schmückte Alabasterkanzel von Georg Rött-
ger sowie der Orgelprospekt mit reichem
Schnitzwerk von ca. 1630. Auch einige künst-
lerisch bedeutsame Epitaphien, meist aus der
2. Hälfte des 16. Jh., haben sich in der Kirche
erhalten.
Besonders reich ausgestattet ist die an das
zweite Joch des südlichen Seitenschiffes an-
gebaute Annenkapelle, die, ebenso hoch wie
die Hallenkirche selbst und über fünf Seiten
eines Achtecks errichtet, mit einem Sternrip-
pengewölbe geschlossen ist. Die von Was-
mod von Kemme und seiner Frau Gherborch
von Broitzem gestiftete Familienkapelle
wurde 1434-38 gebaut und an der Ostwand
mit einem Altar versehen. Die an den restli-
chen vier Wandkompartimenten umlaufen-
den Sitznischen sind in vier Dreiergruppen
geteilt und sowohl an den Sitzbänken als auch
an den darüberliegenden Konsolbaldachinen
mit reichem figürlichem Reliefschmuck aus
der Entstehungszeit der Kapelle gestaltet.
Auch die Wandfiguren der Anna Selbdritt, des
Joachim, der Heiligen Drei Könige und der
Muttergottes mit Kind gehören noch zur Ori-
ginalausstattung des Raumes. Seit dem Ende
des 19. Jh. ist in der Mitte der Kapelle das
1441 von Berthold Sprangken gegossene
Taufbecken aufgestellt, das von vier die Para-
diesesflüsse symbolisierenden T rägerfiguren
geschultert wird (s.a. Taufbecken Brüdernkir-
che). Das Becken selbst zeigt Reliefs mit
Szenen aus dem Leben Jesu, und es wird
überfangen von einem reich geschnitzten
Baldachin, der 1618 von Georg Röttger ge-
schaffen wurde. Umgeben wird das Taufbek-
ken von einem hohen schmiedeeisernen Git-
ter von 1671.
ALTSTADTRATHAUS
(Altstadtmarkt 7)
Die Nachbarschaft von Stadtpfarrkirche und
Rathaus am Altstadtmarktwiederholt, als bür-
gerliche Variante, das Nebeneinander von
Stiftskirche und Herzogssitz am Burgplatz.
Geistliche und weltliche Macht als die Eck-
pfeiler des mittelalterlichen sozialen Lebens
haben hier am Braunschweiger Altstadtmarkt
zu einer selten harmonischen baulichen Ein-
heit gefunden, wobei sowohl die Kirche als
auch das Rathaus, Zug um Zug und städte-
baulich immer aufeinander bezogen, ihr äu-
ßeres Erscheinungsbild veränderten, bis in
der 2. Hälfte des 15. Jh. die Form erreicht war,
in der sich dem Betrachter heute noch Kirche
und Rathaus im Westen des Altstadtmarktes
präsentieren.
Korrespondierend zu der am Beginn des 13.
Jh. noch um zwei Joche kürzeren Martinikir-
che wurde um 1250 mit dem Bau des Westflü-
gels des Rathauses begonnen. Als Antwort
auf die im 14. Jh. erfolgte Gotisierung der Kir-
che erhielt der Rathauswestflügel zwischen
1393 und 1396 die gotischen, zweigeschos-
sigen Lauben, während gleichzeitig der Nord-
flügel angebaut wurde. Mit dieser Erweite-
rung des Rathauses zur Zweiflügelanlage
wurde der Marktplatz in seiner Nordwestecke
Ev. Pfarrkirche St. Martini, Nordquerhaus
Ev. Pfarrkirche St. Martini, Mittelschiff nach Osten
77