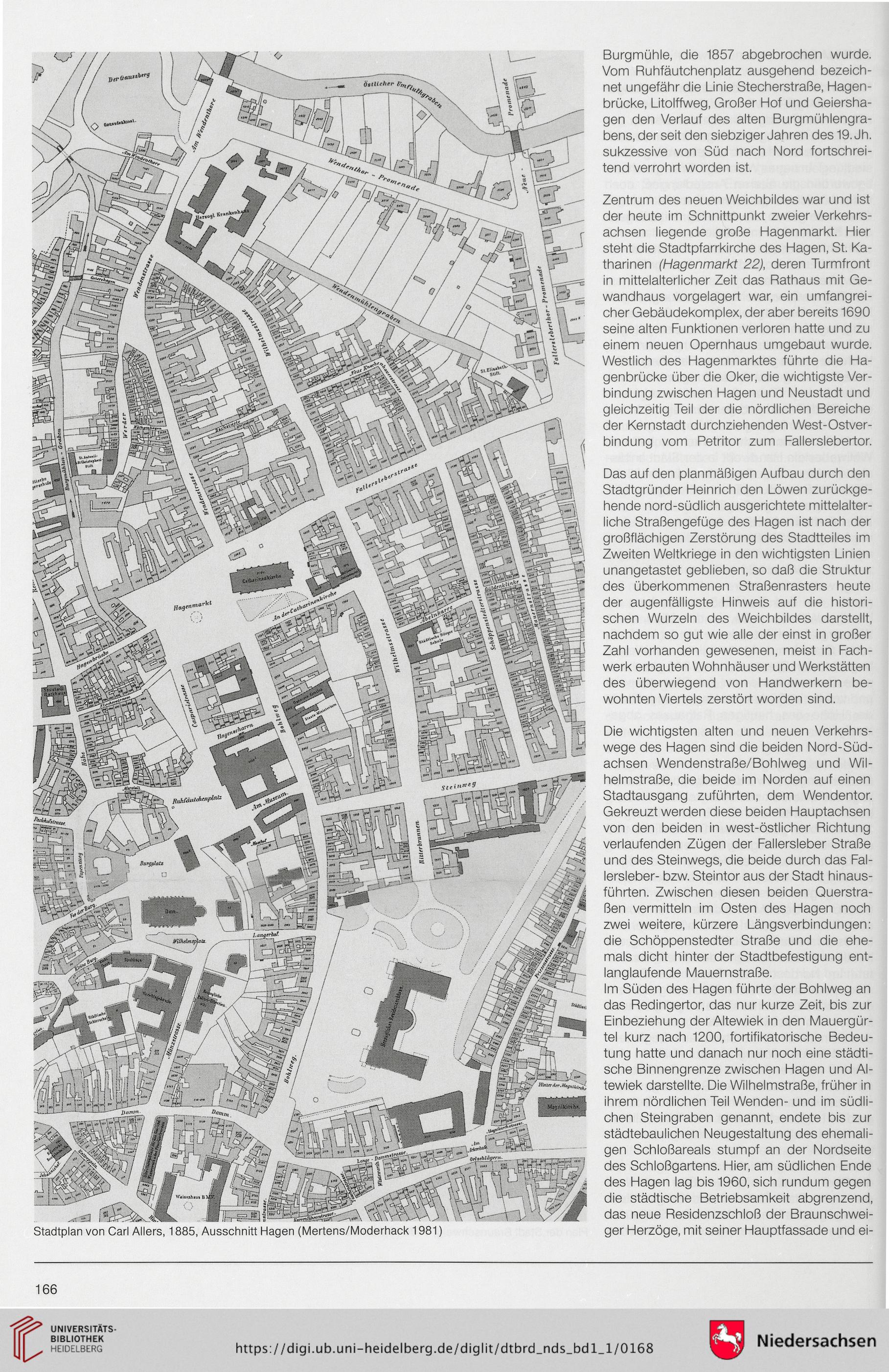Stadtplan von Carl Allers, 1885, Ausschnitt Hagen (Mertens/Moderhack 1981)
Burgmühle, die 1857 abgebrochen wurde.
Vom Ruhfäutchenplatz ausgehend bezeich-
net ungefähr die Linie Stecherstraße, Hagen-
brücke, Litolffweg, Großer Hof und Geiersha-
gen den Verlauf des alten Burgmühlengra-
bens, der seit den siebziger Jahren des 19. Jh.
sukzessive von Süd nach Nord fortschrei-
tend verrohrt worden ist.
Zentrum des neuen Weichbildes war und ist
der heute im Schnittpunkt zweier Verkehrs-
achsen liegende große Hagenmarkt. Hier
steht die Stadtpfarrkirche des Hagen, St. Ka-
tharinen (Hagenmarkt 22), deren Turmfront
in mittelalterlicher Zeit das Rathaus mit Ge-
wandhaus vorgelagert war, ein umfangrei-
cher Gebäudekomplex, der aber bereits 1690
seine alten Funktionen verloren hatte und zu
einem neuen Opernhaus umgebaut wurde.
Westlich des Hagenmarktes führte die Ha-
genbrücke über die Oker, die wichtigste Ver-
bindung zwischen Hagen und Neustadt und
gleichzeitig Teil der die nördlichen Bereiche
der Kernstadt durchziehenden West-Ostver-
bindung vom Petritor zum Fallerslebertor.
Das auf den planmäßigen Aufbau durch den
Stadtgründer Heinrich den Löwen zurückge-
hende nord-südlich ausgerichtete mittelalter-
liche Straßengefüge des Hagen ist nach der
großflächigen Zerstörung des Stadtteiles im
Zweiten Weltkriege in den wichtigsten Linien
unangetastet geblieben, so daß die Struktur
des überkommenen Straßenrasters heute
der augenfälligste Hinweis auf die histori-
schen Wurzeln des Weichbildes darstellt,
nachdem so gut wie alle der einst in großer
Zahl vorhanden gewesenen, meist in Fach-
werk erbauten Wohnhäuser und Werkstätten
des überwiegend von Handwerkern be-
wohnten Viertels zerstört worden sind.
Die wichtigsten alten und neuen Verkehrs-
wege des Hagen sind die beiden Nord-Süd-
achsen Wendenstraße/Bohlweg und Wil-
helmstraße, die beide im Norden auf einen
Stadtausgang zuführten, dem Wendentor.
Gekreuzt werden diese beiden Hauptachsen
von den beiden in west-östlicher Richtung
verlaufenden Zügen der Fallersleber Straße
und des Steinwegs, die beide durch das Fal-
lersleber- bzw. Steintor aus der Stadt hinaus-
führten. Zwischen diesen beiden Querstra-
ßen vermitteln im Osten des Hagen noch
zwei weitere, kürzere Längsverbindungen:
die Schöppenstedter Straße und die ehe-
mals dicht hinter der Stadtbefestigung ent-
langlaufende Mauernstraße.
Im Süden des Hagen führte der Bohlweg an
das Redingertor, das nur kurze Zeit, bis zur
Einbeziehung der Altewiek in den Mauergür-
tel kurz nach 1200, fortifikatorische Bedeu-
tung hatte und danach nur noch eine städti-
sche Binnengrenze zwischen Hagen und Al-
tewiek darstellte. Die Wilhelmstraße, früher in
ihrem nördlichen Teil Wenden- und im südli-
chen Steingraben genannt, endete bis zur
städtebaulichen Neugestaltung des ehemali-
gen Schloßareals stumpf an der Nordseite
des Schloßgartens. Hier, am südlichen Ende
des Hagen lag bis 1960, sich rundum gegen
die städtische Betriebsamkeit abgrenzend,
das neue Residenzschloß der Braunschwei-
ger Herzöge, mit seiner Hauptfassade und ei-
166
Burgmühle, die 1857 abgebrochen wurde.
Vom Ruhfäutchenplatz ausgehend bezeich-
net ungefähr die Linie Stecherstraße, Hagen-
brücke, Litolffweg, Großer Hof und Geiersha-
gen den Verlauf des alten Burgmühlengra-
bens, der seit den siebziger Jahren des 19. Jh.
sukzessive von Süd nach Nord fortschrei-
tend verrohrt worden ist.
Zentrum des neuen Weichbildes war und ist
der heute im Schnittpunkt zweier Verkehrs-
achsen liegende große Hagenmarkt. Hier
steht die Stadtpfarrkirche des Hagen, St. Ka-
tharinen (Hagenmarkt 22), deren Turmfront
in mittelalterlicher Zeit das Rathaus mit Ge-
wandhaus vorgelagert war, ein umfangrei-
cher Gebäudekomplex, der aber bereits 1690
seine alten Funktionen verloren hatte und zu
einem neuen Opernhaus umgebaut wurde.
Westlich des Hagenmarktes führte die Ha-
genbrücke über die Oker, die wichtigste Ver-
bindung zwischen Hagen und Neustadt und
gleichzeitig Teil der die nördlichen Bereiche
der Kernstadt durchziehenden West-Ostver-
bindung vom Petritor zum Fallerslebertor.
Das auf den planmäßigen Aufbau durch den
Stadtgründer Heinrich den Löwen zurückge-
hende nord-südlich ausgerichtete mittelalter-
liche Straßengefüge des Hagen ist nach der
großflächigen Zerstörung des Stadtteiles im
Zweiten Weltkriege in den wichtigsten Linien
unangetastet geblieben, so daß die Struktur
des überkommenen Straßenrasters heute
der augenfälligste Hinweis auf die histori-
schen Wurzeln des Weichbildes darstellt,
nachdem so gut wie alle der einst in großer
Zahl vorhanden gewesenen, meist in Fach-
werk erbauten Wohnhäuser und Werkstätten
des überwiegend von Handwerkern be-
wohnten Viertels zerstört worden sind.
Die wichtigsten alten und neuen Verkehrs-
wege des Hagen sind die beiden Nord-Süd-
achsen Wendenstraße/Bohlweg und Wil-
helmstraße, die beide im Norden auf einen
Stadtausgang zuführten, dem Wendentor.
Gekreuzt werden diese beiden Hauptachsen
von den beiden in west-östlicher Richtung
verlaufenden Zügen der Fallersleber Straße
und des Steinwegs, die beide durch das Fal-
lersleber- bzw. Steintor aus der Stadt hinaus-
führten. Zwischen diesen beiden Querstra-
ßen vermitteln im Osten des Hagen noch
zwei weitere, kürzere Längsverbindungen:
die Schöppenstedter Straße und die ehe-
mals dicht hinter der Stadtbefestigung ent-
langlaufende Mauernstraße.
Im Süden des Hagen führte der Bohlweg an
das Redingertor, das nur kurze Zeit, bis zur
Einbeziehung der Altewiek in den Mauergür-
tel kurz nach 1200, fortifikatorische Bedeu-
tung hatte und danach nur noch eine städti-
sche Binnengrenze zwischen Hagen und Al-
tewiek darstellte. Die Wilhelmstraße, früher in
ihrem nördlichen Teil Wenden- und im südli-
chen Steingraben genannt, endete bis zur
städtebaulichen Neugestaltung des ehemali-
gen Schloßareals stumpf an der Nordseite
des Schloßgartens. Hier, am südlichen Ende
des Hagen lag bis 1960, sich rundum gegen
die städtische Betriebsamkeit abgrenzend,
das neue Residenzschloß der Braunschwei-
ger Herzöge, mit seiner Hauptfassade und ei-
166