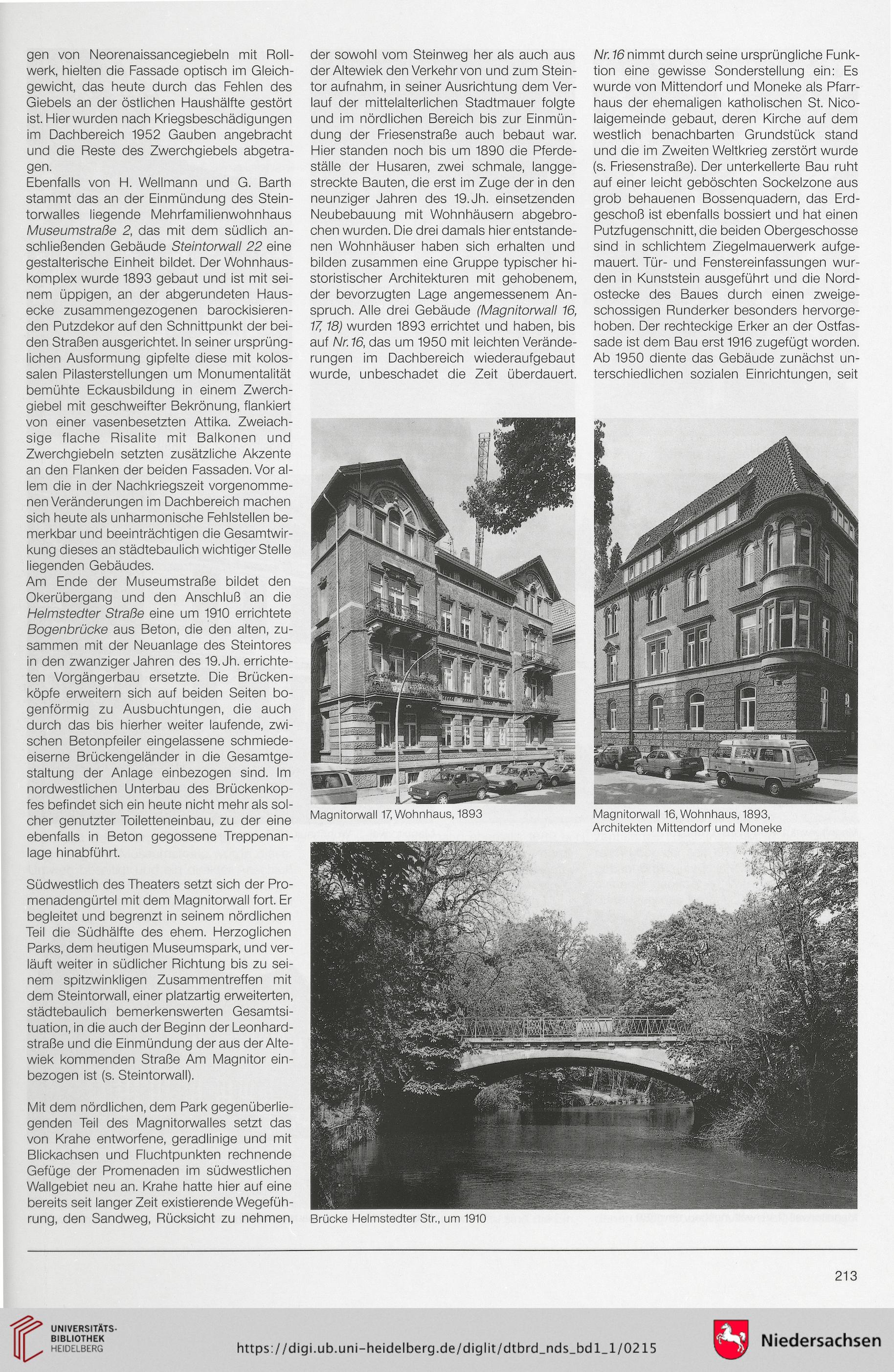gen von Neorenaissancegiebeln mit Roll-
werk, hielten die Fassade optisch im Gleich-
gewicht, das heute durch das Fehlen des
Giebels an der östlichen Flaushälfte gestört
ist. Hier wurden nach Kriegsbeschädigungen
im Dachbereich 1952 Gauben angebracht
und die Reste des Zwerchgiebels abgetra-
gen.
Ebenfalls von H. Wellmann und G. Barth
stammt das an der Einmündung des Stein-
torwalles liegende Mehrfamilienwohnhaus
Museumstraße 2, das mit dem südlich an-
schließenden Gebäude Steintorwall 22 eine
gestalterische Einheit bildet. Der Wohnhaus-
komplex wurde 1893 gebaut und ist mit sei-
nem üppigen, an der abgerundeten Haus-
ecke zusammengezogenen barockisieren-
den Putzdekor auf den Schnittpunkt der bei-
den Straßen ausgerichtet. In seiner ursprüng-
lichen Ausformung gipfelte diese mit kolos-
salen Pilasterstellungen um Monumentalität
bemühte Eckausbildung in einem Zwerch-
giebel mit geschweifter Bekrönung, flankiert
von einer vasenbesetzten Attika. Zweiach-
sige flache Risalite mit Baikonen und
Zwerchgiebeln setzten zusätzliche Akzente
an den Flanken der beiden Fassaden. Vor al-
lem die in der Nachkriegszeit vorgenomme-
nen Veränderungen im Dachbereich machen
sich heute als unharmonische Fehlstellen be-
merkbar und beeinträchtigen die Gesamtwir-
kung dieses an städtebaulich wichtiger Stelle
liegenden Gebäudes.
Am Ende der Museumstraße bildet den
Okerübergang und den Anschluß an die
Helmstedter Straße eine um 1910 errichtete
Bogenbrücke aus Beton, die den alten, zu-
sammen mit der Neuanlage des Steintores
in den zwanziger Jahren des 19. Jh. errichte-
ten Vorgängerbau ersetzte. Die Brücken-
köpfe erweitern sich auf beiden Seiten bo-
genförmig zu Ausbuchtungen, die auch
durch das bis hierher weiter laufende, zwi-
schen Betonpfeiler eingelassene schmiede-
eiserne Brückengeländer in die Gesamtge-
staltung der Anlage einbezogen sind. Im
nordwestlichen Unterbau des Brückenkop-
fes befindet sich ein heute nicht mehr als sol-
cher genutzter Toiletteneinbau, zu der eine
ebenfalls in Beton gegossene Treppenan-
lage hinabführt.
Südwestlich des Theaters setzt sich der Pro-
menadengürtel mit dem Magnitorwall fort. Er
begleitet und begrenzt in seinem nördlichen
Teil die Südhälfte des ehern. Herzoglichen
Parks, dem heutigen Museumspark, und ver-
läuft weiter in südlicher Richtung bis zu sei-
nem spitzwinkligen Zusammentreffen mit
dem Steintorwall, einer platzartig erweiterten,
städtebaulich bemerkenswerten Gesamtsi-
tuation, in die auch der Beginn der Leonhard-
straße und die Einmündung der aus der Alte-
wiek kommenden Straße Am Magnitor ein-
bezogen ist (s. Steintorwall).
Mit dem nördlichen, dem Park gegenüberlie-
genden Teil des Magnitorwalles setzt das
von Krähe entworfene, geradlinige und mit
Blickachsen und Fluchtpunkten rechnende
Gefüge der Promenaden im südwestlichen
Wallgebiet neu an. Krähe hatte hier auf eine
bereits seit langer Zeit existierende Wegefüh-
rung, den Sandweg, Rücksicht zu nehmen,
der sowohl vom Steinweg her als auch aus
der Altewiek den Verkehr von und zum Stein-
tor aufnahm, in seiner Ausrichtung dem Ver-
lauf der mittelalterlichen Stadtmauer folgte
und im nördlichen Bereich bis zur Einmün-
dung der Friesenstraße auch bebaut war.
Hier standen noch bis um 1890 die Pferde-
ställe der Husaren, zwei schmale, langge-
streckte Bauten, die erst im Zuge der in den
neunziger Jahren des 19. Jh. einsetzenden
Neubebauung mit Wohnhäusern abgebro-
chen wurden. Die drei damals hier entstande-
nen Wohnhäuser haben sich erhalten und
bilden zusammen eine Gruppe typischer hi-
storistischer Architekturen mit gehobenem,
der bevorzugten Lage angemessenem An-
spruch. Alle drei Gebäude (Magnitorwall 16,
17, 18) wurden 1893 errichtet und haben, bis
auf Nr. 16, das um 1950 mit leichten Verände-
rungen im Dachbereich wiederaufgebaut
wurde, unbeschadet die Zeit überdauert.
Nr. 16 nimmt durch seine ursprüngliche Funk-
tion eine gewisse Sonderstellung ein: Es
wurde von Mittendorf und Moneke als Pfarr-
haus der ehemaligen katholischen St. Nico-
laigemeinde gebaut, deren Kirche auf dem
westlich benachbarten Grundstück stand
und die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde
(s. Friesenstraße). Der unterkellerte Bau ruht
auf einer leicht geböschten Sockelzone aus
grob behauenen Bossenquadern, das Erd-
geschoß ist ebenfalls bossiert und hat einen
Putzfugenschnitt, die beiden Obergeschosse
sind in schlichtem Ziegelmauerwerk aufge-
mauert. Tür- und Fenstereinfassungen wur-
den in Kunststein ausgeführt und die Nord-
ostecke des Baues durch einen zweige-
schossigen Runderker besonders hervorge-
hoben. Der rechteckige Erker an der Ostfas-
sade ist dem Bau erst 1916 zugefügt worden.
Ab 1950 diente das Gebäude zunächst un-
terschiedlichen sozialen Einrichtungen, seit
Magnitorwall 17, Wohnhaus, 1893 Magnitorwall 16, Wohnhaus, 1893,
Architekten Mittendorf und Moneke
Brücke Helmstedter Str., um 1910
213
werk, hielten die Fassade optisch im Gleich-
gewicht, das heute durch das Fehlen des
Giebels an der östlichen Flaushälfte gestört
ist. Hier wurden nach Kriegsbeschädigungen
im Dachbereich 1952 Gauben angebracht
und die Reste des Zwerchgiebels abgetra-
gen.
Ebenfalls von H. Wellmann und G. Barth
stammt das an der Einmündung des Stein-
torwalles liegende Mehrfamilienwohnhaus
Museumstraße 2, das mit dem südlich an-
schließenden Gebäude Steintorwall 22 eine
gestalterische Einheit bildet. Der Wohnhaus-
komplex wurde 1893 gebaut und ist mit sei-
nem üppigen, an der abgerundeten Haus-
ecke zusammengezogenen barockisieren-
den Putzdekor auf den Schnittpunkt der bei-
den Straßen ausgerichtet. In seiner ursprüng-
lichen Ausformung gipfelte diese mit kolos-
salen Pilasterstellungen um Monumentalität
bemühte Eckausbildung in einem Zwerch-
giebel mit geschweifter Bekrönung, flankiert
von einer vasenbesetzten Attika. Zweiach-
sige flache Risalite mit Baikonen und
Zwerchgiebeln setzten zusätzliche Akzente
an den Flanken der beiden Fassaden. Vor al-
lem die in der Nachkriegszeit vorgenomme-
nen Veränderungen im Dachbereich machen
sich heute als unharmonische Fehlstellen be-
merkbar und beeinträchtigen die Gesamtwir-
kung dieses an städtebaulich wichtiger Stelle
liegenden Gebäudes.
Am Ende der Museumstraße bildet den
Okerübergang und den Anschluß an die
Helmstedter Straße eine um 1910 errichtete
Bogenbrücke aus Beton, die den alten, zu-
sammen mit der Neuanlage des Steintores
in den zwanziger Jahren des 19. Jh. errichte-
ten Vorgängerbau ersetzte. Die Brücken-
köpfe erweitern sich auf beiden Seiten bo-
genförmig zu Ausbuchtungen, die auch
durch das bis hierher weiter laufende, zwi-
schen Betonpfeiler eingelassene schmiede-
eiserne Brückengeländer in die Gesamtge-
staltung der Anlage einbezogen sind. Im
nordwestlichen Unterbau des Brückenkop-
fes befindet sich ein heute nicht mehr als sol-
cher genutzter Toiletteneinbau, zu der eine
ebenfalls in Beton gegossene Treppenan-
lage hinabführt.
Südwestlich des Theaters setzt sich der Pro-
menadengürtel mit dem Magnitorwall fort. Er
begleitet und begrenzt in seinem nördlichen
Teil die Südhälfte des ehern. Herzoglichen
Parks, dem heutigen Museumspark, und ver-
läuft weiter in südlicher Richtung bis zu sei-
nem spitzwinkligen Zusammentreffen mit
dem Steintorwall, einer platzartig erweiterten,
städtebaulich bemerkenswerten Gesamtsi-
tuation, in die auch der Beginn der Leonhard-
straße und die Einmündung der aus der Alte-
wiek kommenden Straße Am Magnitor ein-
bezogen ist (s. Steintorwall).
Mit dem nördlichen, dem Park gegenüberlie-
genden Teil des Magnitorwalles setzt das
von Krähe entworfene, geradlinige und mit
Blickachsen und Fluchtpunkten rechnende
Gefüge der Promenaden im südwestlichen
Wallgebiet neu an. Krähe hatte hier auf eine
bereits seit langer Zeit existierende Wegefüh-
rung, den Sandweg, Rücksicht zu nehmen,
der sowohl vom Steinweg her als auch aus
der Altewiek den Verkehr von und zum Stein-
tor aufnahm, in seiner Ausrichtung dem Ver-
lauf der mittelalterlichen Stadtmauer folgte
und im nördlichen Bereich bis zur Einmün-
dung der Friesenstraße auch bebaut war.
Hier standen noch bis um 1890 die Pferde-
ställe der Husaren, zwei schmale, langge-
streckte Bauten, die erst im Zuge der in den
neunziger Jahren des 19. Jh. einsetzenden
Neubebauung mit Wohnhäusern abgebro-
chen wurden. Die drei damals hier entstande-
nen Wohnhäuser haben sich erhalten und
bilden zusammen eine Gruppe typischer hi-
storistischer Architekturen mit gehobenem,
der bevorzugten Lage angemessenem An-
spruch. Alle drei Gebäude (Magnitorwall 16,
17, 18) wurden 1893 errichtet und haben, bis
auf Nr. 16, das um 1950 mit leichten Verände-
rungen im Dachbereich wiederaufgebaut
wurde, unbeschadet die Zeit überdauert.
Nr. 16 nimmt durch seine ursprüngliche Funk-
tion eine gewisse Sonderstellung ein: Es
wurde von Mittendorf und Moneke als Pfarr-
haus der ehemaligen katholischen St. Nico-
laigemeinde gebaut, deren Kirche auf dem
westlich benachbarten Grundstück stand
und die im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde
(s. Friesenstraße). Der unterkellerte Bau ruht
auf einer leicht geböschten Sockelzone aus
grob behauenen Bossenquadern, das Erd-
geschoß ist ebenfalls bossiert und hat einen
Putzfugenschnitt, die beiden Obergeschosse
sind in schlichtem Ziegelmauerwerk aufge-
mauert. Tür- und Fenstereinfassungen wur-
den in Kunststein ausgeführt und die Nord-
ostecke des Baues durch einen zweige-
schossigen Runderker besonders hervorge-
hoben. Der rechteckige Erker an der Ostfas-
sade ist dem Bau erst 1916 zugefügt worden.
Ab 1950 diente das Gebäude zunächst un-
terschiedlichen sozialen Einrichtungen, seit
Magnitorwall 17, Wohnhaus, 1893 Magnitorwall 16, Wohnhaus, 1893,
Architekten Mittendorf und Moneke
Brücke Helmstedter Str., um 1910
213