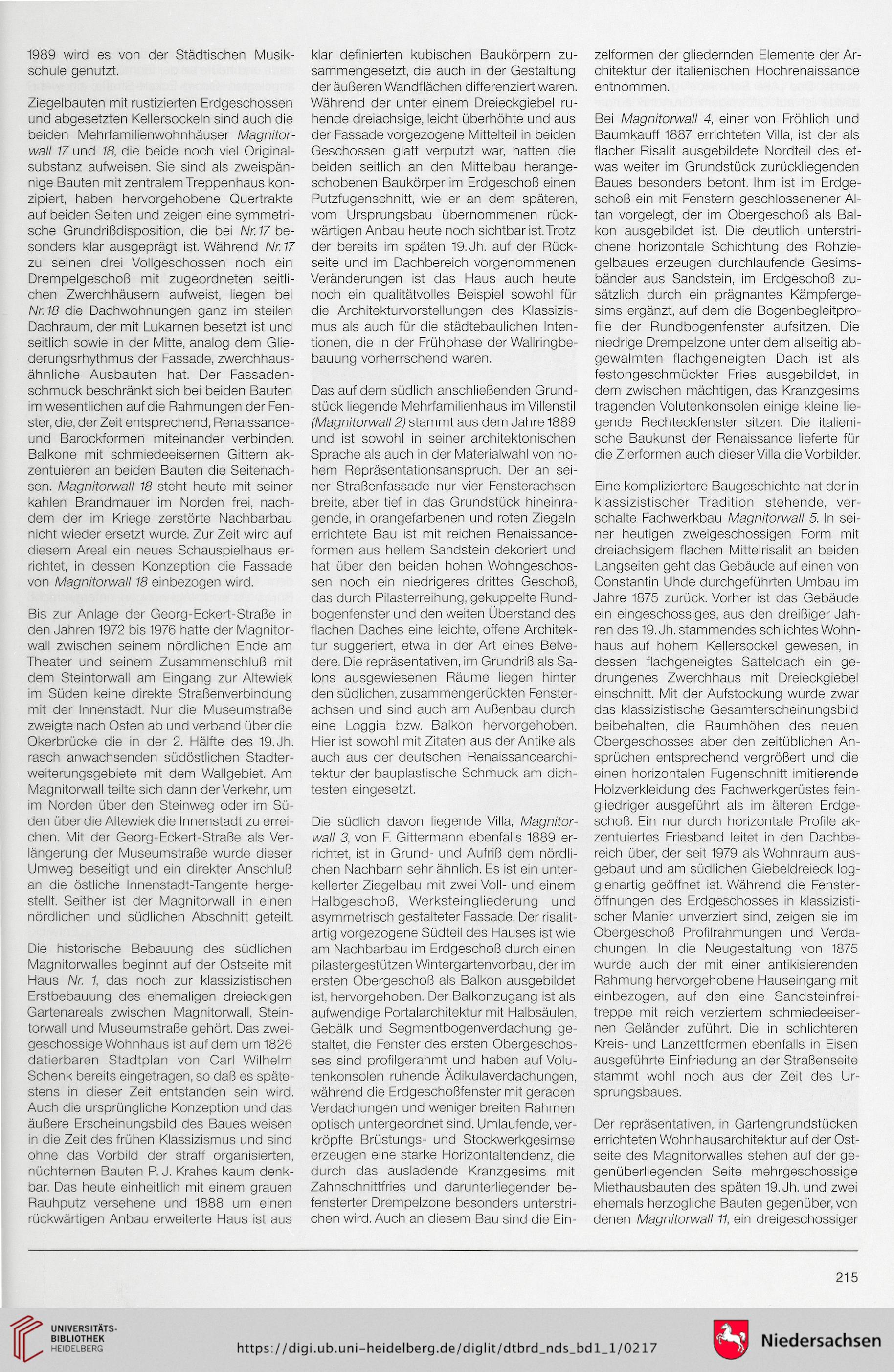1989 wird es von der Städtischen Musik-
schule genutzt.
Ziegelbauten mit rustizierten Erdgeschossen
und abgesetzten Kellersockeln sind auch die
beiden Mehrfamilienwohnhäuser Magnitor-
wall 17 und 18, die beide noch viel Original-
substanz aufweisen. Sie sind als zweispän-
nige Bauten mit zentralem Treppenhaus kon-
zipiert, haben hervorgehobene Quertrakte
auf beiden Seiten und zeigen eine symmetri-
sche Grundrißdisposition, die bei Nr. 17 be-
sonders klar ausgeprägt ist. Während Nr. 17
zu seinen drei Vollgeschossen noch ein
Drempelgeschoß mit zugeordneten seitli-
chen Zwerchhäusern aufweist, liegen bei
Nr.18 die Dachwohnungen ganz im steilen
Dachraum, der mit Lukarnen besetzt ist und
seitlich sowie in der Mitte, analog dem Glie-
derungsrhythmus der Fassade, zwerchhaus-
ähnliche Ausbauten hat. Der Fassaden-
schmuck beschränkt sich bei beiden Bauten
im wesentlichen auf die Rahmungen der Fen-
ster, die, derzeit entsprechend, Renaissance-
und Barockformen miteinander verbinden.
Balkone mit schmiedeeisernen Gittern ak-
zentuieren an beiden Bauten die Seitenach-
sen. Magnitorwall 18 steht heute mit seiner
kahlen Brandmauer im Norden frei, nach-
dem der im Kriege zerstörte Nachbarbau
nicht wieder ersetzt wurde. Zur Zeit wird auf
diesem Areal ein neues Schauspielhaus er-
richtet, in dessen Konzeption die Fassade
von Magnitorwall 18 einbezogen wird.
Bis zur Anlage der Georg-Eckert-Straße in
den Jahren 1972 bis 1976 hatte der Magnitor-
wall zwischen seinem nördlichen Ende am
Theater und seinem Zusammenschluß mit
dem Steintorwall am Eingang zur Altewiek
im Süden keine direkte Straßenverbindung
mit der Innenstadt. Nur die Museumstraße
zweigte nach Osten ab und verband über die
Okerbrücke die in der 2. Hälfte des 19. Jh.
rasch anwachsenden südöstlichen Stadter-
weiterungsgebiete mit dem Wallgebiet. Am
Magnitorwall teilte sich dann derVerkehr, um
im Norden über den Steinweg oder im Sü-
den über die Altewiek die Innenstadt zu errei-
chen. Mit der Georg-Eckert-Straße als Ver-
längerung der Museumstraße wurde dieser
Umweg beseitigt und ein direkter Anschluß
an die östliche Innenstadt-Tangente herge-
stellt. Seither ist der Magnitorwall in einen
nördlichen und südlichen Abschnitt geteilt.
Die historische Bebauung des südlichen
Magnitorwalles beginnt auf der Ostseite mit
Haus Nr. 1, das noch zur klassizistischen
Erstbebauung des ehemaligen dreieckigen
Gartenareals zwischen Magnitorwall, Stein-
torwall und Museumstraße gehört. Das zwei-
geschossige Wohnhaus ist auf dem um 1826
datierbaren Stadtplan von Carl Wilhelm
Schenk bereits eingetragen, so daß es späte-
stens in dieser Zeit entstanden sein wird.
Auch die ursprüngliche Konzeption und das
äußere Erscheinungsbild des Baues weisen
in die Zeit des frühen Klassizismus und sind
ohne das Vorbild der straff organisierten,
nüchternen Bauten P. J. Krahes kaum denk-
bar. Das heute einheitlich mit einem grauen
Rauhputz versehene und 1888 um einen
rückwärtigen Anbau erweiterte Haus ist aus
klar definierten kubischen Baukörpern zu-
sammengesetzt, die auch in der Gestaltung
der äußeren Wandflächen differenziert waren.
Während der unter einem Dreieckgiebel ru-
hende dreiachsige, leicht überhöhte und aus
der Fassade vorgezogene Mittelteil in beiden
Geschossen glatt verputzt war, hatten die
beiden seitlich an den Mittelbau herange-
schobenen Baukörper im Erdgeschoß einen
Putzfugenschnitt, wie er an dem späteren,
vom Ursprungsbau übernommenen rück-
wärtigen Anbau heute noch sichtbar ist.Trotz
der bereits im späten 19. Jh. auf der Rück-
seite und im Dachbereich vorgenommenen
Veränderungen ist das Haus auch heute
noch ein qualitätvolles Beispiel sowohl für
die Architekturvorstellungen des Klassizis-
mus als auch für die städtebaulichen Inten-
tionen, die in der Frühphase der Wallringbe-
bauung vorherrschend waren.
Das auf dem südlich anschließenden Grund-
stück liegende Mehrfamilienhaus im Villenstil
(Magnitorwall 2) stammt aus dem Jahre 1889
und ist sowohl in seiner architektonischen
Sprache als auch in der Materialwahl von ho-
hem Repräsentationsanspruch. Der an sei-
ner Straßenfassade nur vier Fensterachsen
breite, aber tief in das Grundstück hineinra-
gende, in orangefarbenen und roten Ziegeln
errichtete Bau ist mit reichen Renaissance-
formen aus hellem Sandstein dekoriert und
hat über den beiden hohen Wohngeschos-
sen noch ein niedrigeres drittes Geschoß,
das durch Pilasterreihung, gekuppelte Rund-
bogenfenster und den weiten Überstand des
flachen Daches eine leichte, offene Architek-
tur suggeriert, etwa in der Art eines Belve-
dere. Die repräsentativen, im Grundriß als Sa-
lons ausgewiesenen Räume liegen hinter
den südlichen, zusammengerückten Fenster-
achsen und sind auch am Außenbau durch
eine Loggia bzw. Balkon hervorgehoben.
Hier ist sowohl mit Zitaten aus der Antike als
auch aus der deutschen Renaissancearchi-
tektur der bauplastische Schmuck am dich-
testen eingesetzt.
Die südlich davon liegende Villa, Magnitor-
wall 3, von F. Gittermann ebenfalls 1889 er-
richtet, ist in Grund- und Aufriß dem nördli-
chen Nachbarn sehr ähnlich. Es ist ein unter-
kellerter Ziegelbau mit zwei Voll- und einem
Halbgeschoß, Werksteingliederung und
asymmetrisch gestalteter Fassade. Der risalit-
artig vorgezogene Südteil des Hauses ist wie
am Nachbarbau im Erdgeschoß durch einen
pilastergestützen Wintergartenvorbau, der im
ersten Obergeschoß als Balkon ausgebildet
ist, hervorgehoben. Der Balkonzugang ist als
aufwendige Portalarchitektur mit Halbsäulen,
Gebälk und Segmentbogenverdachung ge-
staltet, die Fenster des ersten Obergeschos-
ses sind profilgerahmt und haben auf Volu-
tenkonsolen ruhende Ädikulaverdachungen,
während die Erdgeschoßfenster mit geraden
Verdachungen und weniger breiten Rahmen
optisch untergeordnet sind. Umlaufende, ver-
knöpfte Brüstungs- und Stockwerkgesimse
erzeugen eine starke Horizontaltendenz, die
durch das ausladende Kranzgesims mit
Zahnschnittfries und darunterliegender be-
fensterter Drempelzone besonders unterstri-
chen wird. Auch an diesem Bau sind die Ein-
zelformen der gliedernden Elemente der Ar-
chitektur der italienischen Hochrenaissance
entnommen.
Bei Magnitorwall 4, einer von Fröhlich und
Baumkauff 1887 errichteten Villa, ist der als
flacher Risalit ausgebildete Nordteil des et-
was weiter im Grundstück zurückliegenden
Baues besonders betont. Ihm ist im Erdge-
schoß ein mit Fenstern geschlossenener Al-
tan vorgelegt, der im Obergeschoß als Bal-
kon ausgebildet ist. Die deutlich unterstri-
chene horizontale Schichtung des Rohzie-
gelbaues erzeugen durchlaufende Gesims-
bänder aus Sandstein, im Erdgeschoß zu-
sätzlich durch ein prägnantes Kämpferge-
sims ergänzt, auf dem die Bogenbegleitpro-
file der Rundbogenfenster aufsitzen. Die
niedrige Drempelzone unter dem allseitig ab-
gewalmten flachgeneigten Dach ist als
festongeschmückter Fries ausgebildet, in
dem zwischen mächtigen, das Kranzgesims
tragenden Volutenkonsolen einige kleine lie-
gende Rechteckfenster sitzen. Die italieni-
sche Baukunst der Renaissance lieferte für
die Zierformen auch dieser Villa die Vorbilder.
Eine kompliziertere Baugeschichte hat der in
klassizistischer Tradition stehende, ver-
schalte Fachwerkbau Magnitorwall 5. In sei-
ner heutigen zweigeschossigen Form mit
dreiachsigem flachen Mittelrisalit an beiden
Langseiten geht das Gebäude auf einen von
Constantin Uhde durchgeführten Umbau im
Jahre 1875 zurück. Vorher ist das Gebäude
ein eingeschossiges, aus den dreißiger Jah-
ren des 19. Jh. stammendes schlichtes Wohn-
haus auf hohem Kellersockel gewesen, in
dessen flachgeneigtes Satteldach ein ge-
drungenes Zwerchhaus mit Dreieckgiebel
einschnitt. Mit der Aufstockung wurde zwar
das klassizistische Gesamterscheinungsbild
beibehalten, die Raumhöhen des neuen
Obergeschosses aber den zeitüblichen An-
sprüchen entsprechend vergrößert und die
einen horizontalen Fugenschnitt imitierende
Holzverkleidung des Fachwerkgerüstes fein-
gliedriger ausgeführt als im älteren Erdge-
schoß. Ein nur durch horizontale Profile ak-
zentuiertes Friesband leitet in den Dachbe-
reich über, der seit 1979 als Wohnraum aus-
gebaut und am südlichen Giebeldreieck log-
gienartig geöffnet ist. Während die Fenster-
öffnungen des Erdgeschosses in klassizisti-
scher Manier unverziert sind, zeigen sie im
Obergeschoß Profilrahmungen und Verda-
chungen. In die Neugestaltung von 1875
wurde auch der mit einer antikisierenden
Rahmung hervorgehobene Hauseingang mit
einbezogen, auf den eine Sandsteinfrei-
treppe mit reich verziertem schmiedeeiser-
nen Geländer zuführt. Die in schlichteren
Kreis- und Lanzettformen ebenfalls in Eisen
ausgeführte Einfriedung an der Straßenseite
stammt wohl noch aus der Zeit des Ur-
sprungsbaues.
Der repräsentativen, in Gartengrundstücken
errichteten Wohnhausarchitektur auf der Ost-
seite des Magnitorwalles stehen auf der ge-
genüberliegenden Seite mehrgeschossige
Miethausbauten des späten 19. Jh. und zwei
ehemals herzogliche Bauten gegenüber, von
denen Magnitorwall 11, ein dreigeschossiger
215
schule genutzt.
Ziegelbauten mit rustizierten Erdgeschossen
und abgesetzten Kellersockeln sind auch die
beiden Mehrfamilienwohnhäuser Magnitor-
wall 17 und 18, die beide noch viel Original-
substanz aufweisen. Sie sind als zweispän-
nige Bauten mit zentralem Treppenhaus kon-
zipiert, haben hervorgehobene Quertrakte
auf beiden Seiten und zeigen eine symmetri-
sche Grundrißdisposition, die bei Nr. 17 be-
sonders klar ausgeprägt ist. Während Nr. 17
zu seinen drei Vollgeschossen noch ein
Drempelgeschoß mit zugeordneten seitli-
chen Zwerchhäusern aufweist, liegen bei
Nr.18 die Dachwohnungen ganz im steilen
Dachraum, der mit Lukarnen besetzt ist und
seitlich sowie in der Mitte, analog dem Glie-
derungsrhythmus der Fassade, zwerchhaus-
ähnliche Ausbauten hat. Der Fassaden-
schmuck beschränkt sich bei beiden Bauten
im wesentlichen auf die Rahmungen der Fen-
ster, die, derzeit entsprechend, Renaissance-
und Barockformen miteinander verbinden.
Balkone mit schmiedeeisernen Gittern ak-
zentuieren an beiden Bauten die Seitenach-
sen. Magnitorwall 18 steht heute mit seiner
kahlen Brandmauer im Norden frei, nach-
dem der im Kriege zerstörte Nachbarbau
nicht wieder ersetzt wurde. Zur Zeit wird auf
diesem Areal ein neues Schauspielhaus er-
richtet, in dessen Konzeption die Fassade
von Magnitorwall 18 einbezogen wird.
Bis zur Anlage der Georg-Eckert-Straße in
den Jahren 1972 bis 1976 hatte der Magnitor-
wall zwischen seinem nördlichen Ende am
Theater und seinem Zusammenschluß mit
dem Steintorwall am Eingang zur Altewiek
im Süden keine direkte Straßenverbindung
mit der Innenstadt. Nur die Museumstraße
zweigte nach Osten ab und verband über die
Okerbrücke die in der 2. Hälfte des 19. Jh.
rasch anwachsenden südöstlichen Stadter-
weiterungsgebiete mit dem Wallgebiet. Am
Magnitorwall teilte sich dann derVerkehr, um
im Norden über den Steinweg oder im Sü-
den über die Altewiek die Innenstadt zu errei-
chen. Mit der Georg-Eckert-Straße als Ver-
längerung der Museumstraße wurde dieser
Umweg beseitigt und ein direkter Anschluß
an die östliche Innenstadt-Tangente herge-
stellt. Seither ist der Magnitorwall in einen
nördlichen und südlichen Abschnitt geteilt.
Die historische Bebauung des südlichen
Magnitorwalles beginnt auf der Ostseite mit
Haus Nr. 1, das noch zur klassizistischen
Erstbebauung des ehemaligen dreieckigen
Gartenareals zwischen Magnitorwall, Stein-
torwall und Museumstraße gehört. Das zwei-
geschossige Wohnhaus ist auf dem um 1826
datierbaren Stadtplan von Carl Wilhelm
Schenk bereits eingetragen, so daß es späte-
stens in dieser Zeit entstanden sein wird.
Auch die ursprüngliche Konzeption und das
äußere Erscheinungsbild des Baues weisen
in die Zeit des frühen Klassizismus und sind
ohne das Vorbild der straff organisierten,
nüchternen Bauten P. J. Krahes kaum denk-
bar. Das heute einheitlich mit einem grauen
Rauhputz versehene und 1888 um einen
rückwärtigen Anbau erweiterte Haus ist aus
klar definierten kubischen Baukörpern zu-
sammengesetzt, die auch in der Gestaltung
der äußeren Wandflächen differenziert waren.
Während der unter einem Dreieckgiebel ru-
hende dreiachsige, leicht überhöhte und aus
der Fassade vorgezogene Mittelteil in beiden
Geschossen glatt verputzt war, hatten die
beiden seitlich an den Mittelbau herange-
schobenen Baukörper im Erdgeschoß einen
Putzfugenschnitt, wie er an dem späteren,
vom Ursprungsbau übernommenen rück-
wärtigen Anbau heute noch sichtbar ist.Trotz
der bereits im späten 19. Jh. auf der Rück-
seite und im Dachbereich vorgenommenen
Veränderungen ist das Haus auch heute
noch ein qualitätvolles Beispiel sowohl für
die Architekturvorstellungen des Klassizis-
mus als auch für die städtebaulichen Inten-
tionen, die in der Frühphase der Wallringbe-
bauung vorherrschend waren.
Das auf dem südlich anschließenden Grund-
stück liegende Mehrfamilienhaus im Villenstil
(Magnitorwall 2) stammt aus dem Jahre 1889
und ist sowohl in seiner architektonischen
Sprache als auch in der Materialwahl von ho-
hem Repräsentationsanspruch. Der an sei-
ner Straßenfassade nur vier Fensterachsen
breite, aber tief in das Grundstück hineinra-
gende, in orangefarbenen und roten Ziegeln
errichtete Bau ist mit reichen Renaissance-
formen aus hellem Sandstein dekoriert und
hat über den beiden hohen Wohngeschos-
sen noch ein niedrigeres drittes Geschoß,
das durch Pilasterreihung, gekuppelte Rund-
bogenfenster und den weiten Überstand des
flachen Daches eine leichte, offene Architek-
tur suggeriert, etwa in der Art eines Belve-
dere. Die repräsentativen, im Grundriß als Sa-
lons ausgewiesenen Räume liegen hinter
den südlichen, zusammengerückten Fenster-
achsen und sind auch am Außenbau durch
eine Loggia bzw. Balkon hervorgehoben.
Hier ist sowohl mit Zitaten aus der Antike als
auch aus der deutschen Renaissancearchi-
tektur der bauplastische Schmuck am dich-
testen eingesetzt.
Die südlich davon liegende Villa, Magnitor-
wall 3, von F. Gittermann ebenfalls 1889 er-
richtet, ist in Grund- und Aufriß dem nördli-
chen Nachbarn sehr ähnlich. Es ist ein unter-
kellerter Ziegelbau mit zwei Voll- und einem
Halbgeschoß, Werksteingliederung und
asymmetrisch gestalteter Fassade. Der risalit-
artig vorgezogene Südteil des Hauses ist wie
am Nachbarbau im Erdgeschoß durch einen
pilastergestützen Wintergartenvorbau, der im
ersten Obergeschoß als Balkon ausgebildet
ist, hervorgehoben. Der Balkonzugang ist als
aufwendige Portalarchitektur mit Halbsäulen,
Gebälk und Segmentbogenverdachung ge-
staltet, die Fenster des ersten Obergeschos-
ses sind profilgerahmt und haben auf Volu-
tenkonsolen ruhende Ädikulaverdachungen,
während die Erdgeschoßfenster mit geraden
Verdachungen und weniger breiten Rahmen
optisch untergeordnet sind. Umlaufende, ver-
knöpfte Brüstungs- und Stockwerkgesimse
erzeugen eine starke Horizontaltendenz, die
durch das ausladende Kranzgesims mit
Zahnschnittfries und darunterliegender be-
fensterter Drempelzone besonders unterstri-
chen wird. Auch an diesem Bau sind die Ein-
zelformen der gliedernden Elemente der Ar-
chitektur der italienischen Hochrenaissance
entnommen.
Bei Magnitorwall 4, einer von Fröhlich und
Baumkauff 1887 errichteten Villa, ist der als
flacher Risalit ausgebildete Nordteil des et-
was weiter im Grundstück zurückliegenden
Baues besonders betont. Ihm ist im Erdge-
schoß ein mit Fenstern geschlossenener Al-
tan vorgelegt, der im Obergeschoß als Bal-
kon ausgebildet ist. Die deutlich unterstri-
chene horizontale Schichtung des Rohzie-
gelbaues erzeugen durchlaufende Gesims-
bänder aus Sandstein, im Erdgeschoß zu-
sätzlich durch ein prägnantes Kämpferge-
sims ergänzt, auf dem die Bogenbegleitpro-
file der Rundbogenfenster aufsitzen. Die
niedrige Drempelzone unter dem allseitig ab-
gewalmten flachgeneigten Dach ist als
festongeschmückter Fries ausgebildet, in
dem zwischen mächtigen, das Kranzgesims
tragenden Volutenkonsolen einige kleine lie-
gende Rechteckfenster sitzen. Die italieni-
sche Baukunst der Renaissance lieferte für
die Zierformen auch dieser Villa die Vorbilder.
Eine kompliziertere Baugeschichte hat der in
klassizistischer Tradition stehende, ver-
schalte Fachwerkbau Magnitorwall 5. In sei-
ner heutigen zweigeschossigen Form mit
dreiachsigem flachen Mittelrisalit an beiden
Langseiten geht das Gebäude auf einen von
Constantin Uhde durchgeführten Umbau im
Jahre 1875 zurück. Vorher ist das Gebäude
ein eingeschossiges, aus den dreißiger Jah-
ren des 19. Jh. stammendes schlichtes Wohn-
haus auf hohem Kellersockel gewesen, in
dessen flachgeneigtes Satteldach ein ge-
drungenes Zwerchhaus mit Dreieckgiebel
einschnitt. Mit der Aufstockung wurde zwar
das klassizistische Gesamterscheinungsbild
beibehalten, die Raumhöhen des neuen
Obergeschosses aber den zeitüblichen An-
sprüchen entsprechend vergrößert und die
einen horizontalen Fugenschnitt imitierende
Holzverkleidung des Fachwerkgerüstes fein-
gliedriger ausgeführt als im älteren Erdge-
schoß. Ein nur durch horizontale Profile ak-
zentuiertes Friesband leitet in den Dachbe-
reich über, der seit 1979 als Wohnraum aus-
gebaut und am südlichen Giebeldreieck log-
gienartig geöffnet ist. Während die Fenster-
öffnungen des Erdgeschosses in klassizisti-
scher Manier unverziert sind, zeigen sie im
Obergeschoß Profilrahmungen und Verda-
chungen. In die Neugestaltung von 1875
wurde auch der mit einer antikisierenden
Rahmung hervorgehobene Hauseingang mit
einbezogen, auf den eine Sandsteinfrei-
treppe mit reich verziertem schmiedeeiser-
nen Geländer zuführt. Die in schlichteren
Kreis- und Lanzettformen ebenfalls in Eisen
ausgeführte Einfriedung an der Straßenseite
stammt wohl noch aus der Zeit des Ur-
sprungsbaues.
Der repräsentativen, in Gartengrundstücken
errichteten Wohnhausarchitektur auf der Ost-
seite des Magnitorwalles stehen auf der ge-
genüberliegenden Seite mehrgeschossige
Miethausbauten des späten 19. Jh. und zwei
ehemals herzogliche Bauten gegenüber, von
denen Magnitorwall 11, ein dreigeschossiger
215