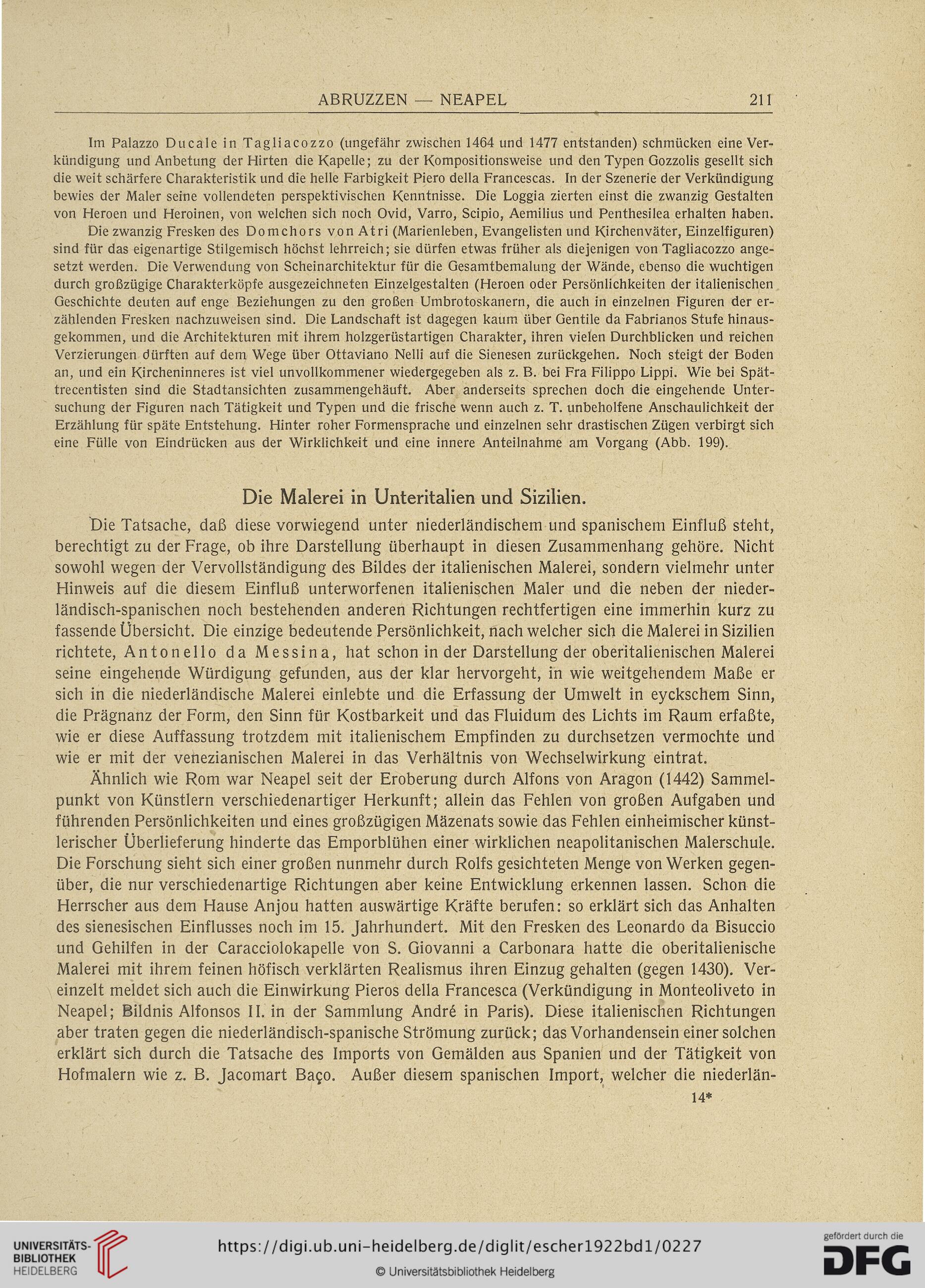ABRUZZEN — NEAPEL
211
Im Palazzo Ducale in Tagliacozzo (ungefähr zwischen 1464 und 1477 entstanden) schmücken eine Ver-
kündigung und Anbetung der Hirten die Kapelle; zu der Kompositionsweise und den Typen Gozzolis gesellt sich
die weit schärfere Charakteristik und die helle Farbigkeit Piero della Francescas. In der Szenerie der Verkündigung
bewies der Maler seine vollendeten perspektivischen Kenntnisse. Die Loggia zierten einst die zwanzig Gestalten
von Heroen und Heroinen, von welchen sich noch Ovid, Varro, Scipio, Aemilius und Penthesilea erhalten haben.
Die zwanzig Fresken des Domchors von Atri (Marienleben, Evangelisten und Kirchenväter, Einzelfiguren)
sind für das eigenartige Stilgemisch höchst lehrreich; sie dürfen etwas früher als diejenigen von Tagliacozzo ange-
setzt werden. Die Verwendung von Scheinarchitektur für die Gesamtbemalung der Wände, ebenso die wuchtigen
durch großzügige Charakterköpfe ausgezeichneten Einzelgestalten (Heroen oder Persönlichkeiten der italienischen
Geschichte deuten auf enge Beziehungen zu den großen Umbrotoskanern, die auch in einzelnen Figuren der er-
zählenden Fresken nachzuweisen sind. Die Landschaft ist dagegen kaum über Gentile da Fabrianos Stufe hinaus-
gekommen, und die Architekturen mit ihrem holzgerüstartigen Charakter, ihren vielen Durchblicken und reichen
Verzierungen dürften auf dem Wege über Ottaviano Nelli auf die Sienesen zurückgehen. Noch steigt der Boden
an, und ein Kircheninneres ist viel unvollkommener wiedergegeben als z. B. bei Fra Filippo Lippi. Wie bei Spät-
trecentisten sind die Stadtansichten zusammengehäuft. Aber anderseits sprechen doch die eingehende Unter-
suchung der Figuren nach Tätigkeit und Typen und die frische wenn auch z. T. unbeholfene Anschaulichkeit der
Erzählung für späte Entstehung. Hinter roher Formensprache und einzelnen sehr drastischen Zügen verbirgt sich
eine Fülle von Eindrücken aus der Wirklichkeit und eine innere Anteilnahme am Vorgang (Abb. 199).
Die Malerei in Unteritalien und Sizilien.
Die Tatsache, daß diese vorwiegend unter niederländischem und spanischem Einfluß steht,
berechtigt zu der Frage, ob ihre Darstellung überhaupt in diesen Zusammenhang gehöre. Nicht
sowohl wegen der Vervollständigung des Bildes der italienischen Malerei, sondern vielmehr unter
Hinweis auf die diesem Einfluß unterworfenen italienischen Maler und die neben der nieder-
ländisch-spanischen noch bestehenden anderen Richtungen rechtfertigen eine immerhin kurz zu
fassende Übersicht. Die einzige bedeutende Persönlichkeit, nach welcher sich die Malerei in Sizilien
richtete, Antonello da Messina, hat schon in der Darstellung der oberitalienischen Malerei
seine eingehende Würdigung gefunden, aus der klar hervorgeht, in wie weitgehendem Maße er
sich in die niederländische Malerei einlebte und die Erfassung der Umwelt in eyckschem Sinn,
die Prägnanz der Form, den Sinn für Kostbarkeit und das Fluidum des Lichts im Raum erfaßte,
wie er diese Auffassung trotzdem mit italienischem Empfinden zu durchsetzen vermochte und
wie er mit der venezianischen Malerei in das Verhältnis von Wechselwirkung eintrat.
Ähnlich wie Rom war Neapel seit der Eroberung durch Alfons von Aragon (1442) Sammel-
punkt von Künstlern verschiedenartiger Herkunft; allein das Fehlen von großen Aufgaben und
führenden Persönlichkeiten und eines großzügigen Mäzenats sowie das Fehlen einheimischer künst-
lerischer Überlieferung hinderte das Emporblühen einer wirklichen neapolitanischen Malerschule.
Die Forschung sieht sich einer großen nunmehr durch Rolfs gesichteten Menge von Werken gegen-
über, die nur verschiedenartige Richtungen aber keine Entwicklung erkennen lassen. Schon die
Herrscher aus dem Hause Anjou hatten auswärtige Kräfte berufen: so erklärt sich das Anhalten
des sienesischen Einflusses noch im 15. Jahrhundert. Mit den Fresken des Leonardo da Bisuccio
und Gehilfen in der Caracciolokapelle von S. Giovanni a Carbonara hatte die oberitalienische
Malerei mit ihrem feinen höfisch verklärten Realismus ihren Einzug gehalten (gegen 1430). Ver-
einzelt meldet sich auch die Einwirkung Pieros della Francesca (Verkündigung in Monteoliveto in
Neapel; Bildnis Alfonsos II. in der Sammlung AndrS in Paris). Diese italienischen Richtungen
aber traten gegen die niederländisch-spanische Strömung zurück; das Vorhandensein einer solchen
erklärt sich durch die Tatsache des Imports von Gemälden aus Spanien und der Tätigkeit von
Hofmalern wie z. B. Jacomart Ba?o. Außer diesem spanischen Import, welcher die niederlän-
14*
211
Im Palazzo Ducale in Tagliacozzo (ungefähr zwischen 1464 und 1477 entstanden) schmücken eine Ver-
kündigung und Anbetung der Hirten die Kapelle; zu der Kompositionsweise und den Typen Gozzolis gesellt sich
die weit schärfere Charakteristik und die helle Farbigkeit Piero della Francescas. In der Szenerie der Verkündigung
bewies der Maler seine vollendeten perspektivischen Kenntnisse. Die Loggia zierten einst die zwanzig Gestalten
von Heroen und Heroinen, von welchen sich noch Ovid, Varro, Scipio, Aemilius und Penthesilea erhalten haben.
Die zwanzig Fresken des Domchors von Atri (Marienleben, Evangelisten und Kirchenväter, Einzelfiguren)
sind für das eigenartige Stilgemisch höchst lehrreich; sie dürfen etwas früher als diejenigen von Tagliacozzo ange-
setzt werden. Die Verwendung von Scheinarchitektur für die Gesamtbemalung der Wände, ebenso die wuchtigen
durch großzügige Charakterköpfe ausgezeichneten Einzelgestalten (Heroen oder Persönlichkeiten der italienischen
Geschichte deuten auf enge Beziehungen zu den großen Umbrotoskanern, die auch in einzelnen Figuren der er-
zählenden Fresken nachzuweisen sind. Die Landschaft ist dagegen kaum über Gentile da Fabrianos Stufe hinaus-
gekommen, und die Architekturen mit ihrem holzgerüstartigen Charakter, ihren vielen Durchblicken und reichen
Verzierungen dürften auf dem Wege über Ottaviano Nelli auf die Sienesen zurückgehen. Noch steigt der Boden
an, und ein Kircheninneres ist viel unvollkommener wiedergegeben als z. B. bei Fra Filippo Lippi. Wie bei Spät-
trecentisten sind die Stadtansichten zusammengehäuft. Aber anderseits sprechen doch die eingehende Unter-
suchung der Figuren nach Tätigkeit und Typen und die frische wenn auch z. T. unbeholfene Anschaulichkeit der
Erzählung für späte Entstehung. Hinter roher Formensprache und einzelnen sehr drastischen Zügen verbirgt sich
eine Fülle von Eindrücken aus der Wirklichkeit und eine innere Anteilnahme am Vorgang (Abb. 199).
Die Malerei in Unteritalien und Sizilien.
Die Tatsache, daß diese vorwiegend unter niederländischem und spanischem Einfluß steht,
berechtigt zu der Frage, ob ihre Darstellung überhaupt in diesen Zusammenhang gehöre. Nicht
sowohl wegen der Vervollständigung des Bildes der italienischen Malerei, sondern vielmehr unter
Hinweis auf die diesem Einfluß unterworfenen italienischen Maler und die neben der nieder-
ländisch-spanischen noch bestehenden anderen Richtungen rechtfertigen eine immerhin kurz zu
fassende Übersicht. Die einzige bedeutende Persönlichkeit, nach welcher sich die Malerei in Sizilien
richtete, Antonello da Messina, hat schon in der Darstellung der oberitalienischen Malerei
seine eingehende Würdigung gefunden, aus der klar hervorgeht, in wie weitgehendem Maße er
sich in die niederländische Malerei einlebte und die Erfassung der Umwelt in eyckschem Sinn,
die Prägnanz der Form, den Sinn für Kostbarkeit und das Fluidum des Lichts im Raum erfaßte,
wie er diese Auffassung trotzdem mit italienischem Empfinden zu durchsetzen vermochte und
wie er mit der venezianischen Malerei in das Verhältnis von Wechselwirkung eintrat.
Ähnlich wie Rom war Neapel seit der Eroberung durch Alfons von Aragon (1442) Sammel-
punkt von Künstlern verschiedenartiger Herkunft; allein das Fehlen von großen Aufgaben und
führenden Persönlichkeiten und eines großzügigen Mäzenats sowie das Fehlen einheimischer künst-
lerischer Überlieferung hinderte das Emporblühen einer wirklichen neapolitanischen Malerschule.
Die Forschung sieht sich einer großen nunmehr durch Rolfs gesichteten Menge von Werken gegen-
über, die nur verschiedenartige Richtungen aber keine Entwicklung erkennen lassen. Schon die
Herrscher aus dem Hause Anjou hatten auswärtige Kräfte berufen: so erklärt sich das Anhalten
des sienesischen Einflusses noch im 15. Jahrhundert. Mit den Fresken des Leonardo da Bisuccio
und Gehilfen in der Caracciolokapelle von S. Giovanni a Carbonara hatte die oberitalienische
Malerei mit ihrem feinen höfisch verklärten Realismus ihren Einzug gehalten (gegen 1430). Ver-
einzelt meldet sich auch die Einwirkung Pieros della Francesca (Verkündigung in Monteoliveto in
Neapel; Bildnis Alfonsos II. in der Sammlung AndrS in Paris). Diese italienischen Richtungen
aber traten gegen die niederländisch-spanische Strömung zurück; das Vorhandensein einer solchen
erklärt sich durch die Tatsache des Imports von Gemälden aus Spanien und der Tätigkeit von
Hofmalern wie z. B. Jacomart Ba?o. Außer diesem spanischen Import, welcher die niederlän-
14*