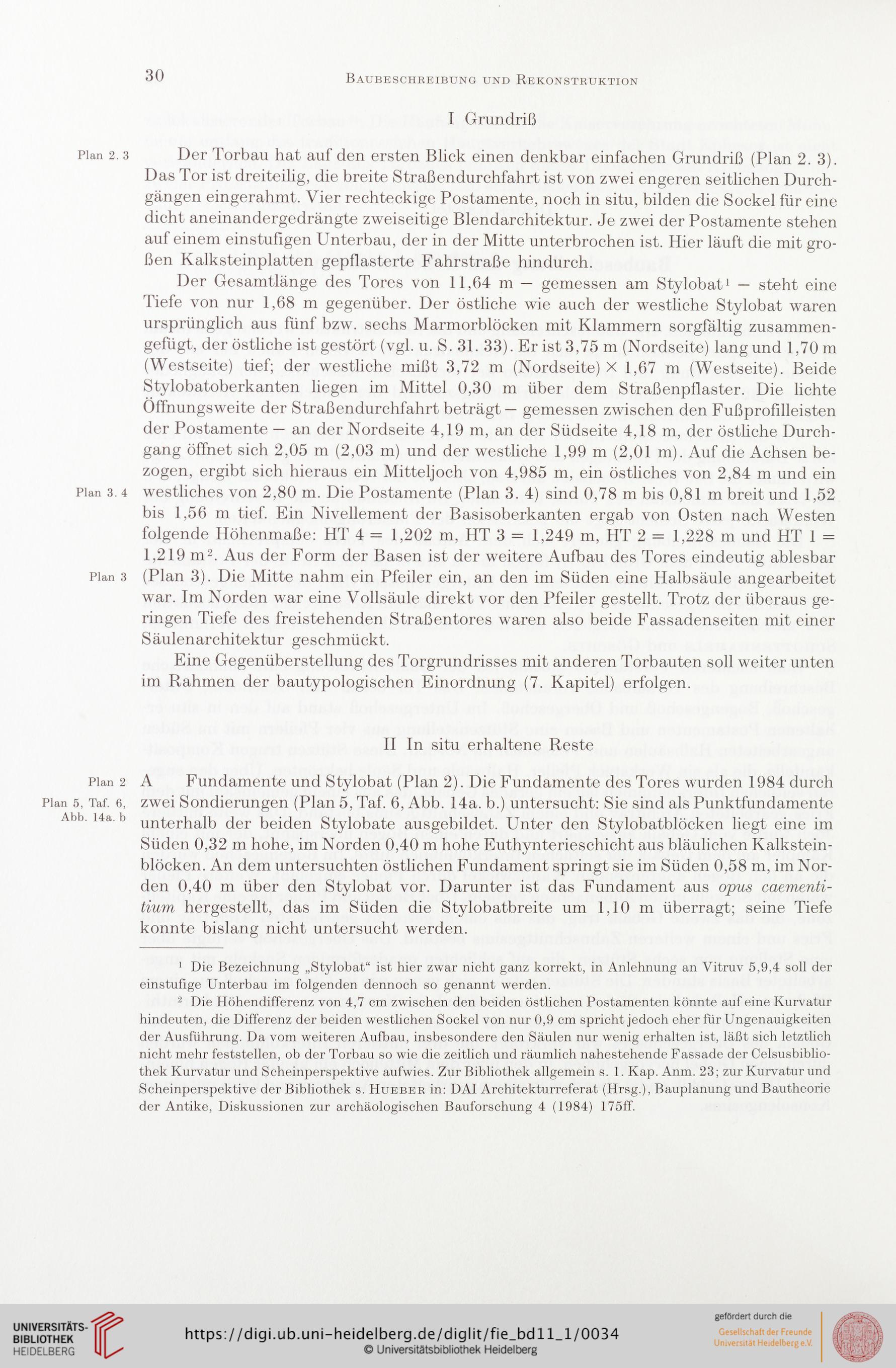30
Baubeschreibung und Rekonstruktion
I Grundriß
Plan 2. 3 Der Torbau hat auf den ersten Blick einen denkbar einfachen Grundriß (Plan 2.3).
Das Tor ist dreiteilig, die breite Straßendurchfahrt ist von zwei engeren seitlichen Durch-
gängen eingerahmt. Vier rechteckige Postamente, noch in situ, bilden die Sockel für eine
dicht aneinandergedrängte zweiseitige Blendarchitektur. Je zwei der Postamente stehen
auf einem einstufigen Unterbau, der in der Mitte unterbrochen ist. Hier läuft die mit gro-
ßen Kalksteinplatten gepflasterte Fahrstraße hindurch.
Der Gesamtlänge des Tores von 11,64 m — gemessen am Stylobat1 — steht eine
Tiefe von nur 1,68 m gegenüber. Der östliche wie auch der westliche Stylobat waren
ursprünglich aus fünf bzw. sechs Marmorblöcken mit Klammern sorgfältig zusammen-
gefügt, der östliche ist gestört (vgl. u. S. 31. 33). Er ist 3,75 m (Nordseite) lang und 1,70 m
(Westseite) tief; der westliche mißt 3,72 m (Nordseite) X 1,67 m (Westseite). Beide
Stylobatoberkanten liegen im Mittel 0,30 m über dem Straßenpflaster. Die lichte
Öffnungsweite der Straßendurchfahrt beträgt — gemessen zwischen den Fußprofilleisten
der Postamente — an der Nordseite 4,19 m, an der Südseite 4,18 m, der östliche Durch-
gang öffnet sich 2,05 m (2,03 m) und der westliche 1,99 m (2,01 m). Auf die Achsen be-
zogen, ergibt sich hieraus ein Mitteljoch von 4,985 m, ein östliches von 2,84 m und ein
Plan 3.4 westliches von 2,80 m. Die Postamente (Plan 3. 4) sind 0,78 m bis 0,81 m breit und 1,52
bis 1,56 m tief. Ein Nivellement der Basisoberkanten ergab von Osten nach Westen
folgende Höhenmaße: HT 4 = 1,202 m, HT 3 = 1,249 m, HT 2 = 1,228 m und HT 1 -
1,219 m2. Aus der Form der Basen ist der weitere Aufbau des Tores eindeutig ablesbar
Plan 3 (Plan 3). Die Mitte nahm ein Pfeiler ein, an den im Süden eine Halbsäule angearbeitet
war. Im Norden war eine Vollsäule direkt vor den Pfeiler gestellt. Trotz der überaus ge-
ringen Tiefe des freistehenden Straßentores waren also beide Fassadenseiten mit einer
Säulenarchitektur geschmückt.
Eine Gegenüberstellung des Torgrundrisses mit anderen Torbauten soll weiter unten
im Rahmen der bautypologischen Einordnung (7. Kapitel) erfolgen.
II In situ erhaltene Reste
Plan 2 A Fundamente und Stylobat (Plan 2). Die Fundamente des Tores wurden 1984 durch
Plan 5, Taf. 6, zwei Sondierungen (Plan 5, Taf. 6, Abb. 14a. b.) untersucht: Sie sind als Punktfundamente
Abb. 14a. b unf,erhalb der beiden Stylobate ausgebildet. Unter den Stylobatblöcken liegt eine im
Süden 0,32 m hohe, im Norden 0,40 m hohe Euthynterieschicht aus bläulichen Kalkstein-
blöcken. An dem untersuchten östlichen Fundament springt sie im Süden 0,58 in, im Nor-
den 0,40 m über den Stylobat vor. Darunter ist das Fundament aus opus caementi-
tium hergestellt, das im Süden die Stylobatbreite um 1,10 m überragt; seine Tiefe
konnte bislang nicht untersucht werden.
1 Die Bezeichnung „Stylobat“ ist hier zwar nicht ganz korrekt, in Anlehnung an Vitruv 5,9,4 soll der
einstufige Unterbau im folgenden dennoch so genannt werden.
2 Die Höhendifferenz von 4,7 cm zwischen den beiden östlichen Postamenten könnte auf eine Kurvatur
hindeuten, die Differenz der beiden westlichen Sockel von nur 0,9 cm spricht jedoch eher für Ungenauigkeiten
der Ausführung. Da vom weiteren Aufbau, insbesondere den Säulen nur wenig erhalten ist, läßt sich letztlich
nicht mehr feststellen, ob der Torbau so wie die zeitlich und räumlich nahestehende Fassade der Celsusbiblio-
thek Kurvatur und Scheinperspektive aufwies. Zur Bibliothek allgemein s. 1. Kap. Anm. 23; zur Kurvatur und
Scheinperspektive der Bibliothek s. Hueber in: DAI Architekturreferat (Hrsg.), Bauplanung und Bautheorie
der Antike, Diskussionen zur archäologischen Bauforschung 4 (1984) 175ff.
Baubeschreibung und Rekonstruktion
I Grundriß
Plan 2. 3 Der Torbau hat auf den ersten Blick einen denkbar einfachen Grundriß (Plan 2.3).
Das Tor ist dreiteilig, die breite Straßendurchfahrt ist von zwei engeren seitlichen Durch-
gängen eingerahmt. Vier rechteckige Postamente, noch in situ, bilden die Sockel für eine
dicht aneinandergedrängte zweiseitige Blendarchitektur. Je zwei der Postamente stehen
auf einem einstufigen Unterbau, der in der Mitte unterbrochen ist. Hier läuft die mit gro-
ßen Kalksteinplatten gepflasterte Fahrstraße hindurch.
Der Gesamtlänge des Tores von 11,64 m — gemessen am Stylobat1 — steht eine
Tiefe von nur 1,68 m gegenüber. Der östliche wie auch der westliche Stylobat waren
ursprünglich aus fünf bzw. sechs Marmorblöcken mit Klammern sorgfältig zusammen-
gefügt, der östliche ist gestört (vgl. u. S. 31. 33). Er ist 3,75 m (Nordseite) lang und 1,70 m
(Westseite) tief; der westliche mißt 3,72 m (Nordseite) X 1,67 m (Westseite). Beide
Stylobatoberkanten liegen im Mittel 0,30 m über dem Straßenpflaster. Die lichte
Öffnungsweite der Straßendurchfahrt beträgt — gemessen zwischen den Fußprofilleisten
der Postamente — an der Nordseite 4,19 m, an der Südseite 4,18 m, der östliche Durch-
gang öffnet sich 2,05 m (2,03 m) und der westliche 1,99 m (2,01 m). Auf die Achsen be-
zogen, ergibt sich hieraus ein Mitteljoch von 4,985 m, ein östliches von 2,84 m und ein
Plan 3.4 westliches von 2,80 m. Die Postamente (Plan 3. 4) sind 0,78 m bis 0,81 m breit und 1,52
bis 1,56 m tief. Ein Nivellement der Basisoberkanten ergab von Osten nach Westen
folgende Höhenmaße: HT 4 = 1,202 m, HT 3 = 1,249 m, HT 2 = 1,228 m und HT 1 -
1,219 m2. Aus der Form der Basen ist der weitere Aufbau des Tores eindeutig ablesbar
Plan 3 (Plan 3). Die Mitte nahm ein Pfeiler ein, an den im Süden eine Halbsäule angearbeitet
war. Im Norden war eine Vollsäule direkt vor den Pfeiler gestellt. Trotz der überaus ge-
ringen Tiefe des freistehenden Straßentores waren also beide Fassadenseiten mit einer
Säulenarchitektur geschmückt.
Eine Gegenüberstellung des Torgrundrisses mit anderen Torbauten soll weiter unten
im Rahmen der bautypologischen Einordnung (7. Kapitel) erfolgen.
II In situ erhaltene Reste
Plan 2 A Fundamente und Stylobat (Plan 2). Die Fundamente des Tores wurden 1984 durch
Plan 5, Taf. 6, zwei Sondierungen (Plan 5, Taf. 6, Abb. 14a. b.) untersucht: Sie sind als Punktfundamente
Abb. 14a. b unf,erhalb der beiden Stylobate ausgebildet. Unter den Stylobatblöcken liegt eine im
Süden 0,32 m hohe, im Norden 0,40 m hohe Euthynterieschicht aus bläulichen Kalkstein-
blöcken. An dem untersuchten östlichen Fundament springt sie im Süden 0,58 in, im Nor-
den 0,40 m über den Stylobat vor. Darunter ist das Fundament aus opus caementi-
tium hergestellt, das im Süden die Stylobatbreite um 1,10 m überragt; seine Tiefe
konnte bislang nicht untersucht werden.
1 Die Bezeichnung „Stylobat“ ist hier zwar nicht ganz korrekt, in Anlehnung an Vitruv 5,9,4 soll der
einstufige Unterbau im folgenden dennoch so genannt werden.
2 Die Höhendifferenz von 4,7 cm zwischen den beiden östlichen Postamenten könnte auf eine Kurvatur
hindeuten, die Differenz der beiden westlichen Sockel von nur 0,9 cm spricht jedoch eher für Ungenauigkeiten
der Ausführung. Da vom weiteren Aufbau, insbesondere den Säulen nur wenig erhalten ist, läßt sich letztlich
nicht mehr feststellen, ob der Torbau so wie die zeitlich und räumlich nahestehende Fassade der Celsusbiblio-
thek Kurvatur und Scheinperspektive aufwies. Zur Bibliothek allgemein s. 1. Kap. Anm. 23; zur Kurvatur und
Scheinperspektive der Bibliothek s. Hueber in: DAI Architekturreferat (Hrsg.), Bauplanung und Bautheorie
der Antike, Diskussionen zur archäologischen Bauforschung 4 (1984) 175ff.