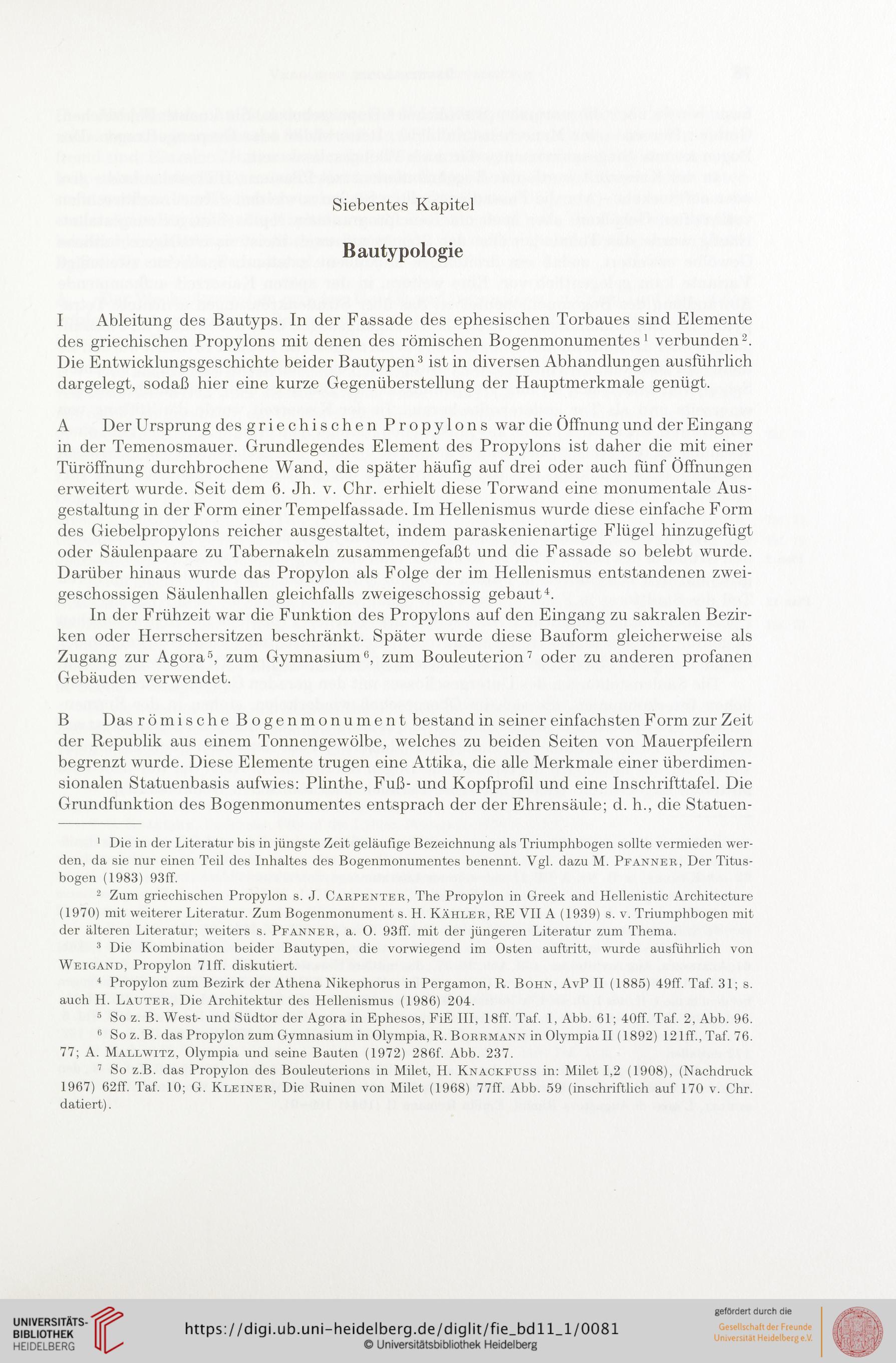Siebentes Kapitel
Bautypologie
I Ableitung des Bautyps. In der Fassade des ephesischen Torbaues sind Elemente
des griechischen Propylons mit denen des römischen Bogenmonumentes1 verbunden2.
Die Entwicklungsgeschichte beider Bautypen3 ist in diversen Abhandlungen ausführlich
dargelegt, sodaß hier eine kurze Gegenüberstellung der Hauptmerkmale genügt.
A Der Ursprung des griechischen Propylons war die Öffnung und der Eingang
in der Temenosmauer. Grundlegendes Element des Propylons ist daher die mit einer
Türöffnung durchbrochene Wand, die später häufig auf drei oder auch fünf Öffnungen
erweitert wurde. Seit dem 6. Jh. v. Chr. erhielt diese Torwand eine monumentale Aus-
gestaltung in der Form einer Tempelfassade. Im Hellenismus wurde diese einfache Form
des Giebelpropylons reicher ausgestaltet, indem paraskenienartige Flügel hinzugefügt
oder Säulenpaare zu Tabernakeln zusammengefaßt und die Fassade so belebt wurde.
Darüber hinaus wurde das Propylon als Folge der im Hellenismus entstandenen zwei-
geschossigen Säulenhallen gleichfalls zweigeschossig gebaut4.
In der Frühzeit war die Funktion des Propylons auf den Eingang zu sakralen Bezir-
ken oder Herrschersitzen beschränkt. Später wurde diese Bauform gleicherweise als
Zugang zur Agora5, zum Gymnasium6, zum Bouleuterion7 oder zu anderen profanen
Gebäuden verwendet.
B Das römische Bogenmonument bestand in seiner einfachsten Form zur Zeit
der Republik aus einem Tonnengewölbe, welches zu beiden Seiten von Mauerpfeilern
begrenzt wurde. Diese Elemente trugen eine Attika, die alle Merkmale einer überdimen-
sionalen Statuenbasis aufwies: Plinthe, Fuß- und Kopfprofil und eine Inschrifttafel. Die
Grundfunktion des Bogenmonumentes entsprach der der Ehrensäule; d. h., die Statuen-
1 Die in der Literatur bis in jüngste Zeit geläufige Bezeichnung als Triumphbogen sollte vermieden wer-
den, da sie nur einen Teil des Inhaltes des Bogenmonumentes benennt. Vgl. dazu M. Pfänner, Der Titus-
bogen (1983) 93ff.
2 Zum griechischen Propylon s. J. Carpenter, The Propylon in Greek and Hellenistic Architecture
(1970) mit weiterer Literatur. Zum Bogenmonument s. H. Kähler, RE VII A (1939) s. v. Triumphbogen mit
der älteren Literatur; weiters s. Pfänner, a. 0. 93ff. mit der jüngeren Literatur zum Thema.
3 Die Kombination beider Bautypen, die vorwiegend im Osten auftritt, wurde ausführlich von
Weigand, Propylon 71 ff. diskutiert.
4 Propylon zum Bezirk der Athena Nikephorus in Pergamon, R. Bohn, AvP II (1885) 49ff. Taf. 31; s.
auch H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus (1986) 204.
5 So z. B. West- und Südtor der Agora in Ephesos, FiE III, 18ff. Taf. 1, Abb. 61; 40ff. Taf. 2, Abb. 96.
6 So z. B. das Propylon zum Gymnasium in Olympia, R. Borrmann in Olympia II (1892) 121 ff., Taf. 76.
77; A. Mallwitz, Olympia und seine Bauten (1972) 286f. Abb. 237.
7 So z.B. das Propylon des Bouleuterions in Milet, H. Knackfuss in: Milet 1,2 (1908), (Nachdruck
1967) 62ff. Taf. 10; G. Kleiner, Die Ruinen von Milet (1968) 77ff. Abb. 59 (inschriftlich auf 170 v. Chr.
datiert).
Bautypologie
I Ableitung des Bautyps. In der Fassade des ephesischen Torbaues sind Elemente
des griechischen Propylons mit denen des römischen Bogenmonumentes1 verbunden2.
Die Entwicklungsgeschichte beider Bautypen3 ist in diversen Abhandlungen ausführlich
dargelegt, sodaß hier eine kurze Gegenüberstellung der Hauptmerkmale genügt.
A Der Ursprung des griechischen Propylons war die Öffnung und der Eingang
in der Temenosmauer. Grundlegendes Element des Propylons ist daher die mit einer
Türöffnung durchbrochene Wand, die später häufig auf drei oder auch fünf Öffnungen
erweitert wurde. Seit dem 6. Jh. v. Chr. erhielt diese Torwand eine monumentale Aus-
gestaltung in der Form einer Tempelfassade. Im Hellenismus wurde diese einfache Form
des Giebelpropylons reicher ausgestaltet, indem paraskenienartige Flügel hinzugefügt
oder Säulenpaare zu Tabernakeln zusammengefaßt und die Fassade so belebt wurde.
Darüber hinaus wurde das Propylon als Folge der im Hellenismus entstandenen zwei-
geschossigen Säulenhallen gleichfalls zweigeschossig gebaut4.
In der Frühzeit war die Funktion des Propylons auf den Eingang zu sakralen Bezir-
ken oder Herrschersitzen beschränkt. Später wurde diese Bauform gleicherweise als
Zugang zur Agora5, zum Gymnasium6, zum Bouleuterion7 oder zu anderen profanen
Gebäuden verwendet.
B Das römische Bogenmonument bestand in seiner einfachsten Form zur Zeit
der Republik aus einem Tonnengewölbe, welches zu beiden Seiten von Mauerpfeilern
begrenzt wurde. Diese Elemente trugen eine Attika, die alle Merkmale einer überdimen-
sionalen Statuenbasis aufwies: Plinthe, Fuß- und Kopfprofil und eine Inschrifttafel. Die
Grundfunktion des Bogenmonumentes entsprach der der Ehrensäule; d. h., die Statuen-
1 Die in der Literatur bis in jüngste Zeit geläufige Bezeichnung als Triumphbogen sollte vermieden wer-
den, da sie nur einen Teil des Inhaltes des Bogenmonumentes benennt. Vgl. dazu M. Pfänner, Der Titus-
bogen (1983) 93ff.
2 Zum griechischen Propylon s. J. Carpenter, The Propylon in Greek and Hellenistic Architecture
(1970) mit weiterer Literatur. Zum Bogenmonument s. H. Kähler, RE VII A (1939) s. v. Triumphbogen mit
der älteren Literatur; weiters s. Pfänner, a. 0. 93ff. mit der jüngeren Literatur zum Thema.
3 Die Kombination beider Bautypen, die vorwiegend im Osten auftritt, wurde ausführlich von
Weigand, Propylon 71 ff. diskutiert.
4 Propylon zum Bezirk der Athena Nikephorus in Pergamon, R. Bohn, AvP II (1885) 49ff. Taf. 31; s.
auch H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus (1986) 204.
5 So z. B. West- und Südtor der Agora in Ephesos, FiE III, 18ff. Taf. 1, Abb. 61; 40ff. Taf. 2, Abb. 96.
6 So z. B. das Propylon zum Gymnasium in Olympia, R. Borrmann in Olympia II (1892) 121 ff., Taf. 76.
77; A. Mallwitz, Olympia und seine Bauten (1972) 286f. Abb. 237.
7 So z.B. das Propylon des Bouleuterions in Milet, H. Knackfuss in: Milet 1,2 (1908), (Nachdruck
1967) 62ff. Taf. 10; G. Kleiner, Die Ruinen von Milet (1968) 77ff. Abb. 59 (inschriftlich auf 170 v. Chr.
datiert).