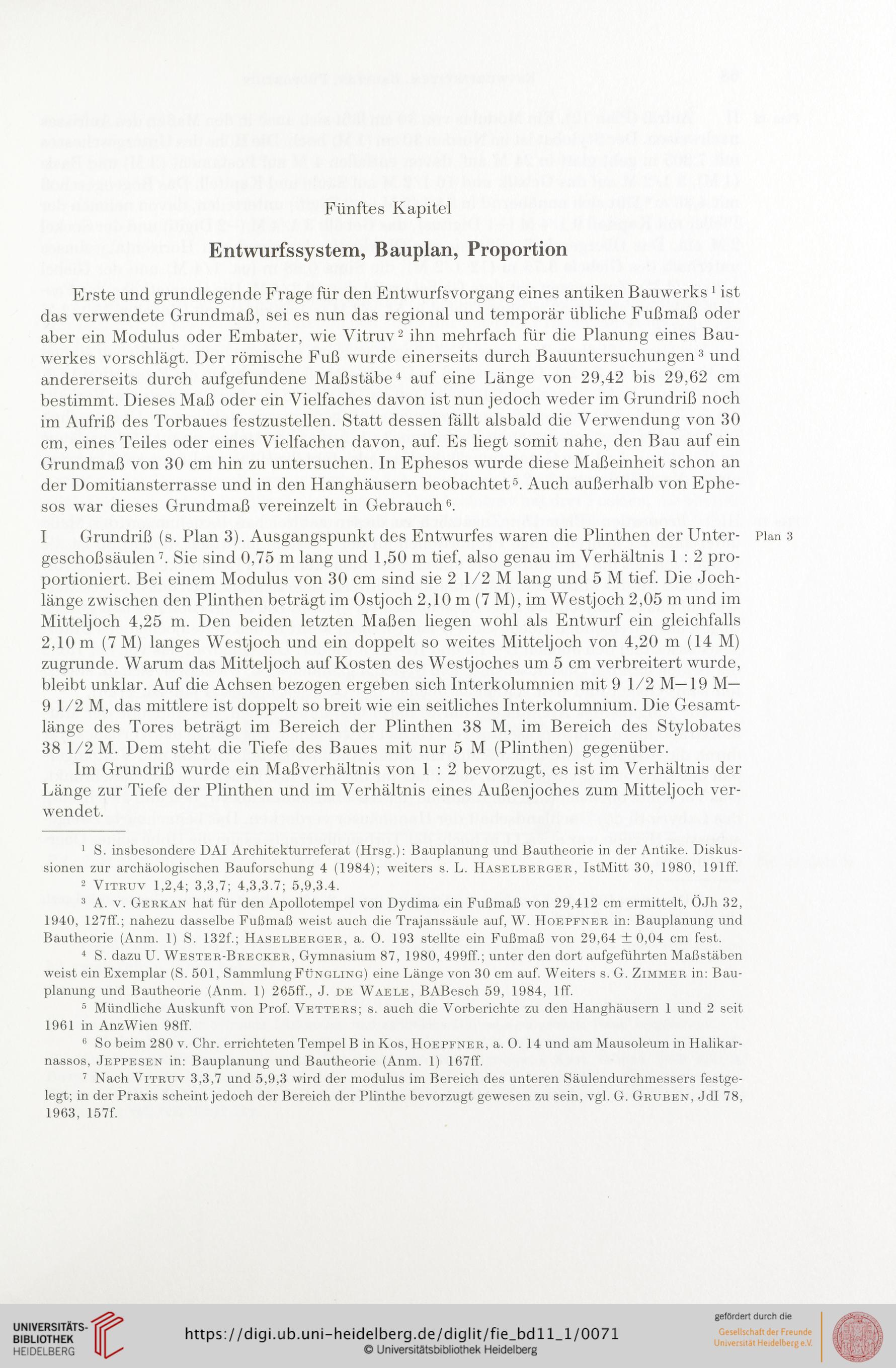Fünftes Kapitel
Entwurfssystem, Bauplan, Proportion
Erste und grundlegende Frage für den Entwurfsvorgang eines antiken Bauwerks 1 ist
das verwendete Grundmaß, sei es nun das regional und temporär übliche Fußmaß oder
aber ein Modulus oder Embater, wie Vitruv2 ihn mehrfach für die Planung eines Bau-
werkes vorschlägt. Der römische Fuß wurde einerseits durch Bauuntersuchungen3 und
andererseits durch aufgefundene Maßstäbe4 auf eine Länge von 29,42 bis 29,62 cm
bestimmt. Dieses Maß oder ein Vielfaches davon ist nun jedoch weder im Grundriß noch
im Aufriß des Torbaues festzustellen. Statt dessen fällt alsbald die Verwendung von 30
cm, eines Teiles oder eines Vielfachen davon, auf. Es liegt somit nahe, den Bau auf ein
Grundmaß von 30 cm hin zu untersuchen. In Ephesos wurde diese Maßeinheit schon an
der Domitiansterrasse und in den Hanghäusern beobachtet5. Auch außerhalb von Ephe-
sos war dieses Grundmaß vereinzelt in Gebrauch6.
I Grundriß (s. Plan 3). Ausgangspunkt des Entwurfes waren die Plinthen der Unter-
geschoßsäulen7. Sie sind 0,75 m lang und 1,50 m tief, also genau im Verhältnis 1 : 2 pro-
portioniert. Bei einem Modulus von 30 cm sind sie 2 1/2 M lang und 5 M tief. Die Joch-
länge zwischen den Plinthen beträgt im Ostjoch 2,10 m (7 M), im Westjoch 2,05 in und im
Mitteljoch 4,25 m. Den beiden letzten Maßen liegen wohl als Entwurf ein gleichfalls
2,10 m (7 M) langes Westjoch und ein doppelt so weites Mitteljoch von 4,20 m (14 M)
zugrunde. Warum das Mitteljoch auf Kosten des Westjoches um 5 cm verbreitert wurde,
bleibt unklar. Auf die Achsen bezogen ergeben sich Interkolumnien mit 9 1/2 M—19 M—
9 1/2 M, das mittlere ist doppelt so breit wie ein seitliches Interkolumnium. Die Gesamt-
länge des Tores beträgt im Bereich der Plinthen 38 M, im Bereich des Stylobates
38 1/2 M. Dem steht die Tiefe des Baues mit nur 5 M (Plinthen) gegenüber.
Im Grundriß wurde ein Maß Verhältnis von 1 : 2 bevorzugt, es ist im Verhältnis der
Länge zur Tiefe der Plinthen und im Verhältnis eines Außenjoches zum Mitteljoch ver-
wendet.
1 S. insbesondere DAI Architekturreferat (Hrsg.): Bauplanung und Bautheorie in der Antike. Diskus-
sionen zur archäologischen Bauforschung 4 (1984); weiters s. L. Haselberger, IstMitt 30, 1980, 191ff.
2 Vitruv 1,2,4; 3,3,7; 4,3,3.7; 5,9,3.4.
3 A. v. Gerkan hat für den Apollotempel von Dydima ein Fußmaß von 29,412 cm ermittelt, ÖJh 32,
1940, 127ff.; nahezu dasselbe Fußmaß weist auch die Trajanssäule auf, W. Hoepfner in: Bauplanung und
Bautheorie (Anm. 1) S. 132f.; Haselberger, a. 0. 193 stellte ein Fußmaß von 29,64 ±0,04 cm fest.
4 S. dazu U. Wester-Brecker, Gymnasium 87, 1980, 499ff.; unter den dort aufgeführten Maßstäben
weist ein Exemplar (S. 501, Sammlung Füngling) eine Länge von 30 cm auf. Weiters s. G. Zimmer in: Bau-
planung und Bautheorie (Anm. 1) 265ff., J. de Waele, BABesch 59, 1984, lff.
5 Mündliche Auskunft von Prof. Vetters; s. auch die Vorberichte zu den Hanghäusern 1 und 2 seit
1961 in AnzWien 98ff.
6 So beim 280 v. Chr. errichteten Tempel B in Kos, Hoepfner, a. 0. 14 und am Mausoleum in Halikar-
nassos, Jeppesen in: Bauplanung und Bautheorie (Anm. 1) 167ff.
7 Nach Vitruv 3,3,7 und 5,9,3 wird der modulus im Bereich des unteren Säulendurchmessers festge-
legt; in der Praxis scheint jedoch der Bereich der Plinthe bevorzugt gewesen zu sein, vgl. G. Gruben, Jdl 78,
1963, 157f.
Plan 3
Entwurfssystem, Bauplan, Proportion
Erste und grundlegende Frage für den Entwurfsvorgang eines antiken Bauwerks 1 ist
das verwendete Grundmaß, sei es nun das regional und temporär übliche Fußmaß oder
aber ein Modulus oder Embater, wie Vitruv2 ihn mehrfach für die Planung eines Bau-
werkes vorschlägt. Der römische Fuß wurde einerseits durch Bauuntersuchungen3 und
andererseits durch aufgefundene Maßstäbe4 auf eine Länge von 29,42 bis 29,62 cm
bestimmt. Dieses Maß oder ein Vielfaches davon ist nun jedoch weder im Grundriß noch
im Aufriß des Torbaues festzustellen. Statt dessen fällt alsbald die Verwendung von 30
cm, eines Teiles oder eines Vielfachen davon, auf. Es liegt somit nahe, den Bau auf ein
Grundmaß von 30 cm hin zu untersuchen. In Ephesos wurde diese Maßeinheit schon an
der Domitiansterrasse und in den Hanghäusern beobachtet5. Auch außerhalb von Ephe-
sos war dieses Grundmaß vereinzelt in Gebrauch6.
I Grundriß (s. Plan 3). Ausgangspunkt des Entwurfes waren die Plinthen der Unter-
geschoßsäulen7. Sie sind 0,75 m lang und 1,50 m tief, also genau im Verhältnis 1 : 2 pro-
portioniert. Bei einem Modulus von 30 cm sind sie 2 1/2 M lang und 5 M tief. Die Joch-
länge zwischen den Plinthen beträgt im Ostjoch 2,10 m (7 M), im Westjoch 2,05 in und im
Mitteljoch 4,25 m. Den beiden letzten Maßen liegen wohl als Entwurf ein gleichfalls
2,10 m (7 M) langes Westjoch und ein doppelt so weites Mitteljoch von 4,20 m (14 M)
zugrunde. Warum das Mitteljoch auf Kosten des Westjoches um 5 cm verbreitert wurde,
bleibt unklar. Auf die Achsen bezogen ergeben sich Interkolumnien mit 9 1/2 M—19 M—
9 1/2 M, das mittlere ist doppelt so breit wie ein seitliches Interkolumnium. Die Gesamt-
länge des Tores beträgt im Bereich der Plinthen 38 M, im Bereich des Stylobates
38 1/2 M. Dem steht die Tiefe des Baues mit nur 5 M (Plinthen) gegenüber.
Im Grundriß wurde ein Maß Verhältnis von 1 : 2 bevorzugt, es ist im Verhältnis der
Länge zur Tiefe der Plinthen und im Verhältnis eines Außenjoches zum Mitteljoch ver-
wendet.
1 S. insbesondere DAI Architekturreferat (Hrsg.): Bauplanung und Bautheorie in der Antike. Diskus-
sionen zur archäologischen Bauforschung 4 (1984); weiters s. L. Haselberger, IstMitt 30, 1980, 191ff.
2 Vitruv 1,2,4; 3,3,7; 4,3,3.7; 5,9,3.4.
3 A. v. Gerkan hat für den Apollotempel von Dydima ein Fußmaß von 29,412 cm ermittelt, ÖJh 32,
1940, 127ff.; nahezu dasselbe Fußmaß weist auch die Trajanssäule auf, W. Hoepfner in: Bauplanung und
Bautheorie (Anm. 1) S. 132f.; Haselberger, a. 0. 193 stellte ein Fußmaß von 29,64 ±0,04 cm fest.
4 S. dazu U. Wester-Brecker, Gymnasium 87, 1980, 499ff.; unter den dort aufgeführten Maßstäben
weist ein Exemplar (S. 501, Sammlung Füngling) eine Länge von 30 cm auf. Weiters s. G. Zimmer in: Bau-
planung und Bautheorie (Anm. 1) 265ff., J. de Waele, BABesch 59, 1984, lff.
5 Mündliche Auskunft von Prof. Vetters; s. auch die Vorberichte zu den Hanghäusern 1 und 2 seit
1961 in AnzWien 98ff.
6 So beim 280 v. Chr. errichteten Tempel B in Kos, Hoepfner, a. 0. 14 und am Mausoleum in Halikar-
nassos, Jeppesen in: Bauplanung und Bautheorie (Anm. 1) 167ff.
7 Nach Vitruv 3,3,7 und 5,9,3 wird der modulus im Bereich des unteren Säulendurchmessers festge-
legt; in der Praxis scheint jedoch der Bereich der Plinthe bevorzugt gewesen zu sein, vgl. G. Gruben, Jdl 78,
1963, 157f.
Plan 3