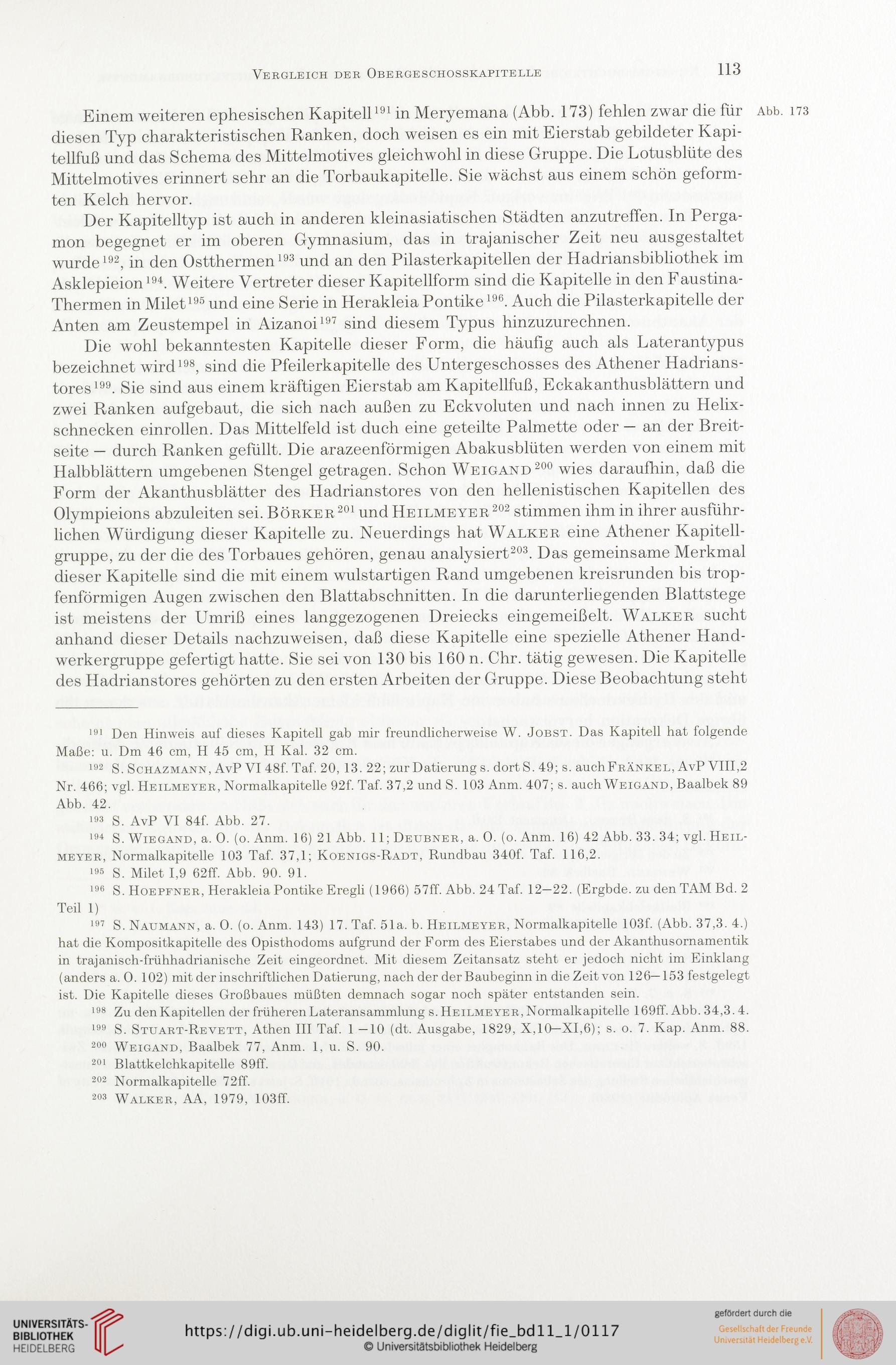Vergleich der Obergeschosskapitelle
113
Einem weiteren ephesischen Kapitell191 in Meryemana (Abb. 173) fehlen zwar die für Abb. 173
diesen Typ charakteristischen Ranken, doch weisen es ein mit Eierstab gebildeter Kapi-
tellfuß und das Schema des Mittelmotives gleichwohl in diese Gruppe. Die Lotusblüte des
Mittelmotives erinnert sehr an die Torbaukapitelle. Sie wächst aus einem schön geform-
ten Kelch hervor.
Der Kapitelltyp ist auch in anderen kleinasiatischen Städten anzutreffen. In Perga-
mon begegnet er im oberen Gymnasium, das in trajanischer Zeit neu ausgestaltet
wurde192, in den Ostthermen193 und an den Pilasterkapitellen der Hadriansbibliothek im
Asklepieion194. Weitere Vertreter dieser Kapitellform sind die Kapitelle in den Faustina-
Thermen in Milet195 und eine Serie in Herakleia Pontike196. Auch die Pilasterkapitelle der
Anten am Zeustempel in Aizanoi197 sind diesem Typus hinzuzurechnen.
Die wohl bekanntesten Kapitelle dieser Form, die häufig auch als Laterantypus
bezeichnet wird198, sind die Pfeilerkapitelle des Untergeschosses des Athener Hadrians-
tores199. Sie sind aus einem kräftigen Eierstab am Kapitellfuß, Eckakanthusblättern und
zwei Ranken aufgebaut, die sich nach außen zu Eckvoluten und nach innen zu Helix-
schnecken einrollen. Das Mittelfeld ist duch eine geteilte Palmette oder — an der Breit-
seite — durch Ranken gefüllt. Die arazeenförmigen Abakusblüten werden von einem mit
Halbblättern umgebenen Stengel getragen. Schon Weigand 200 wies daraufhin, daß die
Form der Akanthusblätter des Hadrianstores von den hellenistischen Kapitellen des
Olympieions abzuleiten sei. Börker 201 und Heilmeyer 202 stimmen ihm in ihrer ausführ-
lichen Würdigung dieser Kapitelle zu. Neuerdings hat Walker eine Athener Kapitell-
gruppe, zu der die des Torbaues gehören, genau analysiert203. Das gemeinsame Merkmal
dieser Kapitelle sind die mit einem wulstartigen Rand umgebenen kreisrunden bis trop-
fenförmigen Augen zwischen den Blattabschnitten. In die darunterliegenden Blattstege
ist meistens der Umriß eines langgezogenen Dreiecks eingemeißelt. Walker sucht
anhand dieser Details nachzuweisen, daß diese Kapitelle eine spezielle Athener Hand-
werkergruppe gefertigt hatte. Sie sei von 130 bis 160 n. Chr. tätig gewesen. Die Kapitelle
des Hadrianstores gehörten zu den ersten Arbeiten der Gruppe. Diese Beobachtung steht
191 Den Hinweis auf dieses Kapitell gab mir freundlicherweise W. Jobst. Das Kapitell hat folgende
Maße: u. Dm 46 cm, H 45 cm, H Kal. 32 cm.
192 S. Schazmann, AvP VI 48f. Taf. 20, 13. 22; zur Datierung s. dort S. 49; s. auchFRÄNKEL, AvP VIII,2
Nr. 466; vgl. Heilmeyer, Normalkapitelle 92f. Taf. 37,2 und S. 103 Anm. 407; s. auch Weigand, Baalbek 89
Abb. 42.
193 S. AvP VI 84f. Abb. 27.
194 S. Wiegand, a. 0. (o. Anm. 16) 21 Abb. 11; Deubner, a. 0. (o. Anm. 16) 42 Abb. 33. 34; vgl. Heil-
meyer, Normalkapitelle 103 Taf. 37,1; Koenigs-Radt, Rundbau 340f. Taf. 116,2.
195 S. Milet 1,9 62ff. Abb. 90. 91.
196 S. Hoepfner, Herakleia Pontike Eregli (1966) 57ff. Abb. 24 Taf. 12—22. (Ergbde. zu den TAM Bd. 2
Teil 1)
197 S. Naumann, a. 0. (o. Anm. 143) 17. Taf. 51a. b. Heilmeyer, Normalkapitelle 103f. (Abb. 37,3. 4.)
hat die Kompositkapitelle des Opisthodoms aufgrund der Form des Eierstabes und der Akanthusornamentik
in trajanisch-frühhadrianische Zeit eingeordnet. Mit diesem Zeitansatz steht er jedoch nicht im Einklang
(anders a. 0. 102) mit der inschriftlichen Datierung, nach der der Baubeginn in die Zeit von 126—153 festgelegt
ist. Die Kapitelle dieses Großbaues müßten demnach sogar noch später entstanden sein.
198 Zu den Kapitellen der früheren Lateransammlung s. Heilmeyer, Normalkapitelle 169ff. Abb. 34,3.4.
199 S. Stuart-Revett, Athen III Taf. 1 —10 (dt. Ausgabe, 1829, X,10—XI,6); s. o. 7. Kap. Anm. 88.
200 Weigand, Baalbek 77, Anm. 1, u. S. 90.
201 Blattkelchkapitelle 89ff.
202 Normalkapitelle 72ff.
203 Walker, AA, 1979, 103ff.
113
Einem weiteren ephesischen Kapitell191 in Meryemana (Abb. 173) fehlen zwar die für Abb. 173
diesen Typ charakteristischen Ranken, doch weisen es ein mit Eierstab gebildeter Kapi-
tellfuß und das Schema des Mittelmotives gleichwohl in diese Gruppe. Die Lotusblüte des
Mittelmotives erinnert sehr an die Torbaukapitelle. Sie wächst aus einem schön geform-
ten Kelch hervor.
Der Kapitelltyp ist auch in anderen kleinasiatischen Städten anzutreffen. In Perga-
mon begegnet er im oberen Gymnasium, das in trajanischer Zeit neu ausgestaltet
wurde192, in den Ostthermen193 und an den Pilasterkapitellen der Hadriansbibliothek im
Asklepieion194. Weitere Vertreter dieser Kapitellform sind die Kapitelle in den Faustina-
Thermen in Milet195 und eine Serie in Herakleia Pontike196. Auch die Pilasterkapitelle der
Anten am Zeustempel in Aizanoi197 sind diesem Typus hinzuzurechnen.
Die wohl bekanntesten Kapitelle dieser Form, die häufig auch als Laterantypus
bezeichnet wird198, sind die Pfeilerkapitelle des Untergeschosses des Athener Hadrians-
tores199. Sie sind aus einem kräftigen Eierstab am Kapitellfuß, Eckakanthusblättern und
zwei Ranken aufgebaut, die sich nach außen zu Eckvoluten und nach innen zu Helix-
schnecken einrollen. Das Mittelfeld ist duch eine geteilte Palmette oder — an der Breit-
seite — durch Ranken gefüllt. Die arazeenförmigen Abakusblüten werden von einem mit
Halbblättern umgebenen Stengel getragen. Schon Weigand 200 wies daraufhin, daß die
Form der Akanthusblätter des Hadrianstores von den hellenistischen Kapitellen des
Olympieions abzuleiten sei. Börker 201 und Heilmeyer 202 stimmen ihm in ihrer ausführ-
lichen Würdigung dieser Kapitelle zu. Neuerdings hat Walker eine Athener Kapitell-
gruppe, zu der die des Torbaues gehören, genau analysiert203. Das gemeinsame Merkmal
dieser Kapitelle sind die mit einem wulstartigen Rand umgebenen kreisrunden bis trop-
fenförmigen Augen zwischen den Blattabschnitten. In die darunterliegenden Blattstege
ist meistens der Umriß eines langgezogenen Dreiecks eingemeißelt. Walker sucht
anhand dieser Details nachzuweisen, daß diese Kapitelle eine spezielle Athener Hand-
werkergruppe gefertigt hatte. Sie sei von 130 bis 160 n. Chr. tätig gewesen. Die Kapitelle
des Hadrianstores gehörten zu den ersten Arbeiten der Gruppe. Diese Beobachtung steht
191 Den Hinweis auf dieses Kapitell gab mir freundlicherweise W. Jobst. Das Kapitell hat folgende
Maße: u. Dm 46 cm, H 45 cm, H Kal. 32 cm.
192 S. Schazmann, AvP VI 48f. Taf. 20, 13. 22; zur Datierung s. dort S. 49; s. auchFRÄNKEL, AvP VIII,2
Nr. 466; vgl. Heilmeyer, Normalkapitelle 92f. Taf. 37,2 und S. 103 Anm. 407; s. auch Weigand, Baalbek 89
Abb. 42.
193 S. AvP VI 84f. Abb. 27.
194 S. Wiegand, a. 0. (o. Anm. 16) 21 Abb. 11; Deubner, a. 0. (o. Anm. 16) 42 Abb. 33. 34; vgl. Heil-
meyer, Normalkapitelle 103 Taf. 37,1; Koenigs-Radt, Rundbau 340f. Taf. 116,2.
195 S. Milet 1,9 62ff. Abb. 90. 91.
196 S. Hoepfner, Herakleia Pontike Eregli (1966) 57ff. Abb. 24 Taf. 12—22. (Ergbde. zu den TAM Bd. 2
Teil 1)
197 S. Naumann, a. 0. (o. Anm. 143) 17. Taf. 51a. b. Heilmeyer, Normalkapitelle 103f. (Abb. 37,3. 4.)
hat die Kompositkapitelle des Opisthodoms aufgrund der Form des Eierstabes und der Akanthusornamentik
in trajanisch-frühhadrianische Zeit eingeordnet. Mit diesem Zeitansatz steht er jedoch nicht im Einklang
(anders a. 0. 102) mit der inschriftlichen Datierung, nach der der Baubeginn in die Zeit von 126—153 festgelegt
ist. Die Kapitelle dieses Großbaues müßten demnach sogar noch später entstanden sein.
198 Zu den Kapitellen der früheren Lateransammlung s. Heilmeyer, Normalkapitelle 169ff. Abb. 34,3.4.
199 S. Stuart-Revett, Athen III Taf. 1 —10 (dt. Ausgabe, 1829, X,10—XI,6); s. o. 7. Kap. Anm. 88.
200 Weigand, Baalbek 77, Anm. 1, u. S. 90.
201 Blattkelchkapitelle 89ff.
202 Normalkapitelle 72ff.
203 Walker, AA, 1979, 103ff.