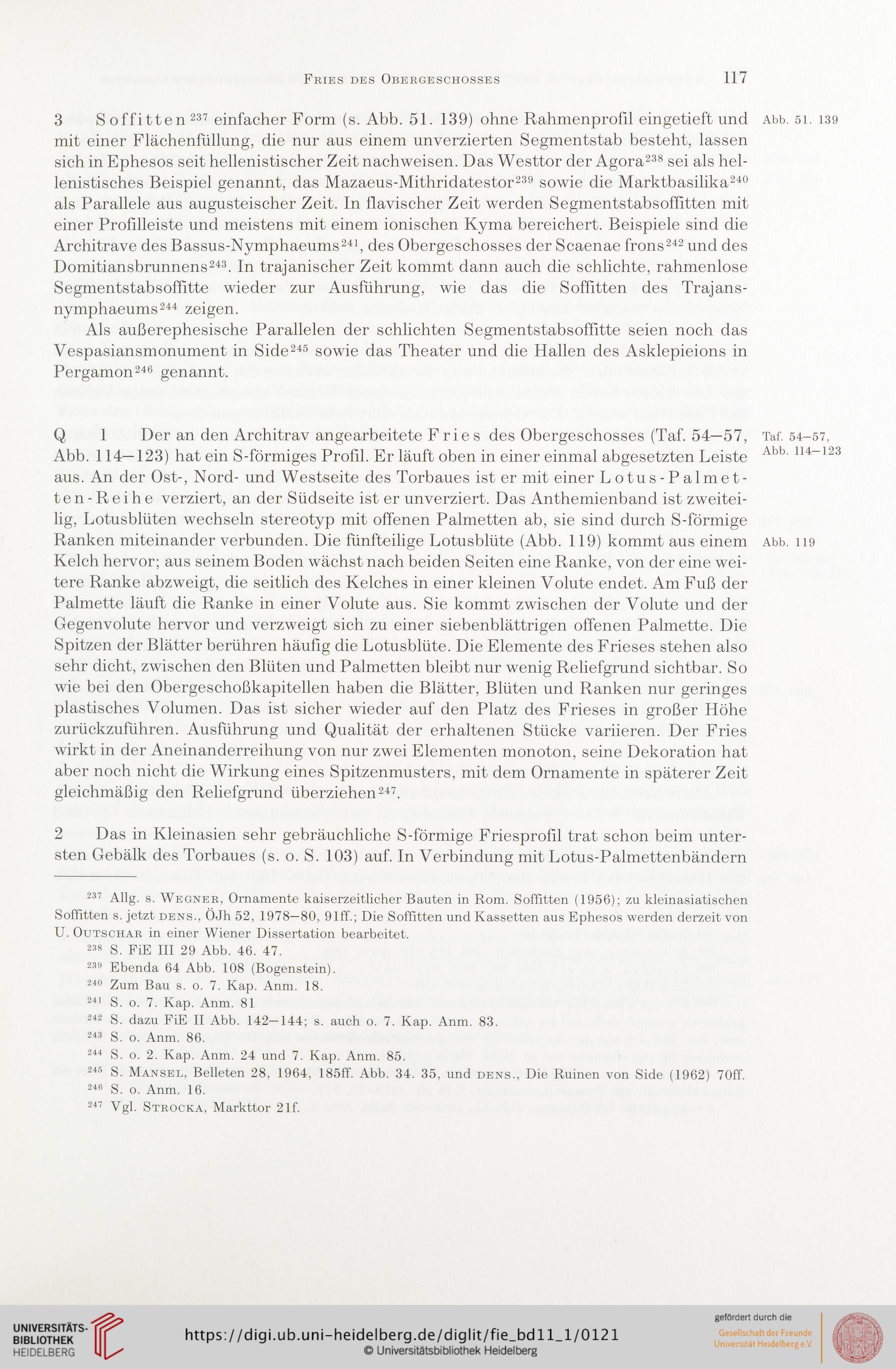Fries des Obergeschosses
117
3 Soffitten 237 einfacher Form (s. Abb. 51. 139) ohne Rahmenprofil eingetieft und Abb. 51. 139
mit einer Flächenfüllung, die nur aus einem unverzierten Segmentstab besteht, lassen
sich in Ephesos seit hellenistischer Zeit nachweisen. Das Westtor der Agora238 sei als hel-
lenistisches Beispiel genannt, das Mazaeus-Mithridatestor239 sowie die Marktbasilika240
als Parallele aus augusteischer Zeit. In flavischer Zeit werden Segmentstabsoffitten mit
einer Profilleiste und meistens mit einem ionischen Kyma bereichert. Beispiele sind die
Architrave des Bassus-Nymphaeums241, des Obergeschosses der Scaenae frons242 und des
Domitiansbrunnens243. In trajanischer Zeit kommt dann auch die schlichte, rahmenlose
Segmentstabsoffitte wieder zur Ausführung, wie das die Soffitten des Trajans-
nymphaeums244 zeigen.
Als außerephesische Parallelen der schlichten Segmentstabsoffitte seien noch das
Vespasiansmonument in Side245 sowie das Theater und die Hallen des Asklepieions in
Pergamon246 genannt.
Q I Der an den Architrav angearbeitete Fries des Obergeschosses (Taf. 54—57,
Abb. 114—123) hat ein S-förmiges Profil. Er läuft oben in einer einmal abgesetzten Leiste
aus. An der Ost-, Nord- und Westseite des Torbaues ist er mit einer Lotus-Palmet-
ten - Reihe verziert, an der Südseite ist er unverziert. Das Anthemienband ist zweitei-
lig, Lotusblüten wechseln stereotyp mit offenen Palmetten ab, sie sind durch S-förmige
Ranken miteinander verbunden. Die fünfteilige Lotusblüte (Abb. 119) kommt aus einem
Kelch hervor; aus seinem Boden wächst nach beiden Seiten eine Ranke, von der eine wei-
tere Ranke abzweigt, die seitlich des Kelches in einer kleinen Volute endet. Am Fuß der
Palmette läuft die Ranke in einer Volute aus. Sie kommt zwischen der Volute und der
Gegenvolute hervor und verzweigt sich zu einer siebenblättrigen offenen Palmette. Die
Spitzen der Blätter berühren häufig die Lotusblüte. Die Elemente des Frieses stehen also
sehr dicht, zwischen den Blüten und Palmetten bleibt nur wenig Reliefgrund sichtbar. So
wie bei den Obergeschoßkapitellen haben die Blätter, Blüten und Ranken nur geringes
plastisches Volumen. Das ist sicher wieder auf den Platz des Frieses in großer Höhe
zurückzuführen. Ausführung und Qualität der erhaltenen Stücke variieren. Der Fries
wirkt in der Aneinanderreihung von nur zwei Elementen monoton, seine Dekoration hat
aber noch nicht die Wirkung eines Spitzenmusters, mit dem Ornamente in späterer Zeit
gleichmäßig den Reliefgrund überziehen247.
Taf. 54-57,
Abb. 114-123
Abb. 119
2 Das in Kleinasien sehr gebräuchliche S-förmige Friesprofil trat schon beim unter-
sten Gebälk des Torbaues (s. o. S. 103) auf. In Verbindung mit Lotus-Palmettenbändern
23' Allg. s. Wegner, Ornamente kaiserzeitlicher Bauten in Rom. Soffitten (1956); zu kleinasiatischen
Solfitten s. jetzt dens., ÖJh 52, 1978—80, 91 ff.; Die Soffitten und Kassetten aus Ephesos werden derzeit von
U. Outschar in einer Wiener Dissertation bearbeitet.
238 S. FiE III 29 Abb. 46. 47.
239 Ebenda 64 Abb. 108 (Bogenstein).
240 Zum Bau s. o. 7. Kap. Anm. 18.
241 S. o. 7. Kap. Anm. 81
242 S. dazu FiE II Abb. 142—144; s. auch o. 7. Kap. Anm. 83.
243 S. o. Anm. 86.
244 S. o. 2. Kap. Anm. 24 und 7. Kap. Anm. 85.
245 S. Mansel, Beliefen 28, 1964, 185ff. Abb. 34. 35, und dens., Die Ruinen von Side (1962) 70ff.
246 S. o. Anm. 16.
247 Vgl. Strocka, Markttor 21f.
117
3 Soffitten 237 einfacher Form (s. Abb. 51. 139) ohne Rahmenprofil eingetieft und Abb. 51. 139
mit einer Flächenfüllung, die nur aus einem unverzierten Segmentstab besteht, lassen
sich in Ephesos seit hellenistischer Zeit nachweisen. Das Westtor der Agora238 sei als hel-
lenistisches Beispiel genannt, das Mazaeus-Mithridatestor239 sowie die Marktbasilika240
als Parallele aus augusteischer Zeit. In flavischer Zeit werden Segmentstabsoffitten mit
einer Profilleiste und meistens mit einem ionischen Kyma bereichert. Beispiele sind die
Architrave des Bassus-Nymphaeums241, des Obergeschosses der Scaenae frons242 und des
Domitiansbrunnens243. In trajanischer Zeit kommt dann auch die schlichte, rahmenlose
Segmentstabsoffitte wieder zur Ausführung, wie das die Soffitten des Trajans-
nymphaeums244 zeigen.
Als außerephesische Parallelen der schlichten Segmentstabsoffitte seien noch das
Vespasiansmonument in Side245 sowie das Theater und die Hallen des Asklepieions in
Pergamon246 genannt.
Q I Der an den Architrav angearbeitete Fries des Obergeschosses (Taf. 54—57,
Abb. 114—123) hat ein S-förmiges Profil. Er läuft oben in einer einmal abgesetzten Leiste
aus. An der Ost-, Nord- und Westseite des Torbaues ist er mit einer Lotus-Palmet-
ten - Reihe verziert, an der Südseite ist er unverziert. Das Anthemienband ist zweitei-
lig, Lotusblüten wechseln stereotyp mit offenen Palmetten ab, sie sind durch S-förmige
Ranken miteinander verbunden. Die fünfteilige Lotusblüte (Abb. 119) kommt aus einem
Kelch hervor; aus seinem Boden wächst nach beiden Seiten eine Ranke, von der eine wei-
tere Ranke abzweigt, die seitlich des Kelches in einer kleinen Volute endet. Am Fuß der
Palmette läuft die Ranke in einer Volute aus. Sie kommt zwischen der Volute und der
Gegenvolute hervor und verzweigt sich zu einer siebenblättrigen offenen Palmette. Die
Spitzen der Blätter berühren häufig die Lotusblüte. Die Elemente des Frieses stehen also
sehr dicht, zwischen den Blüten und Palmetten bleibt nur wenig Reliefgrund sichtbar. So
wie bei den Obergeschoßkapitellen haben die Blätter, Blüten und Ranken nur geringes
plastisches Volumen. Das ist sicher wieder auf den Platz des Frieses in großer Höhe
zurückzuführen. Ausführung und Qualität der erhaltenen Stücke variieren. Der Fries
wirkt in der Aneinanderreihung von nur zwei Elementen monoton, seine Dekoration hat
aber noch nicht die Wirkung eines Spitzenmusters, mit dem Ornamente in späterer Zeit
gleichmäßig den Reliefgrund überziehen247.
Taf. 54-57,
Abb. 114-123
Abb. 119
2 Das in Kleinasien sehr gebräuchliche S-förmige Friesprofil trat schon beim unter-
sten Gebälk des Torbaues (s. o. S. 103) auf. In Verbindung mit Lotus-Palmettenbändern
23' Allg. s. Wegner, Ornamente kaiserzeitlicher Bauten in Rom. Soffitten (1956); zu kleinasiatischen
Solfitten s. jetzt dens., ÖJh 52, 1978—80, 91 ff.; Die Soffitten und Kassetten aus Ephesos werden derzeit von
U. Outschar in einer Wiener Dissertation bearbeitet.
238 S. FiE III 29 Abb. 46. 47.
239 Ebenda 64 Abb. 108 (Bogenstein).
240 Zum Bau s. o. 7. Kap. Anm. 18.
241 S. o. 7. Kap. Anm. 81
242 S. dazu FiE II Abb. 142—144; s. auch o. 7. Kap. Anm. 83.
243 S. o. Anm. 86.
244 S. o. 2. Kap. Anm. 24 und 7. Kap. Anm. 85.
245 S. Mansel, Beliefen 28, 1964, 185ff. Abb. 34. 35, und dens., Die Ruinen von Side (1962) 70ff.
246 S. o. Anm. 16.
247 Vgl. Strocka, Markttor 21f.