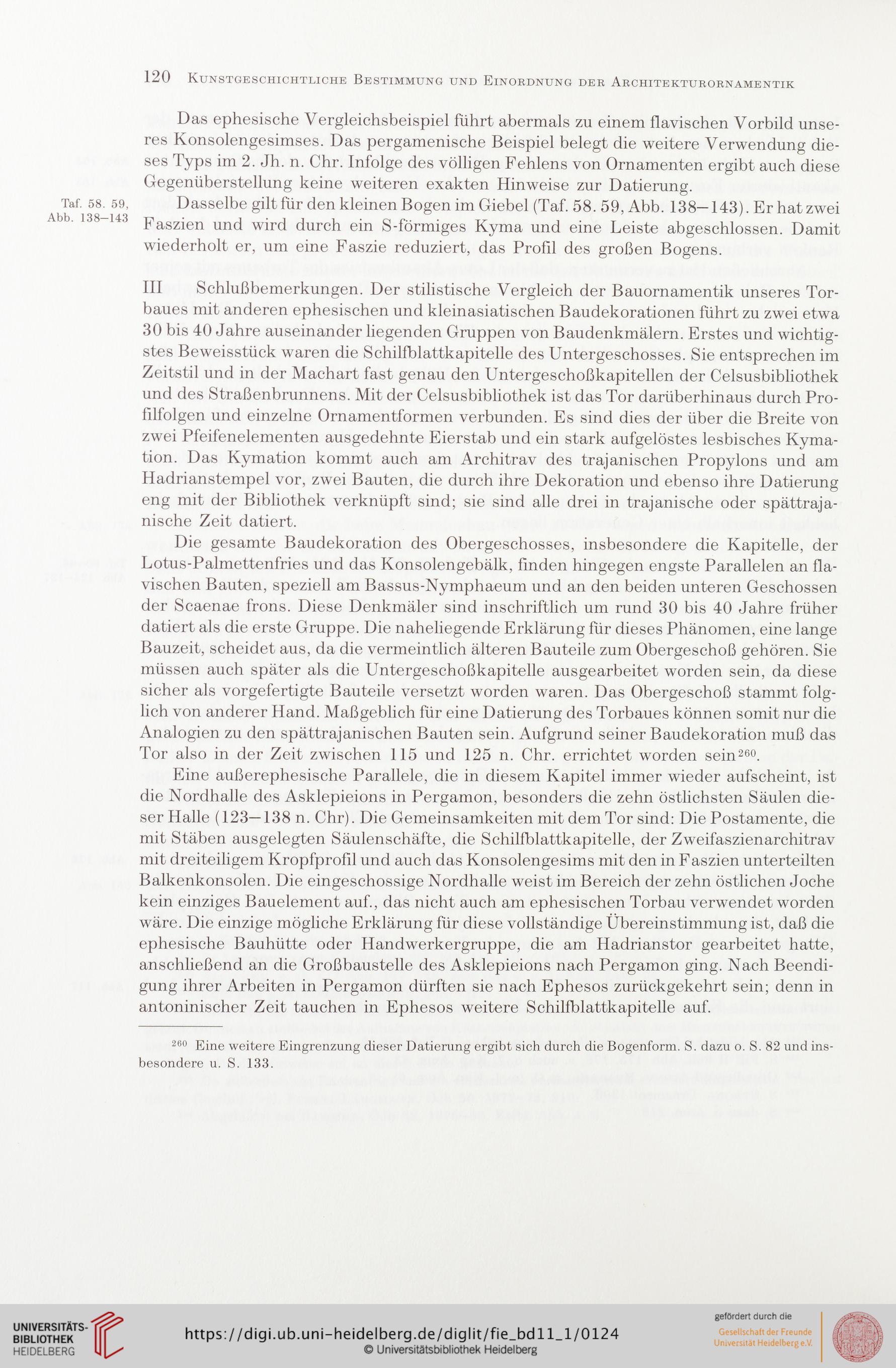120 Kunstgeschichtliche Bestimmung und Einordnung der Architekturornamentik
Das ephesische Vergleichsbeispiel führt abermals zu einem flavischen Vorbild unse-
res Konsolengesimses. Das pergamenische Beispiel belegt die weitere Verwendung die-
ses Typs im 2. Jh. n. Chr. Infolge des völligen Fehlens von Ornamenten ergibt auch diese
Gegenüberstellung keine weiteren exakten Hinweise zur Datierung.
Taf. 58. 59, Dasselbe gilt für den kleinen Bogen im Giebel (Taf. 58. 59, Abb. 138—143). Er hat zwei
Abb. 138-143 paszjen unc{ wjrc} durch ein S-förmiges Kyma und eine Leiste abgeschlossen. Damit
wiederholt er, um eine Faszie reduziert, das Profil des großen Bogens.
III Schlußbemerkungen. Der stilistische Vergleich der Bauornamentik unseres Tor-
baues mit anderen ephesischen und kleinasiatischen Baudekorationen führt zu zwei etwa
30 bis 40 Jahre auseinander liegenden Gruppen von Baudenkmälern. Erstes und wichtig-
stes Beweisstück waren die Schilfblattkapitelle des Untergeschosses. Sie entsprechen im
Zeitstil und in der Machart fast genau den Untergeschoßkapitellen der Celsusbibliothek
und des Straßenbrunnens. Mit der Celsusbibliothek ist das Tor darüberhinaus durch Pro-
filfolgen und einzelne Ornamentformen verbunden. Es sind dies der über die Breite von
zwei Pfeifenelementen ausgedehnte Eierstab und ein stark aufgelöstes lesbisches Kyma-
tion. Das Kymation kommt auch am Architrav des trajanischen Propylons und am
Hadrianstempel vor, zwei Bauten, die durch ihre Dekoration und ebenso ihre Datierung
eng mit der Bibliothek verknüpft sind; sie sind alle drei in trajanische oder spättraja-
nische Zeit datiert.
Die gesamte Baudekoration des Obergeschosses, insbesondere die Kapitelle, der
Lotus-Palmettenfries und das Konsolengebälk, finden hingegen engste Parallelen an fla-
vischen Bauten, speziell am Bassus-Nymphaeum und an den beiden unteren Geschossen
der Scaenae frons. Diese Denkmäler sind inschriftlich um rund 30 bis 40 Jahre früher
datiert als die erste Gruppe. Die naheliegende Erklärung für dieses Phänomen, eine lange
Bauzeit, scheidet aus, da die vermeintlich älteren Bauteile zum Obergeschoß gehören. Sie
müssen auch später als die Untergeschoßkapitelle ausgearbeitet worden sein, da diese
sicher als vorgefertigte Bauteile versetzt worden waren. Das Obergeschoß stammt folg-
lich von anderer Hand. Maßgeblich für eine Datierung des Torbaues können somit nur die
Analogien zu den spättrajanischen Bauten sein. Aufgrund seiner Baudekoration muß das
Tor also in der Zeit zwischen 115 und 125 n. Chr. errichtet worden sein260.
Eine außerephesische Parallele, die in diesem Kapitel immer wieder aufscheint, ist
die Nordhalle des Asklepieions in Pergamon, besonders die zehn östlichsten Säulen die-
ser Halle (123—138 n. Chr). Die Gemeinsamkeiten mit dem Tor sind: Die Postamente, die
mit Stäben ausgelegten Säulenschäfte, die Schilfblattkapitelle, der Zweifaszienarchitrav
mit dreiteiligem Kropfprofil und auch das Konsolengesims mit den in Faszien unterteilten
Balkenkonsolen. Die eingeschossige Nordhalle weist im Bereich der zehn östlichen Joche
kein einziges Bauelement auf., das nicht auch am ephesischen Torbau verwendet worden
wäre. Die einzige mögliche Erklärung für diese vollständige Übereinstimmung ist, daß die
ephesische Bauhütte oder Handwerkergruppe, die am Hadrianstor gearbeitet hatte,
anschließend an die Großbaustelle des Asklepieions nach Pergamon ging. Nach Beendi-
gung ihrer Arbeiten in Pergamon dürften sie nach Ephesos zurückgekehrt sein; denn in
antoninischer Zeit tauchen in Ephesos weitere Schilfblattkapitelle auf.
260 Eine weitere Eingrenzung dieser Datierung ergibt sich durch die Bogenform. S. dazu o. S. 82 und ins-
besondere u. S. 133.
Das ephesische Vergleichsbeispiel führt abermals zu einem flavischen Vorbild unse-
res Konsolengesimses. Das pergamenische Beispiel belegt die weitere Verwendung die-
ses Typs im 2. Jh. n. Chr. Infolge des völligen Fehlens von Ornamenten ergibt auch diese
Gegenüberstellung keine weiteren exakten Hinweise zur Datierung.
Taf. 58. 59, Dasselbe gilt für den kleinen Bogen im Giebel (Taf. 58. 59, Abb. 138—143). Er hat zwei
Abb. 138-143 paszjen unc{ wjrc} durch ein S-förmiges Kyma und eine Leiste abgeschlossen. Damit
wiederholt er, um eine Faszie reduziert, das Profil des großen Bogens.
III Schlußbemerkungen. Der stilistische Vergleich der Bauornamentik unseres Tor-
baues mit anderen ephesischen und kleinasiatischen Baudekorationen führt zu zwei etwa
30 bis 40 Jahre auseinander liegenden Gruppen von Baudenkmälern. Erstes und wichtig-
stes Beweisstück waren die Schilfblattkapitelle des Untergeschosses. Sie entsprechen im
Zeitstil und in der Machart fast genau den Untergeschoßkapitellen der Celsusbibliothek
und des Straßenbrunnens. Mit der Celsusbibliothek ist das Tor darüberhinaus durch Pro-
filfolgen und einzelne Ornamentformen verbunden. Es sind dies der über die Breite von
zwei Pfeifenelementen ausgedehnte Eierstab und ein stark aufgelöstes lesbisches Kyma-
tion. Das Kymation kommt auch am Architrav des trajanischen Propylons und am
Hadrianstempel vor, zwei Bauten, die durch ihre Dekoration und ebenso ihre Datierung
eng mit der Bibliothek verknüpft sind; sie sind alle drei in trajanische oder spättraja-
nische Zeit datiert.
Die gesamte Baudekoration des Obergeschosses, insbesondere die Kapitelle, der
Lotus-Palmettenfries und das Konsolengebälk, finden hingegen engste Parallelen an fla-
vischen Bauten, speziell am Bassus-Nymphaeum und an den beiden unteren Geschossen
der Scaenae frons. Diese Denkmäler sind inschriftlich um rund 30 bis 40 Jahre früher
datiert als die erste Gruppe. Die naheliegende Erklärung für dieses Phänomen, eine lange
Bauzeit, scheidet aus, da die vermeintlich älteren Bauteile zum Obergeschoß gehören. Sie
müssen auch später als die Untergeschoßkapitelle ausgearbeitet worden sein, da diese
sicher als vorgefertigte Bauteile versetzt worden waren. Das Obergeschoß stammt folg-
lich von anderer Hand. Maßgeblich für eine Datierung des Torbaues können somit nur die
Analogien zu den spättrajanischen Bauten sein. Aufgrund seiner Baudekoration muß das
Tor also in der Zeit zwischen 115 und 125 n. Chr. errichtet worden sein260.
Eine außerephesische Parallele, die in diesem Kapitel immer wieder aufscheint, ist
die Nordhalle des Asklepieions in Pergamon, besonders die zehn östlichsten Säulen die-
ser Halle (123—138 n. Chr). Die Gemeinsamkeiten mit dem Tor sind: Die Postamente, die
mit Stäben ausgelegten Säulenschäfte, die Schilfblattkapitelle, der Zweifaszienarchitrav
mit dreiteiligem Kropfprofil und auch das Konsolengesims mit den in Faszien unterteilten
Balkenkonsolen. Die eingeschossige Nordhalle weist im Bereich der zehn östlichen Joche
kein einziges Bauelement auf., das nicht auch am ephesischen Torbau verwendet worden
wäre. Die einzige mögliche Erklärung für diese vollständige Übereinstimmung ist, daß die
ephesische Bauhütte oder Handwerkergruppe, die am Hadrianstor gearbeitet hatte,
anschließend an die Großbaustelle des Asklepieions nach Pergamon ging. Nach Beendi-
gung ihrer Arbeiten in Pergamon dürften sie nach Ephesos zurückgekehrt sein; denn in
antoninischer Zeit tauchen in Ephesos weitere Schilfblattkapitelle auf.
260 Eine weitere Eingrenzung dieser Datierung ergibt sich durch die Bogenform. S. dazu o. S. 82 und ins-
besondere u. S. 133.