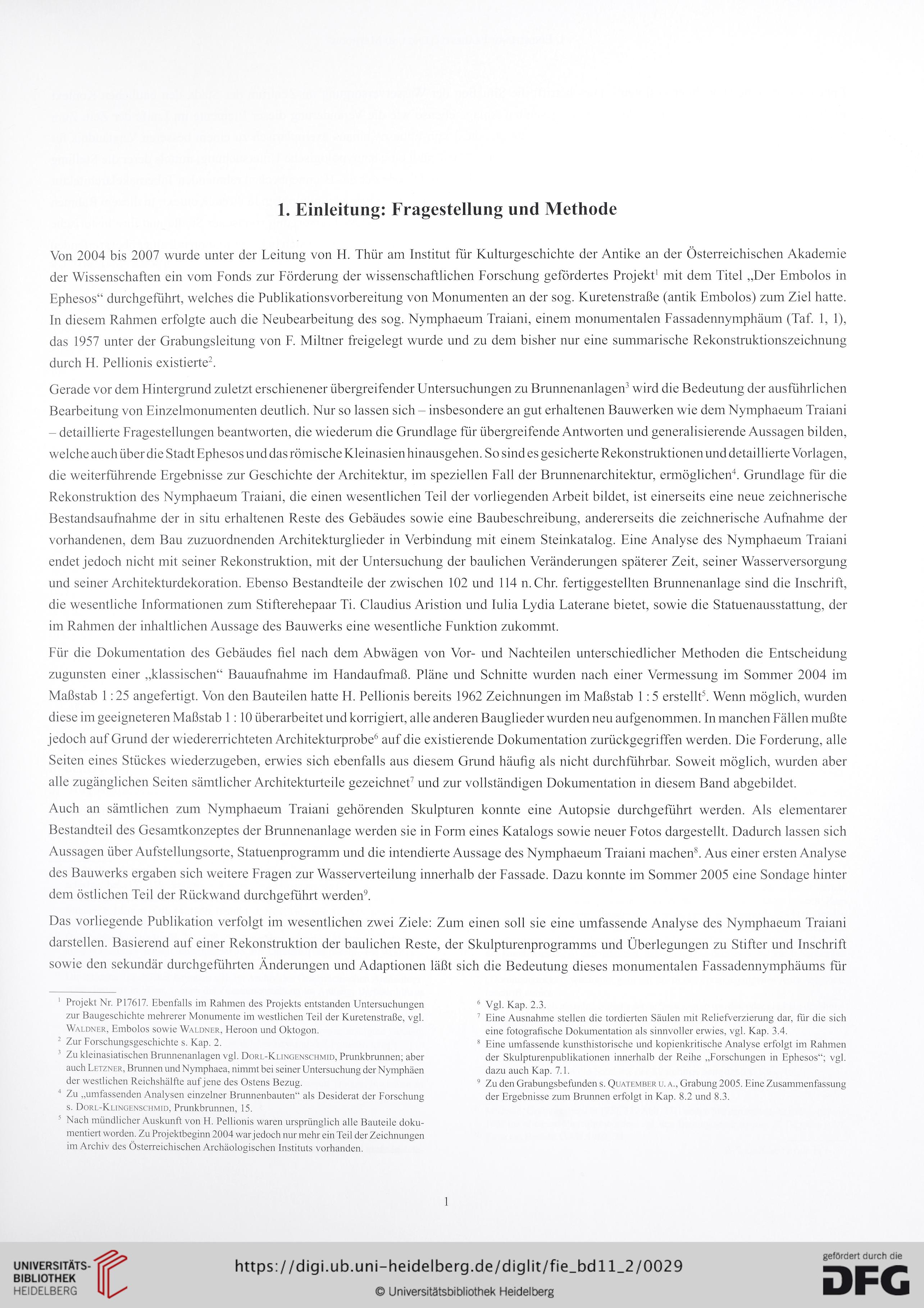1. Einleitung: Fragestellung und Methode
Von 2004 bis 2007 wurde unter der Leitung von H. Thür am Institut für Kulturgeschichte der Antike an der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften ein vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung gefördertes Projekt1 mit dem Titel „Der Embolos in
Ephesos“ durchgeführt, welches die Publikationsvorbereitung von Monumenten an der sog. Kuretenstraße (antik Embolos) zum Ziel hatte.
In diesem Rahmen erfolgte auch die Neubearbeitung des sog. Nymphaeum Traiani, einem monumentalen Fassadennymphäum (Taf. 1, 1),
das 1957 unter der Grabungsleitung von F. Miltner freigelegt wurde und zu dem bisher nur eine summarische Rekonstruktionszeichnung
durch H. Pellionis existierte2.
Gerade vor dem Hintergrund zuletzt erschienener übergreifender Untersuchungen zu Brunnenanlagen3 wird die Bedeutung der ausführlichen
Bearbeitung von Einzelmonumenten deutlich. Nur so lassen sich - insbesondere an gut erhaltenen Bauwerken wie dem Nymphaeum Traiani
- detaillierte Fragestellungen beantworten, die wiederum die Grundlage für übergreifende Antworten und generalisierende Aussagen bilden,
welche auch über die Stadt Ephesos und das römische Kleinasien hinausgehen. So sind es gesicherte Rekonstruktionen und detaillierte Vorlagen,
die weiterführende Ergebnisse zur Geschichte der Architektur, im speziellen Fall der Brunnenarchitektur, ermöglichen4. Grundlage für die
Rekonstruktion des Nymphaeum Traiani, die einen wesentlichen Teil der vorliegenden Arbeit bildet, ist einerseits eine neue zeichnerische
Bestandsaufnahme der in situ erhaltenen Reste des Gebäudes sowie eine Baubeschreibung, andererseits die zeichnerische Aufnahme der
vorhandenen, dem Bau zuzuordnenden Architekturglieder in Verbindung mit einem Steinkatalog. Eine Analyse des Nymphaeum Traiani
endet jedoch nicht mit seiner Rekonstruktion, mit der Untersuchung der baulichen Veränderungen späterer Zeit, seiner Wasserversorgung
und seiner Architekturdekoration. Ebenso Bestandteile der zwischen 102 und 114 n.Chr. fertiggestellten Brunnenanlage sind die Inschrift,
die wesentliche Informationen zum Stifterehepaar Ti. Claudius Aristion und lulia Lydia Laterane bietet, sowie die Statuenausstattung, der
im Rahmen der inhaltlichen Aussage des Bauwerks eine wesentliche Funktion zukommt.
Für die Dokumentation des Gebäudes fiel nach dem Abwägen von Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Methoden die Entscheidung
zugunsten einer „klassischen“ Bauaufnahme im Handaufmaß. Pläne und Schnitte wurden nach einer Vermessung im Sommer 2004 im
Maßstab 1:25 angefertigt. Von den Bauteilen hatte H. Pellionis bereits 1962 Zeichnungen im Maßstab 1 :5 erstellt5. Wenn möglich, wurden
diese im geeigneteren Maßstab 1:10 überarbeitet und korrigiert, alle anderen Bauglieder wurden neu aufgenommen. In manchen Fällen mußte
jedoch auf Grund der wiedererrichteten Architekturprobe6 auf die existierende Dokumentation zurückgegriffen werden. Die Forderung, alle
Seiten eines Stückes wiederzugeben, erwies sich ebenfalls aus diesem Grund häufig als nicht durchführbar. Soweit möglich, wurden aber
alle zugänglichen Seiten sämtlicher Architekturteile gezeichnet7 und zur vollständigen Dokumentation in diesem Band abgebildet.
Auch an sämtlichen zum Nymphaeum Traiani gehörenden Skulpturen konnte eine Autopsie durchgeführt werden. Als elementarer
Bestandteil des Gesamtkonzeptes der Brunnenanlage werden sie in Form eines Katalogs sowie neuer Fotos dargestellt. Dadurch lassen sich
Aussagen über Aufstellungsorte, Statuenprogramm und die intendierte Aussage des Nymphaeum Traiani machen8. Aus einer ersten Analyse
des Bauwerks ergaben sich weitere Fragen zur Wasserverteilung innerhalb der Fassade. Dazu konnte im Sommer 2005 eine Sondage hinter
dem östlichen Teil der Rückwand durchgeführt werden9.
Das vorliegende Publikation verfolgt im wesentlichen zwei Ziele: Zum einen soll sie eine umfassende Analyse des Nymphaeum Traiani
darstellen. Basierend auf einer Rekonstruktion der baulichen Reste, der Skulpturenprogramms und Überlegungen zu Stifter und Inschrift
sowie den sekundär durchgeführten Änderungen und Adaptionen läßt sich die Bedeutung dieses monumentalen Fassadennymphäums für
1 Projekt Nr. P17617. Ebenfalls im Rahmen des Projekts entstanden Untersuchungen
zur Baugeschichte mehrerer Monumente im westlichen Teil der Kuretenstraße, vgl.
Waldner, Embolos sowie Waldner, Heroon und Oktogon.
2 Zur Forschungsgeschichte s. Kap. 2.
Zu kleinasiatischen Brunnenanlagen vgl. Dorl-Klingenschmid, Prunkbrunnen; aber
auch Letzner, Brunnen und Nymphaea, nimmt bei seiner Untersuchung derNymphäen
der westlichen Reichshälfte auf jene des Ostens Bezug.
4 Zu „umfassenden Analysen einzelner Brunnenbauten“ als Desiderat der Forschung
s. Dorl-Klingenschmid, Prunkbrunnen, 15.
Nach mündlicher Auskunft von H. Pellionis waren ursprünglich alle Bauteile doku-
mentiert worden. Zu Projektbeginn 2004 war jedoch nur mehr ein Teil der Zeichnungen
im Archiv des Österreichischen Archäologischen Instituts vorhanden.
6 Vgl. Kap. 2.3.
7 Eine Ausnahme stellen die tordierten Säulen mit Reliefverzierung dar, für die sich
eine fotografische Dokumentation als sinnvoller erwies, vgl. Kap. 3.4.
8 Eine umfassende kunsthistorische und kopienkritische Analyse erfolgt im Rahmen
der Skulpturenpublikationen innerhalb der Reihe „Forschungen in Ephesos“; vgl.
dazu auch Kap. 7.1.
9 Zu den Grabungsbefunden s. Quatember u. a., Grabung 2005. Eine Zusammenfassung
der Ergebnisse zum Brunnen erfolgt in Kap. 8.2 und 8.3.
1
Von 2004 bis 2007 wurde unter der Leitung von H. Thür am Institut für Kulturgeschichte der Antike an der Österreichischen Akademie
der Wissenschaften ein vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung gefördertes Projekt1 mit dem Titel „Der Embolos in
Ephesos“ durchgeführt, welches die Publikationsvorbereitung von Monumenten an der sog. Kuretenstraße (antik Embolos) zum Ziel hatte.
In diesem Rahmen erfolgte auch die Neubearbeitung des sog. Nymphaeum Traiani, einem monumentalen Fassadennymphäum (Taf. 1, 1),
das 1957 unter der Grabungsleitung von F. Miltner freigelegt wurde und zu dem bisher nur eine summarische Rekonstruktionszeichnung
durch H. Pellionis existierte2.
Gerade vor dem Hintergrund zuletzt erschienener übergreifender Untersuchungen zu Brunnenanlagen3 wird die Bedeutung der ausführlichen
Bearbeitung von Einzelmonumenten deutlich. Nur so lassen sich - insbesondere an gut erhaltenen Bauwerken wie dem Nymphaeum Traiani
- detaillierte Fragestellungen beantworten, die wiederum die Grundlage für übergreifende Antworten und generalisierende Aussagen bilden,
welche auch über die Stadt Ephesos und das römische Kleinasien hinausgehen. So sind es gesicherte Rekonstruktionen und detaillierte Vorlagen,
die weiterführende Ergebnisse zur Geschichte der Architektur, im speziellen Fall der Brunnenarchitektur, ermöglichen4. Grundlage für die
Rekonstruktion des Nymphaeum Traiani, die einen wesentlichen Teil der vorliegenden Arbeit bildet, ist einerseits eine neue zeichnerische
Bestandsaufnahme der in situ erhaltenen Reste des Gebäudes sowie eine Baubeschreibung, andererseits die zeichnerische Aufnahme der
vorhandenen, dem Bau zuzuordnenden Architekturglieder in Verbindung mit einem Steinkatalog. Eine Analyse des Nymphaeum Traiani
endet jedoch nicht mit seiner Rekonstruktion, mit der Untersuchung der baulichen Veränderungen späterer Zeit, seiner Wasserversorgung
und seiner Architekturdekoration. Ebenso Bestandteile der zwischen 102 und 114 n.Chr. fertiggestellten Brunnenanlage sind die Inschrift,
die wesentliche Informationen zum Stifterehepaar Ti. Claudius Aristion und lulia Lydia Laterane bietet, sowie die Statuenausstattung, der
im Rahmen der inhaltlichen Aussage des Bauwerks eine wesentliche Funktion zukommt.
Für die Dokumentation des Gebäudes fiel nach dem Abwägen von Vor- und Nachteilen unterschiedlicher Methoden die Entscheidung
zugunsten einer „klassischen“ Bauaufnahme im Handaufmaß. Pläne und Schnitte wurden nach einer Vermessung im Sommer 2004 im
Maßstab 1:25 angefertigt. Von den Bauteilen hatte H. Pellionis bereits 1962 Zeichnungen im Maßstab 1 :5 erstellt5. Wenn möglich, wurden
diese im geeigneteren Maßstab 1:10 überarbeitet und korrigiert, alle anderen Bauglieder wurden neu aufgenommen. In manchen Fällen mußte
jedoch auf Grund der wiedererrichteten Architekturprobe6 auf die existierende Dokumentation zurückgegriffen werden. Die Forderung, alle
Seiten eines Stückes wiederzugeben, erwies sich ebenfalls aus diesem Grund häufig als nicht durchführbar. Soweit möglich, wurden aber
alle zugänglichen Seiten sämtlicher Architekturteile gezeichnet7 und zur vollständigen Dokumentation in diesem Band abgebildet.
Auch an sämtlichen zum Nymphaeum Traiani gehörenden Skulpturen konnte eine Autopsie durchgeführt werden. Als elementarer
Bestandteil des Gesamtkonzeptes der Brunnenanlage werden sie in Form eines Katalogs sowie neuer Fotos dargestellt. Dadurch lassen sich
Aussagen über Aufstellungsorte, Statuenprogramm und die intendierte Aussage des Nymphaeum Traiani machen8. Aus einer ersten Analyse
des Bauwerks ergaben sich weitere Fragen zur Wasserverteilung innerhalb der Fassade. Dazu konnte im Sommer 2005 eine Sondage hinter
dem östlichen Teil der Rückwand durchgeführt werden9.
Das vorliegende Publikation verfolgt im wesentlichen zwei Ziele: Zum einen soll sie eine umfassende Analyse des Nymphaeum Traiani
darstellen. Basierend auf einer Rekonstruktion der baulichen Reste, der Skulpturenprogramms und Überlegungen zu Stifter und Inschrift
sowie den sekundär durchgeführten Änderungen und Adaptionen läßt sich die Bedeutung dieses monumentalen Fassadennymphäums für
1 Projekt Nr. P17617. Ebenfalls im Rahmen des Projekts entstanden Untersuchungen
zur Baugeschichte mehrerer Monumente im westlichen Teil der Kuretenstraße, vgl.
Waldner, Embolos sowie Waldner, Heroon und Oktogon.
2 Zur Forschungsgeschichte s. Kap. 2.
Zu kleinasiatischen Brunnenanlagen vgl. Dorl-Klingenschmid, Prunkbrunnen; aber
auch Letzner, Brunnen und Nymphaea, nimmt bei seiner Untersuchung derNymphäen
der westlichen Reichshälfte auf jene des Ostens Bezug.
4 Zu „umfassenden Analysen einzelner Brunnenbauten“ als Desiderat der Forschung
s. Dorl-Klingenschmid, Prunkbrunnen, 15.
Nach mündlicher Auskunft von H. Pellionis waren ursprünglich alle Bauteile doku-
mentiert worden. Zu Projektbeginn 2004 war jedoch nur mehr ein Teil der Zeichnungen
im Archiv des Österreichischen Archäologischen Instituts vorhanden.
6 Vgl. Kap. 2.3.
7 Eine Ausnahme stellen die tordierten Säulen mit Reliefverzierung dar, für die sich
eine fotografische Dokumentation als sinnvoller erwies, vgl. Kap. 3.4.
8 Eine umfassende kunsthistorische und kopienkritische Analyse erfolgt im Rahmen
der Skulpturenpublikationen innerhalb der Reihe „Forschungen in Ephesos“; vgl.
dazu auch Kap. 7.1.
9 Zu den Grabungsbefunden s. Quatember u. a., Grabung 2005. Eine Zusammenfassung
der Ergebnisse zum Brunnen erfolgt in Kap. 8.2 und 8.3.
1