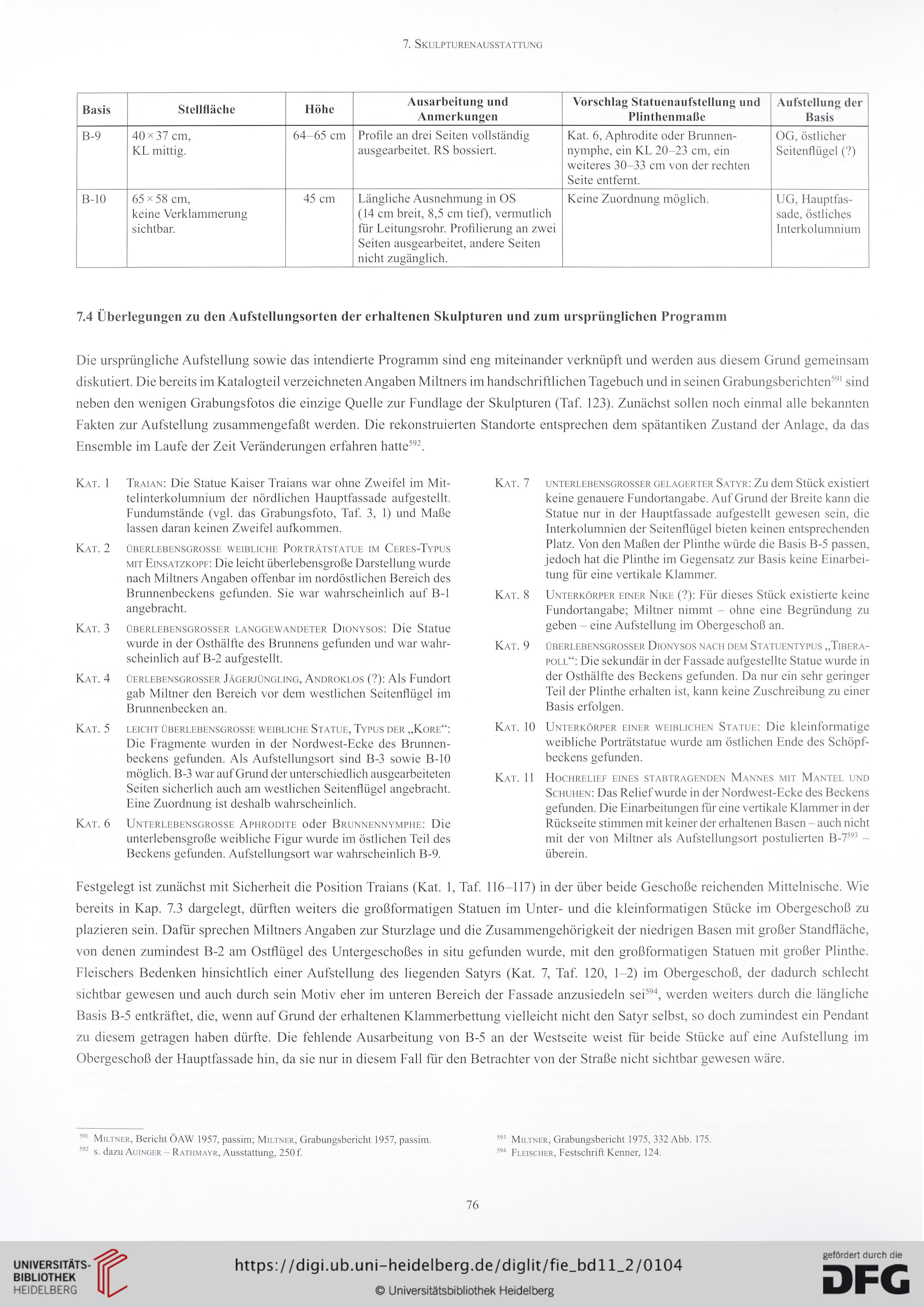7. Skulpturen Ausstattung
Basis
Stellfläche
Höhe
Ausarbeitung und
Anmerkungen
Vorschlag Statuenaufstellung und
Plinthenmaße
Aufstellung der
Basis
B-9
40 x 37 cm,
KL mittig.
64-65 cm
Profile an drei Seiten vollständig
ausgearbeitet. RS bossiert.
Kat. 6, Aphrodite oder Brunnen-
nymphe, ein KL 20-23 cm, ein
weiteres 30-33 cm von der rechten
Seite entfernt.
OG, östlicher
Seitenflügel (?)
B-10
65 x 58 cm,
keine Verklammerung
sichtbar.
45 cm
Längliche Ausnehmung in OS
(14 cm breit, 8,5 cm tief), vermutlich
für Leitungsrohr. Profilierung an zwei
Seiten ausgearbeitet, andere Seiten
nicht zugänglich.
Keine Zuordnung möglich.
UG, Hauptfas-
sade, östliches
Interkolumnium
7.4 Überlegungen zu den Aufstellungsorten der erhaltenen Skulpturen und zum ursprünglichen Programm
Die ursprüngliche Aufstellung sowie das intendierte Programm sind eng miteinander verknüpft und werden aus diesem Grund gemeinsam
diskutiert. Die bereits im Katalogteil verzeichneten Angaben Miltners im handschriftlichen Tagebuch und in seinen Grabungsberichten591 sind
neben den wenigen Grabungsfotos die einzige Quelle zur Fundlage der Skulpturen (Taf. 123). Zunächst sollen noch einmal alle bekannten
Fakten zur Aufstellung zusammengefaßt werden. Die rekonstruierten Standorte entsprechen dem spätantiken Zustand der Anlage, da das
Ensemble im Laufe der Zeit Veränderungen erfahren hatte592.
Kat. I Traian: Die Statue Kaiser Traians war ohne Zweifel im Mit-
telinterkolumnium der nördlichen Hauptfassade aufgestellt.
Fundumstände (vgl. das Grabungsfoto, Taf. 3, 1) und Maße
lassen daran keinen Zweifel aufkommen.
Kat. 2 überlebensgrosse weibliche Porträtstatue im Ceres-Typus
mit Einsatzkopf: Die leicht überlebensgroße Darstellung wurde
nach Miltners Angaben offenbar im nordöstlichen Bereich des
Brunnenbeckens gefunden. Sie war wahrscheinlich auf B-l
angebracht.
Kat. 3 überlebensgrosser langgewandeter Dionysos: Die Statue
wurde in der Osthälfte des Brunnens gefunden und war wahr-
scheinlich auf B-2 aufgestellt.
Kat. 4 üerlebensgrosser Jägerjüngling, Androklos (?): Als Fundort
gab Miltner den Bereich vor dem westlichen Seitenflügel im
Brunnenbecken an.
Kat. 5 leicht überlebensgrosse weibliche Statue, Typus der „Kore“:
Die Fragmente wurden in der Nordwest-Ecke des Brunnen-
beckens gefunden. Als Aufstellungsort sind B-3 sowie B-10
möglich. B-3 war auf Grund der unterschiedlich ausgearbeiteten
Seiten sicherlich auch am westlichen Seitenflügel angebracht.
Eine Zuordnung ist deshalb wahrscheinlich.
Kat. 6 LJnterlebensgrosse Aphrodite oder Brunnennymphe: Die
unterlebensgroße weibliche Figur wurde im östlichen Teil des
Beckens gefunden. Aufstellungsort war wahrscheinlich B-9.
Kat. 7 unterlebensgrosser gelagerter Satyr: Zu dem Stück existiert
keine genauere Fundortangabe. Auf Grund der Breite kann die
Statue nur in der Hauptfassade aufgestellt gewesen sein, die
Interkolumnien der Seitenflügel bieten keinen entsprechenden
Platz. Von den Maßen der Plinthe würde die Basis B-5 passen,
jedoch hat die Plinthe im Gegensatz zur Basis keine Einarbei-
tung für eine vertikale Klammer.
Kat. 8 Unterkörper einer Nike (?): Für dieses Stück existierte keine
Fundortangabe; Miltner nimmt - ohne eine Begründung zu
geben - eine Aufstellung im Obergeschoß an.
Kat. 9 überlebensgrosser Dionysos nach dem Statuentypus „Tibera-
poll“: Die sekundär in der Fassade aufgestellte Statue wurde in
der Osthälfte des Beckens gefunden. Da nur ein sehr geringer
Teil der Plinthe erhalten ist, kann keine Zuschreibung zu einer
Basis erfolgen.
Kat. 10 Unterkörper einer weiblichen Statue: Die kleinformatige
weibliche Porträtstatue wurde am östlichen Ende des Schöpf-
beckens gefunden.
Kat. 11 Hochrelief eines stabtragenden Mannes mit Mantel und
Schuhen: Das Relief wurde in der Nordwest-Ecke des Beckens
gefunden. Die Einarbeitungen für eine vertikale Klammer in der
Rückseite stimmen mit keiner der erhaltenen Basen - auch nicht
mit der von Miltner als Aufstellungsort postulierten B-7593 -
überein.
Festgelegt ist zunächst mit Sicherheit die Position Traians (Kat. 1, Taf. 116-117) in der über beide Geschoße reichenden Mittelnische. Wie
bereits in Kap. 7.3 dargelegt, dürften weiters die großformatigen Statuen im Unter- und die kleinformatigen Stücke im Obergeschoß zu
plazieren sein. Dafür sprechen Miltners Angaben zur Sturzlage und die Zusammengehörigkeit der niedrigen Basen mit großer Standfläche,
von denen zumindest B-2 am Ostflügel des Untergeschoßes in situ gefunden wurde, mit den großformatigen Statuen mit großer Plinthe.
Fleischers Bedenken hinsichtlich einer Aufstellung des liegenden Satyrs (Kat. 7, Taf. 120, 1-2) im Obergeschoß, der dadurch schlecht
sichtbar gewesen und auch durch sein Motiv eher im unteren Bereich der Fassade anzusiedeln sei594, werden weiters durch die längliche
Basis B-5 entkräftet, die, wenn auf Grund der erhaltenen Klammerbettung vielleicht nicht den Satyr selbst, so doch zumindest ein Pendant
zu diesem getragen haben dürfte. Die fehlende Ausarbeitung von B-5 an der Westseite weist für beide Stücke auf eine Aufstellung im
Obergeschoß der Hauptfassade hin, da sie nur in diesem Fall für den Betrachter von der Straße nicht sichtbar gewesen wäre.
391 Miltner, Bericht ÖAW 1957, passim; Miltner, Grabungsbericht 1957, passim.
592 s. dazu Auinger - Rathmayr, Ausstattung, 250 f.
593 Miltner, Grabungsbericht 1975, 332 Abb. 175.
594 Fleischer, Festschrift Kenner, 124.
76
Basis
Stellfläche
Höhe
Ausarbeitung und
Anmerkungen
Vorschlag Statuenaufstellung und
Plinthenmaße
Aufstellung der
Basis
B-9
40 x 37 cm,
KL mittig.
64-65 cm
Profile an drei Seiten vollständig
ausgearbeitet. RS bossiert.
Kat. 6, Aphrodite oder Brunnen-
nymphe, ein KL 20-23 cm, ein
weiteres 30-33 cm von der rechten
Seite entfernt.
OG, östlicher
Seitenflügel (?)
B-10
65 x 58 cm,
keine Verklammerung
sichtbar.
45 cm
Längliche Ausnehmung in OS
(14 cm breit, 8,5 cm tief), vermutlich
für Leitungsrohr. Profilierung an zwei
Seiten ausgearbeitet, andere Seiten
nicht zugänglich.
Keine Zuordnung möglich.
UG, Hauptfas-
sade, östliches
Interkolumnium
7.4 Überlegungen zu den Aufstellungsorten der erhaltenen Skulpturen und zum ursprünglichen Programm
Die ursprüngliche Aufstellung sowie das intendierte Programm sind eng miteinander verknüpft und werden aus diesem Grund gemeinsam
diskutiert. Die bereits im Katalogteil verzeichneten Angaben Miltners im handschriftlichen Tagebuch und in seinen Grabungsberichten591 sind
neben den wenigen Grabungsfotos die einzige Quelle zur Fundlage der Skulpturen (Taf. 123). Zunächst sollen noch einmal alle bekannten
Fakten zur Aufstellung zusammengefaßt werden. Die rekonstruierten Standorte entsprechen dem spätantiken Zustand der Anlage, da das
Ensemble im Laufe der Zeit Veränderungen erfahren hatte592.
Kat. I Traian: Die Statue Kaiser Traians war ohne Zweifel im Mit-
telinterkolumnium der nördlichen Hauptfassade aufgestellt.
Fundumstände (vgl. das Grabungsfoto, Taf. 3, 1) und Maße
lassen daran keinen Zweifel aufkommen.
Kat. 2 überlebensgrosse weibliche Porträtstatue im Ceres-Typus
mit Einsatzkopf: Die leicht überlebensgroße Darstellung wurde
nach Miltners Angaben offenbar im nordöstlichen Bereich des
Brunnenbeckens gefunden. Sie war wahrscheinlich auf B-l
angebracht.
Kat. 3 überlebensgrosser langgewandeter Dionysos: Die Statue
wurde in der Osthälfte des Brunnens gefunden und war wahr-
scheinlich auf B-2 aufgestellt.
Kat. 4 üerlebensgrosser Jägerjüngling, Androklos (?): Als Fundort
gab Miltner den Bereich vor dem westlichen Seitenflügel im
Brunnenbecken an.
Kat. 5 leicht überlebensgrosse weibliche Statue, Typus der „Kore“:
Die Fragmente wurden in der Nordwest-Ecke des Brunnen-
beckens gefunden. Als Aufstellungsort sind B-3 sowie B-10
möglich. B-3 war auf Grund der unterschiedlich ausgearbeiteten
Seiten sicherlich auch am westlichen Seitenflügel angebracht.
Eine Zuordnung ist deshalb wahrscheinlich.
Kat. 6 LJnterlebensgrosse Aphrodite oder Brunnennymphe: Die
unterlebensgroße weibliche Figur wurde im östlichen Teil des
Beckens gefunden. Aufstellungsort war wahrscheinlich B-9.
Kat. 7 unterlebensgrosser gelagerter Satyr: Zu dem Stück existiert
keine genauere Fundortangabe. Auf Grund der Breite kann die
Statue nur in der Hauptfassade aufgestellt gewesen sein, die
Interkolumnien der Seitenflügel bieten keinen entsprechenden
Platz. Von den Maßen der Plinthe würde die Basis B-5 passen,
jedoch hat die Plinthe im Gegensatz zur Basis keine Einarbei-
tung für eine vertikale Klammer.
Kat. 8 Unterkörper einer Nike (?): Für dieses Stück existierte keine
Fundortangabe; Miltner nimmt - ohne eine Begründung zu
geben - eine Aufstellung im Obergeschoß an.
Kat. 9 überlebensgrosser Dionysos nach dem Statuentypus „Tibera-
poll“: Die sekundär in der Fassade aufgestellte Statue wurde in
der Osthälfte des Beckens gefunden. Da nur ein sehr geringer
Teil der Plinthe erhalten ist, kann keine Zuschreibung zu einer
Basis erfolgen.
Kat. 10 Unterkörper einer weiblichen Statue: Die kleinformatige
weibliche Porträtstatue wurde am östlichen Ende des Schöpf-
beckens gefunden.
Kat. 11 Hochrelief eines stabtragenden Mannes mit Mantel und
Schuhen: Das Relief wurde in der Nordwest-Ecke des Beckens
gefunden. Die Einarbeitungen für eine vertikale Klammer in der
Rückseite stimmen mit keiner der erhaltenen Basen - auch nicht
mit der von Miltner als Aufstellungsort postulierten B-7593 -
überein.
Festgelegt ist zunächst mit Sicherheit die Position Traians (Kat. 1, Taf. 116-117) in der über beide Geschoße reichenden Mittelnische. Wie
bereits in Kap. 7.3 dargelegt, dürften weiters die großformatigen Statuen im Unter- und die kleinformatigen Stücke im Obergeschoß zu
plazieren sein. Dafür sprechen Miltners Angaben zur Sturzlage und die Zusammengehörigkeit der niedrigen Basen mit großer Standfläche,
von denen zumindest B-2 am Ostflügel des Untergeschoßes in situ gefunden wurde, mit den großformatigen Statuen mit großer Plinthe.
Fleischers Bedenken hinsichtlich einer Aufstellung des liegenden Satyrs (Kat. 7, Taf. 120, 1-2) im Obergeschoß, der dadurch schlecht
sichtbar gewesen und auch durch sein Motiv eher im unteren Bereich der Fassade anzusiedeln sei594, werden weiters durch die längliche
Basis B-5 entkräftet, die, wenn auf Grund der erhaltenen Klammerbettung vielleicht nicht den Satyr selbst, so doch zumindest ein Pendant
zu diesem getragen haben dürfte. Die fehlende Ausarbeitung von B-5 an der Westseite weist für beide Stücke auf eine Aufstellung im
Obergeschoß der Hauptfassade hin, da sie nur in diesem Fall für den Betrachter von der Straße nicht sichtbar gewesen wäre.
391 Miltner, Bericht ÖAW 1957, passim; Miltner, Grabungsbericht 1957, passim.
592 s. dazu Auinger - Rathmayr, Ausstattung, 250 f.
593 Miltner, Grabungsbericht 1975, 332 Abb. 175.
594 Fleischer, Festschrift Kenner, 124.
76